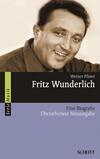Read the book: «Fritz Wunderlich»
Eine Biografie
Überarbeitete Neuausgabe

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Bestellnummer SDP 64
ISBN 978-3-7957-8612-0
© 2014 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz
Alle Rechte vorbehalten
Als Printausgabe erschienen unter der Bestellnummer SEM 8309
© 2010 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlags. Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung kopiert und in ein Netzwerk gestellt werden. Das gilt auch für Intranets von Schulen oder sonstigen Bildungseinrichtungen.
Dankbar meiner großartigen Mutter
ELEONORA PFISTER-STRASSER
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
Dass eine Künstler-Biografie, die zum ersten Mal vor zwanzig Jahren erschien und seither in einer überarbeiteten Neuausgabe abermals aufgelegt wurde, nun auch noch in Taschenbuchform erscheint, ist wohl außergewöhnlich. Zurückzuführen ist das auf ihren außergewöhnlichen Gegenstand – auf Fritz Wunderlich und die unmittelbare Faszination, die auch jetzt noch von ihm ausgeht, wo der unvergessene deutsche Tenor seinen 80. Geburtstag feiern könnte. Neue CD-Veröffentlichungen, zum Teil von privaten Tondokumenten der Familie, zum Teil von Rundfunkmitschnitten oder alten, vermeintlich längst vergessenen Schallplatten-Einspielungen aus den Kindertagen der Stereo-Zeit, bezeugen es: Fritz Wunderlich ist medial präsent wie vielleicht nie zuvor. Wohl fast bis auf den letzten Ton, den er je vor Mikrofonen gesungen hat, ist heute alles zugänglich gemacht worden: von den populären Schnulzen, die der blutjunge Sängerstudent für ein paar Mark im Südfunk in Freiburg einspielte, über private Probenmitschnitte bis zu jenen Tenorschlagern, mit denen er sich in den sechziger Jahren ebenbürtig neben so große Vorbilder wie Jan Kiepura, Joseph Schmidt, Richard Tauber oder Peter Anders einreihte.
Angesichts seiner nur gerade einmal zehn Jahre lang dauernden Karriere erscheint uns Fritz Wunderlichs künstlerische Produktivität erst recht unglaublich. Ein Blick in seinen prall gefüllten Terminkalender macht uns auch heute noch staunen; und was in diesen wenigen Jahren damals an Schallplatten-Einspielungen zustande gekommen ist, zum großen Teil im Teamwork mit den bedeutendsten Kolleginnen und Kollegen, den renommiertesten Dirigenten und besten Orchestern, darf sich auch heute noch sehen lassen.
Dies alles einmal chronologisch zu erfassen, Schritt für Schritt den einzelnen Terminen, den Konzertauftritten und Opernvorstellungen von Fritz Wunderlich nachzuspüren und dabei gleichzeitig seine künstlerische Umwelt, seine Familie und seine Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, das war die ursprüngliche Intention der vorliegenden Biografie. Eine Dokumentarbiografie also, die Fakten präsentiert, Material herbeischafft und Wunderlichs kulturelle Umwelt – die fünfziger und sechziger Jahre sind für uns ja längst historisch geworden – zumindest in Umrissen noch einmal nachzuzeichnen versucht. Nicht zuletzt sollte damit einer spekulativen Mythenbildung, wie sie spätestens nach Wunderlichs frühem, tragischem Tod da und dort die Runde zu machen begannen, entgegengewirkt werden.
Die Gefahr einer voreiligen Identifizierung mit dem Gegenstand war mir bei der Arbeit bewusst, und so erwies sich objektive Distanznahme als der gangbarste Weg, auch wenn sich selbst auf diesem Weg gewisse Aspekte einer Identifikation nie ganz vermeiden ließen. Ähnliches könnte man auch für den Anspruch nach Vollständigkeit geltend machen: Obwohl dieser nie restlos einlösbar ist, weil stets neue Materialen auftauchen, war er dennoch wegweisend.
Neu für viele Leser dürfte sein, dass Fritz Wunderlich nicht nur zusammen mit der australischen Primadonna Joan Sutherland gesungen hat, sondern ein einziges Mal auch mit der spanischen Operndiva Montserrat Caballé. Und zwar im Mai 1963 anlässlich des Festivals in Lausanne: Gegeben wurde Mozarts Zauberflöte, für Montserrat Caballé das Rollendebüt als Pamina; Mady Mesplé sang die Königin der Nacht und Gottlob Frick, einer der nächsten Künstlerfreunde Fritz Wunderlichs, den Sarastro. Trotz des Hinweises in der Biografie von Montserrat Caballé, dass eine der Aufführungen vom Rundfunk mitgeschnitten worden sei, konnte bis heute keine Bandkopie ausfindig gemacht werden.
Neu sind zudem Live-Mitschnitte aus Oper und Konzert, die in den letzten Jahren – meistens von der Deutschen Grammophon – zum ersten Mal anhand der Originalbänder und dadurch in optimaler Klangqualität veröffentlicht wurden. Dazu gehört die konzertante Aufführung von Händels Alcina von 1959 aus dem Kölner Funkhaus mit dem legendären »Traumpaar« Sutherland–Wunderlich; dazu gehört auch der deutsch gesungene Don Giovanni aus der Oper Köln vom März 1960. Die Hauptpartien waren mit prominenten Sängerpersönlichkeiten besetzt, vier von ihnen sangen ihre Rollen sogar zum ersten Mal: Hermann Prey (Don Giovanni), Franz Crass (Komtur), Edith Mathis (Zerline) sowie Fritz Wunderlich (Don Ottavio). Ergänzt wurde dieses vorzügliche Ensemble mit Elisabeth Grümmer, der damals zweifellos besten Donna Anna, und Hildegard Hillebrecht als Elvira. Am Dirigentenpult: Wolfgang Sawallisch.
Ebenso wertvoll ist ein Konzertmitschnitt von Giuseppe Verdis Messa da Requiem aus Stuttgart von 1960: das einzige Tondokument Wunderlichs von diesem Werk. Aus seinen Anfängerjahren an der Stuttgarter Oper stammen hingegen jene Einspielungen von Bachs Magnificat, des Oster-Oratoriums sowie der Osterkantate BWV 31, die Wunderlich unter dem Pseudonym Werner S. Braun veröffentlichen ließ, da er damals gleichzeitig beim Europäischen Phonoklub unter Vertrag war, und zwar exklusiv. Auch sie sind, übrigens im graphisch aparten Look der originalen LP-Hüllen von anno dazumal, neu aufgelegt worden wie auch die drei Populär-Platten, die Wunderlich für Polydor aufnahm: Ein Lied geht um die Welt, Du bist die Welt für mich und Wunderlich in Wien. Dasselbe gilt auch für die Weihnachtsmusik, die Wunderlich im Sommer 1966 mit dem Sängerkollegen Hermann Prey, mit Will Quadflieg, der die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium las, und einer Reihe befreundeter Musiker eingespielt hatte.
Abgesehen von einigen Fehlerkorrekturen und einer gegenüber der Erstausgabe leicht veränderten Bildauswahl, erscheint diese Biografie in ihrer ursprünglichen Gestalt und mit derselben Zielsetzung wie damals: die einzelnen Stationen im künstlerischen Werdegang Fritz Wunderlichs sachlich nachzuzeichnen, um den zahllosen Bewunderern einen fundierten Zugang zu Wunderlichs Leben und seiner singulären Kunst zu ermöglichen. Denn eines, so scheint mir, ist in den zwanzig Jahren seit der ersten Veröffentlichung dieses Buches gleich geblieben, ja hat sich seither wohl noch verstärkt: das Staunen über Fritz Wunderlichs außerordentliche künstlerische Intensität, über sein untrügliches Stimmgefühl, gleichviel ob er Bachs Passionen oder Schlagerlieder vom Tage sang, sowie über seinen Stimmglanz, die auserlesene Schönheit seines Timbres.
»Fast erschrak ich beim Hören«, so fasste es Dietrich Fischer-Dieskau nach seiner ersten Begegnung mit Wunderlich zusammen, »denn diese Stimme hatte einen berückenden Schmelz und dabei doch das notwendige Gran Metall im Klang, wie es so von deutschen Tenören schon seit langem nicht mehr zu vernehmen war.« Man könnte weitere Sänger zitieren, Tenorkollegen wie Werner Hollweg: »In seinem Fach ist das für mich die Jahrhundertstimme.« Oder Peter Seifert: »Fritz Wunderlich bedeutet für mich die große Herausforderung im deutschen lyrischen Fach. Ich glaube, dass er etwas ganz Wesentliches geschafft hat: Er war richtungsweisend für eine neue Generation.« Hängt es wohl damit zusammen, dass Fritz Wunderlichs Gesang auch heute, nach fünfzig und mehr Jahren, in keinem Ton »alt« und »gestrig« klingt, sondern gegenwärtig und zeitlos wie damals?
Kein Zweifel, Fritz Wunderlich stand hinter jedem Ton, den er sang – ja mehr noch: Er stand mit gleichsam heiligem Ernst hinter seiner Arbeit, und das seit seinen entbehrungsreichen Studienjahren in Freiburg im Breisgau. Welch hohen Begriff er von der großen Verantwortung eines nachschaffenden Künstlers hatte, geht aus einem Brief an eine Schulfreundin in Kusel hervor, der er Anfang 1953 schrieb:
»Morgen beginnt also meine eigentliche Arbeit wieder. Meine Arbeit, die mich wieder ganz erfüllen wird, die mir über alle Sorgen und Kümmernisse des Lebens hinweghilft. Je mehr ich auf meinem Weg fortschreite, desto näher kommt mir das Wort Beethovens: ›Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie.‹ Wie recht hatte dieser große Musiker, und wie klein und erbärmlich kommt man sich vor, wenn man die Majestät einer Symphonie erlebt, wenn man die ganze Urgewalt fühlt, die das Wort Musik als Begriff in sich trägt. Die ungeheure Verantwortung, die wir jungen Musiker tragen müssen, nämlich die Schöpfungen unserer großen Meister zum Leben zu erwecken, muss uns heilig sein. Denn nur wer den Geist, das eigentliche der Kunst entdeckt, der ist von der Vorsehung berufen, Künstler zu sein. Viele scheitern daran, dass sie sich ablenken lassen vom Beifall, der sie umrauscht, dass sie sich an dem Gefühl freuen, gefeiert zu sein. Das ist der Anfang des Verfalls.
Aber ich will keinen Vortrag über Kunstauffassung halten. Ich möchte hineinführen in das unfassbare Geheimnis, das echte Musik, gute, große Musik heißt.«
Zürich, im Mai 2010, Werner Pfister
Prolog
»Das Schicksal hat uns alles genommen.« Ein einziger Satz die Todesanzeige, Sprachlosigkeit vor dem Unfaßbaren. Die Nachricht vom Tode Fritz Wunderlichs am 17. September 1966 erschütterte mit jener Kraft, die sonst nur Hinterhältigem eignet. Mitten aus einem jungen Leben wurde er herausgerissen, neun Tage vor seinem sechsunddreißigsten Geburtstag und auf halber Höhe einer ganz großen Weltkarriere – ein grotesker Unfall und ein so alltäglicher zugleich, nach menschlichem Ermessen. Unbegreiflich, und doch mußte man ihn zu begreifen versuchen, diesen unendlichen Widersinn.
Deutschland, die großen Opernbühnen Europas, die renommierten Festspiele, Salzburg und München voran, hatten einen singulären Künstler verloren und einen Menschen, der alle in seinen Bann zog. Ein Sänger, der keine Mühe zu kennen schien, der mit seiner Kunst ebenso selbstverständlich wie verschwenderisch umging – verschwenderisch im Geben – und gerade deshalb das Herz zahlloser Musikfreunde traf. Unmittelbarer und wohl auch tiefer traf, als große Kunst es sonst vermag. Eine ganze Welt trauerte um diesen begnadeten Sänger – denn Fritz Wunderlich gehörte längst der Welt. Der Verlust, den die Musikwelt erlitten habe, sei nicht abzusehen, hieß es damals. Heute, nach einem Vierteljahrhundert, wissen wir es: Er ist unabsehbar. Fritz Wunderlich ist ohne Nachfolger geblieben.
Es heißt, für einen Künstler sei es am schönsten, auf der Höhe seines Ruhmes von der Bühne abzugehen. Wenn aber der Tod vorzeitig ins Leben greift, plötzlich und gewaltsam, wird dieser Abgang von der Bühne des Lebens zum tragischen Schicksal. Unergründlich und unfaßbar.
Zum letzten Mal stand Fritz Wunderlich am 5. September 1966 als Tamino auf der Bühne – in einer Zauberflöten-Vorstellung im Rahmen eines Gesamtgastspiels der Württembergischen Staatstheater am Edinburgh Festival 1966. Damit hatte sich ein Kreis geschlossen: Mozarts Märchenprinz war Wunderlichs letzte und erste Rolle auf der Opernbühne. Am 21. Juli 1954 debütierte er als Tamino – eine Aufführung der Staatlichen Hochschule für Musik im Freiburger Paulussaal, bestritten von Studierenden der Gesangsmeisterklassen. Für den Gesangsstudenten Wunderlich ein großer Erfolg – aber nicht mehr. Kein Anfängervertrag und schon gar keine sensationellen Angebote folgten, überhaupt keinerlei Zeichen eines kometenhaften Aufstiegs. Einzig die Städtischen Bühnen Freiburg meldeten sich: In ein paar Bettelstudent-Aufführungen durfte Fritz Wunderlich für einen erkrankten Sänger einspringen. Ein Agent hörte ihn und vermittelte ein Vorsingen an den Württembergischen Staatstheatern in Stuttgart. Keine Rede davon, daß Wunderlich bei diesem Vorsingen brilliert hätte.Vielmehr verlor er beinahe die Nerven. Dennoch bot ihm Generalmusikdirektor Ferdinand Leitner einen Fünfjahresvertrag an – nicht weil er einen erstklassigen Opernsänger entdeckt hätte, sondern weil er von Wunderlichs Talent dazu überzeugt war. Fünf Jahre wollte er ihm Zeit geben: daß aus dem begabten Gesangsstudenten ein veritabler Opernsänger werde.
Fünf Jahre blieb Fritz Wunderlich der Stuttgarter Oper treu – Lehrjahre, harte Jahre und auch Jahre voller Versuchungen. Vorerst sang er ausschließlich kleine Partien, Boten, Diener und andere Randfiguren. Seinen Durchbruch in einer großen Partie erlebte er am 18. Februar 1956, als er für einen erkrankten Kollegen als Tamino einsprang – wiederum die Rolle des Märchenprinzen, die ihn fortan wie ein zweites Ich begleiten sollte. Doch auch jetzt war es nicht der vielzitierte kometenhafte Aufstieg, der folgte, sondern harte Arbeit, Opernalltag Jahr für Jahr, durchzustehen nur mit eiserner Konzentration. Auch Niederlagen mußte Fritz Wunderlich einstecken lernen – als etwa Günther Rennert, der zu den wenigen Regisseuren gerechnet werden kann, die damals das musikalische Theater wegweisend beeinflußten, ihn kurzerhand aus der Besetzungsliste seiner Wildschütz-Neuinszenierung herausstreichen wollte. Weil er eine schiefe Nase habe und ein linkischer Schauspieler sei. Was im Klartext hieß, daß Wunderlich überhaupt kein Schauspieler war. Ferdinand Leitner mahnte damals zur Besonnenheit, und auch Generalintendant Walter Erich Schäfer hielt Rennert an, sich die Sache doch noch einmal zu überlegen. Rennert überlegte, zwang sich zur Geduld und formte in den nächsten paar Tagen aus dem Sänger Fritz Wunderlich einen Opernsänger und einen Schauspieler. Es schien ihm der Mühe wert, zumal sich Wunderlich mit einer geradezu überbordenden Intensität in diese Arbeit stürzte. Die Mühe machte sich auch bezahlt – nicht zuletzt in einigen maßstabsetzenden Rennert-Inszenierungen, unübertroffen bis heute, trotz aller nachgelieferten Konkurrenz.
Den internationalen Durchbruch erlebte Wunderlich im Sommer 1959 an den Salzburger Festspielen als Henry in Richard Strauss’ Oper Die schweigsame Frau. Auch das eine Rennert-Inszenierung; Karl Böhm dirigierte. Einige Wochen zuvor hatte Wunderlich einen Vertrag mit der Münchner Oper abgeschlossen. München wurde nicht nur seine neue Wirkungsstätte, sondern viel mehr: seine Heimat. Hier fühlte er sich wohl, hier wollte er leben. Endlich ein geruhsameres Leben? Das sprichwörtliche Ausruhen auf den Lorbeeren? Wunderlichs Terminkalender gibt andere Auskünfte. Bis zu siebzig Aufführungen pro Spielzeit hatte er in München zu singen – so schrieb es das Pflichtenheft vor. Hinzu kamen vierzig bis fünfzig Abende an der einstigen Stammbühne in Stuttgart. Und nicht zu vergessen die Festspielauftritte, die zahlreichen Gastspiele und Konzertverpflichtungen, in der deutschen Provinz und vermehrt auch in den bedeutenden Musikmetropolen Europas, dazu Rundfunk- und bald auch Schallplattenaufnahmen: Die Stufenleiter zum großen Erfolg wollte Sprosse für Sprosse einzeln erklommen werden. Geschenkt wurde nichts.
Am 26. September 1959, seinem neunundzwanzigsten Geburtstag, stand Fritz Wunderlich zum ersten Mal auf der Bühne der Wiener Staatsoper, als Tamino in einer Zauberflöten-Vorstellung. Ein einzelnes Gastspiel, mehr nicht. Dreieinhalb Jahre sollten vergehen, ehe Wunderlich als Mitglied des Wiener Ensembles in der Staatsoper Einzug hielt. Wien wurde zu seiner künstlerischen Heimat, das hat Fritz Wunderlich mehrmals beteuert; allein, leben wollte er weiterhin in München. Und längst gehörte er der ganzen Welt: Anfragen trafen von allen Kontinenten ein. Zu 95 Prozent mußte er absagen laut eines Berichtes aus dem Jahr 1960 zuhanden des Landesarbeitsamtes Südbayern – wollte er auch bewußt absagen, um seine künstlerische Entwicklung nicht zu gefährden. In dieser Hinsicht war er unnachgiebig und blieb er unnachgiebig, trotz aller verlockenden Angebote. Mindestens zehn Jahre wollte er noch singen, sagte der Fünfunddreißigjährige, und weitere zehn Jahre wären zweifellos hinzugekommen. Den Liedersänger Fritz Wunderlich hatte die Musikwelt ja gerade erst zur Kenntnis genommen – ihm vertraute Wunderlich in seinen paar letzten Lebensjahren am stärksten. Hier sah er seine eigentliche Zukunft. Lohengrin, Stolzing oder gar Tannhäuser – diese Fragen beschäftigten ihn weit weniger. Jedenfalls kein Thema für die kommenden zehn Jahre, meinte er. Eine Haltung, mit der sich letztlich auch Wieland Wagner und Bayreuth abfinden mußten.
»Die Tonkunst begrub einen reichen Besitz, aber noch schönere Hoffnungen.« Das Wort Franz Grillparzers auf den Tod Schuberts ist wiederholt auf Fritz Wunderlich angewandt worden. Mit einigem Recht, zweifellos. Denn allein der Gedanke, daß Wunderlich heute noch singen würde, ein sechzigjähriger, bestandener Sänger im Kreis seiner Kolleginnen und Kollegen von einst, Dietrich Fischer-Dieskau, Hermann Prey oder Walter Berry, Lucia Popp und Brigitte Fassbaender – dieser Gedanke hat etwas Faszinierendes. Er bietet und er bot seit je Raum für Spekulationen. Allein, über der immer wieder aufgeworfenen und neu diskutierten Frage, was wohl aus Wunderlich geworden wäre, ist zuweilen fast in Vergessenheit geraten, was und wer Wunderlich in der Tat war.
Die lebendige Erinnerung an den Sänger hat sich zum Bild verdinglicht, der Begriff Fritz Wunderlich ist zum Inbegriff geworden. Zum Inbegriff des Mozart-Gesanges vor allem. Er war der Tamino, war der Belmonte seiner Zeit – und ist es geblieben, auch für unsere Zeit. Ein Mozart-Prinz, der im Vertrauen auf die unerschütterliche Strahlkraft seiner Stimme allen Schrecknissen und Prüfungen in Schikaneders Zauberflöten-Märchenwelt sieghaft gewachsen war, der mit seinem unvergleichlich sehnsuchtsvoll intonierten ersten »Konstanze«-Ruf die unzähligen Verwicklungen in der Entführung aus dem Serail in Gang setzte und zu einem selbstverständlichen Abenteuer eigener Standhaftigkeit machte, wiederum auf den sieghaft reinen Glanz seiner Stimme vertrauend. Wenn je einer den Beweis erbracht hat, daß Mozart für seine Tenorgestalten keinerlei Schatten duldet, keinerlei Zwiespältigkeit oder Anfälligkeit – keiner hat ihn überzeugender erbracht als Fritz Wunderlich. Seine Mozart-Gestalten waren Helden ohne alles Zwielichtige, sein strahlend klarer Mozart-Gesang war gleichsam die natürliche Form mozartischen Heldenlebens. Nachprüfbar nicht zuletzt an der Figur des Don Ottavio, die Wunderlich von ihrem Mauerblümchendasein erlöst hat: auch hier ein Mannsbild auf der Bühne, zum ersten Mal vielleicht ein echter Widerpart zu Don Giovanni, ebenso gewichtig, ebenso bedeutsam.
Wunderlich, der Mozart-Tenor: Dieses Bild ist bekannt. Kein falsches Bild und vom Lauf der Zeit auch nicht wesentlich verfälscht. Das zeigen Live-Mitschnitte von damals, von den Salzburger Festspielen oder der Wiener Staatsoper, heute in der legalen Grauzone des Schallplattenmarktes erst öffentlich gemacht und jedermann als kostbares Dokument zur Verfügung stehend. Dennoch, das Bild vom Mozart-Tenor hat sich vor vieles andere gestellt, das auch – und ebenso wesentlich – Wunderlichs Kunst und Karriere ausmachte. Allein ein Überblick über die Werke aus dem 20. Jahrhundert, die Wunderlich gesungen hat, zeitgenössische Musik nach herkömmlicher Wortwahl, kann einen das Staunen lehren.Werner Egk, Carl Orff, Leoš Janáček, dazu Pfitzner, Richard Strauss, Mahler und Alban Berg, Strawinsky, Günter Raphael, Hermann Reutter oder Luigi Dallapiccola – diese Komponistenreihe würde genügen, um Wunderlich, wiederum nach herkömmlichem Jargon, als Spezialisten für zeitgenössische Musik zu ehren.
Überhaupt greift die Rede vom Opernsänger zu kurz. Konzertsänger war er ebenso intensiv und ebenso tieflotend; daß Mozart und Bach die beiden Eckpfeiler seiner musikalischen Welt seien, hat Fritz Wunderlich nicht nur dahergeredet. Regelmäßig sagte er lukrative Operntermine ab, um Jahr für Jahr Bachs Passionen zu singen. Auf einen bündigen Nenner gebracht: Der künstlerische Kontakt mit Karl Richter war ihm ebenso wichtig wie derjenige mit Herbert von Karajan, Rafael Kubeliks unorthodoxe Oratorienaufführungen bedeuteten ihm genausoviel wie Karl Böhms ausgezirkelte Operndirigate. Und zuletzt, so schien es, hatten die Dirigenten allesamt das Nachsehen, weil sie den begehrten Opern-und Oratoriensänger mit dem Liedersänger Wunderlich teilen mußten – ein Verlust für die Opernbühne und ein Verlust mehr noch für die Konzertgänger, zumal Wunderlich in den letzten Jahren seine Konzertverpflichtungen stark einschränkte.
Und dennoch, was für ein Gewinn: der Liedersänger Fritz Wunderlich! Nirgends läßt sich seine eminente Gesangskunst besser ablesen als beim Liedgesang. Die Worte müßten dem Sänger wie Kaviar im Munde zergehen, meinte einst die Gesangspädagogin Franziska Martienssen-Lohmann. Kaum einer hatte sich dieses kulinarische Ideal so zu eigen gemacht wie Fritz Wunderlich. Singen und Sagen waren bei ihm eines, vokaler Gestus und Textdeutung bedingten sich stets unmittelbar. Dazu die strahlende Leichtigkeit seiner metallglänzenden und dennoch weicher Schattierungen fähigen Stimme, elegant geführt bis in die extrem hohen Lagen – sie schien das Geheimnis des absoluten Gesangs in sich zu bergen. Faßbar wurde es für den Zuhörer als unbekümmerte Naivität, freilich im lautersten Wortsinne gemeint, ein Singen gleichsam ohne Kunst, ohne Allüre und ohne Manierismen. Und sicher ohne Künstelei. Kein Ringen wurde hörbar, weder um stimmliche Perfektion noch um tieflotende Grade des interpretatorischen Ausdruckes. All das war da, stand dem Sänger zu Gebot, ohne daß er es in der einen oder anderen Weise hätte herbeizwingen müssen. Daß dahinter unermeßlich viel Arbeit stand, harte Arbeit, Konzentration und eine Intensität bis zur existentiellen Gefährdung durch Selbstverausgabung – wer hätte es schon gemerkt? Vielleicht seine Kollegen, Brigitte Fassbaender etwa: »Fritz Wunderlich – der hat immer so gesungen, als ob es das letzte Mal wäre. Das möchte ich auch…«1
Ruhm ist die Summe der Mißverständnisse – auch diese Erfahrung blieb Fritz Wunderlich nicht erspart. Sein Name stand bald für mehr als nur seine Person, wurde zum Symbol für sängerische Perfektion schlechthin, für einen natürlichen, unverdorbenen, unaffektierten Gesang. Symbolen aber eignet keine faßbare Realität; sie stehen für sich selbst, entziehen sich jeder Verdinglichung. Zudem sind Symbole Allgemeinbesitz. Der Name Fritz Wunderlich war in aller Leute Mund, wurde mehrheitlich gar von Leuten gehandelt, die nie einen Fuß in ein Opernhaus oder einen Konzertsaal gesetzt hatten. Jeder kannte Fritz Wunderlich und hatte also auch ein Urteil über ihn – pauschal in den meisten Fällen, ein Urteil, das unbesehen zum Vorurteil wurde. Die unbekümmerte Naivität, die in Wunderlichs Gesang stets mitschwang, wurde in der Folge für bare Münze genommen: ein naiver Sänger, naturburschenhaft-jovial, stets zu einem Scherz aufgelegt, schulterklopfend im Kollegenkreis Witze reißend – die altbekannte Mär vom Götterjungen, dem alles in den Schoß fällt.
Ein fatales Mißverständnis – auch wenn sich Wunderlich nach außen hin so geben mochte. Daß es in seinem Innern vielfach anders aussah, daß diese anstekkende Lustigkeit, die er überall verbreitete, oft nur Fassade war, Selbstschutz, ließ er kaum einen merken. Außen und innen hatte er früh schon trennen gelernt. Vielleicht zu hart, unnachgiebig auch hier.
Ein einziges Mal habe ich Fritz Wunderlich gehört: Junifestwochen 1966, im Großen Saal der ehrwürdigen Zürcher Tonhalle, Gustav Mahler, Das Lied von der Erde. Hertha Töpper sang an der Seite Wunderlichs, Joseph Keilberth dirigierte. Bis auf wenige Randplätze in den vordersten drei, vier Parkettreihen war der Saal ausverkauft; ein kleines Glück für den jungen Gymnasiasten, der seit knapp zwei Monaten erst über einen Legitimationsausweis verfügte, welcher zum Bezug von preisgünstigen Studentenkarten an der Abendkasse berechtigte. Auf einem dieser Randplätze, Parkett links, saß ich also, hörte und sah ich Fritz Wunderlich. Unnötig zu betonen, daß die Erinnerung daran ziemlich verblaßt ist; und es wäre Eulenspiegelei, interpretatorische Details in Wunderlichs Gesang von damals heute noch einmal dingfest machen zu wollen. Haften geblieben ist nicht viel mehr als der Eindruck einer strahlkräftigen Stimme und eines sich mit kompromißloser Intensität verausgabenden Sängers. Noch sehe ich ihn, am Schluß seines ersten, heldischen Gesanges, mit vor Anstrengung hochrotem Kopf vor mir. Ein Sänger, der alles gibt, der alles gab. Auch an diesem Abend. Was ich nicht wissen, was überhaupt keiner ahnen konnte: daß es Wunderlichs letztes, Konzert überhaupt sein sollte.
Keineswegs möchte ich behaupten, daß Fritz Wunderlich der »größte«, Sänger sei, den ich je gehört habe – was immer das auch heißen mag. Ebensowenig vermöchte ich aus dieser einzigen Begegnung mit ihm irgendwelche Legitimation abzuleiten, seine Biographie zu schreiben – seinem Lebensweg nachzugehen von den letzten, großen Erfolgen in Wien, Berlin und Edinburgh zurück zum kräftezehrenden Opernalltag in München, zu den harten Lehrjahren in Stuttgart, zur entbehrungsreichen Studienzeit an der Freiburger Musikhochschule und letztlich zurück zu den Kinder- und Kriegsjahren im rheinpfälzischen Kusel.
Immerhin, in den Jahren seit diesem Lied von der Erde in der Zürcher Tonhalle hat sich zumindest ein wesentlicher Eindruck gefestigt – bestätigt im Hören und Wiederhören von Wunderlichs zahlreichen Schallplatten: daß der vielzitierte »Schleier der Interpretation«, der so häufig zwischen dem Hörer und der Musik hängt und also die Sicht auf das Wesentliche der Musik beeinträchtigt, bei Wunderlichs Gesangskunst fehlt. Sein Singen, seine künstlerische Botschaft, trifft direkt und unmittelbar, trifft tiefer und nachhaltiger. An diesem Eindruck hat sich für mich his auf den heutigen Tag nichts geändert.
Zürich, Juni 1990