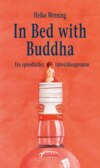Read the book: «Vom Wedding verweht»
Heiko Werning
Vom Wedding verweht
Menschliches, Allzumenschliches
FUEGO
Über dieses Buch
Der Wedding – Sehnsuchtsort für alle, die sich nach nichts mehr sehnen, Zuflucht für jeden, der vor sich selbst wegläuft, neue Heimat für jene, die sich vom Makler ernsthaft erzählen lassen, das hier sei Teil von Berlin-Mitte. Hier muss man den Erstklässlern als Erstes erklären, was »Fick dich!« eigentlich bedeutet und was Bienen sind, den Veganern, dass sie ruhig auch Wurst mit Fleisch essen können, solange es halal ist, und Zugezogenen, dass man hier am besten flirtet, indem man einer Taube den Kopf abschlägt.
Dazwischen betrinken sich Hipster am selbst gebrannten Nusslikör, betreiben Clickbaiting mit schimpfenden Ureinwohnern auf Youtube und hängen Zettel auf mit guten Vibes zum Abreißen. Kurz: Ein Stadtteil, der seit Jahrzehnten kommen soll, und doch einfach da bleibt, wo er schon immer war.
»Ohne diesen Westfalen wäre Berlin nichts! Heiko Werning schreibt wie Hemingway, nur witzig.« (Bernd Gieseking)
Leben und Sterben im Wedding
Der dominierende Fixpunkt an der Kreuzung See-/Ecke Müllerstraße ist das Saray-Restaurant, eine Dönerbude mit angeschlossenem türkischen Restaurant, ein beliebter Treffpunkt aller Bewohner des Viertels, gleich welchen Migrations-, Bildungs- oder sonstigen Hintergrundes. Auch die bediensteten Türkischstämmigen dort sind so dermaßen berlinerisch, dass man sich manchmal bei dem Gedanken ertappt, dass sie es mit der Integration ja nun eigentlich auch nicht gleich hätten übertreiben müssen. Als ich eines Nachts noch einen Döner zum Mitnehmen verlangte, stellte ich anschließend erschrocken fest, dass ich praktisch kein Geld mehr im Portmonee hatte. Mühsam klaubte ich die geforderten drei Euro fünfzig aus einer bunten Mischung kleinerer Münzen aller Art zusammen, sehr zum Missfallen des Dönerbereiters.
»Ey, ich bin doch keine Bank!«, wies er mich zurecht, als ich ihm die kleine Altmetallhalde über den Tresen schob, »ich meine, wenn du Döner bestellst, dann gebe ich dir doch auch einen ganzen Döner am Stück und schütte dir nicht einen Haufen Fleischschnipsel in die Hände!« Große Güte, dachte ich, es tut den Menschen einfach nicht gut, wenn sie zu lange in Deutschland leben. Das sieht man ja zuallererst an den Deutschen. Allerdings bin ich ja auch Deutscher und parierte den Anwurf des überassimilierten Migrationshintergründlers also mit dem versöhnlichen Angebot: »Na, wenn Sie unbedingt wollen, kann ich ihnen das Geld auch in eine labberige Brottasche klatschen.«
Woraufhin er tatsächlich kichern musste, bevor er fragte: »Knoblauchkräuterscharf?«, und dann noch anfügte: »Ey, musstu entschuldigen, aber heut Nacht waren hier wieder echt nur Verrückte. Vorhin haben’s hier welche draußen getrieben. Mitten in unserem Garten!« Mit »Garten« meinte er das Stückchen vom Bürgersteig, das das Saray mit großen Pflanzschalen voll hoher Büsche von der Straße abschirmt. Auf das Pflaster wurde Kunstrasen gelegt, auf dem ein paar Stühle und Tische stehen. Da kann man sich zum Essen raussetzen und dabei vom Lärm einer der meistbefahrenen Kreuzungen der Stadt beschallen lassen, was erstaunlich viele Kunden für ein attraktives Angebot halten. Ein lauschiges Plätzchen für ein Schäferstündchen allerdings schien mir das trotz des guten Sichtschutzes und der fehlenden Außenbeleuchtung nicht zu sein.
»Die sind bestimmt aus diesem Puff da oben gekommen«, schimpfte der Dönermann weiter. »Man geht aber doch nicht mit seiner Frau in den Puff«, gab ich zu bedenken und wunderte mich, wo hier bitte schön ein Puff sein sollte, mir war jedenfalls noch keiner aufgefallen. »Na ja, nicht so richtig Puff, musstu Frau schon selbst mitbringen in ’n Puff da. Ist voll angesagt, machen voll viele.«
Ich war erstaunt. »Wo denn?«, fragte ich. »Na, da im Nachbarhaus, wo die Penner immer sitzen. Da ganz oben drin. Über der Wohnung mit dem Weihnachtszeug!« In der Tat, ein Balkon war, jetzt im Mai, immer noch in voller Pracht weihnachtlich geschmückt. Mit einem großen Weihnachtsmann, der wütend vor sich hin blinkte, dazu zwei blau leuchtende Rentiere. »Ist doch ein bisschen spät für Weihnachtsschmuck«, bemerkte ich daher. »Ist bestimmt so ein Verrückter von der AfD«, schimpfte der Dönerwirt, »kämpft da fürs christliche Abendland und lässt den Weihnachtskram deshalb einfach immer weiter leuchten, gegen die Islamisierung. Macht der bestimmt extra, um uns zu ärgern, weil wir Türken sind.« »Aber ihr hängt doch Weihnachten auch immer alles mit Weihnachtsschmuck voll«, gab ich zu bedenken. »Ja, eben. Und jetzt will er’s uns zeigen. Dass er noch viel mehr christliches Abendland ist. Da lässt er das Zeug eben bis zum Sommer blinken.«
Später zu Hause googelte ich aus Neugier dann doch nach dem merkwürdigen Puff, und siehe da: Tatsächlich, in dem Haus ist ein Swingerclub. Und zwar, wie ich der Homepage entnehme, der einzige Swingerclub Berlins mit »Liebespool«, in dem man Sex haben darf, denn eine spezielle Wasserumwälz- und Filteranlage sorge dafür, dass »innerhalb von vier Minuten das gesamte Wasser rückstandslos keimfrei filtriert« wird und »keine unangenehmen Hinterlassenschaften im Wasser herumschwimmen«. Unangenehme Hinterlassenschaften im Wasser? Ich brauchte einen kurzen Moment, bis ich verstand: Wir haben also Berlins größte Sperma-Abschöpfanlage an unserer Kreuzung. Erstaunlich, dass mir diese Top-Sehenswürdigkeit bislang entgangen war.
Vielleicht liegt es daran, dass sich unten vor dem Haus eine Gruppe von Obdachlosen häuslich eingerichtet hat, um die ich immer einen kleinen Bogen mache. Einer der Eingänge in das hässliche Betonhaus scheint stillgelegt, in dem großen Türbogen haben sie ihre Schlafsäcke ausgerollt und halten dort beachtliche Trinkgelage ab. Genau gegenüber, auf der anderen Seite der Seestraße, hat am Urnenfriedhof eine Burger-Bude aufgemacht, so eine moderne Burgerbude, mit frischem Hackfleisch und erstaunlichen Burger-Varianten und vegetarischen Alternativen.
Was für ein Irrsinn, hatte ich erst gedacht, auf dieser toten Friedhofsecke ein Geschäft aufmachen zu wollen, aber ich habe mich geirrt. Längst schon boomt der »Rebel Room«, so heißt das Ding, und nur durch einen Zaun von den Urnengräbern getrennt sitzen die Hipster auf Bierbänken, lassen sich Hirsch-Burger mit Rotweinsauce und Rucola für acht Euro das Stück schmecken und schauen rüber zu den Sternburg verzehrenden Tippelbrüdern auf der anderen Straßenseite.
Als ich unlängst nachts am Saray vorbeilief, wurde ich fast von einem BMW mit OHV-Kennzeichen überfahren, der plötzlich mitten auf den Bürgersteig fuhr. Ein sehr aufgepumpt wirkender, etwa dreißigjähriger Muskelmann mit Bürstenfrisur sprang heraus, während seine Beifahrerin sitzen blieb und damit beschäftigt war, sich im Spiegel des Sonnenschutzes die Augenbrauen nachzuziehen. Der Bürstenkopf rief den Pennern zu: »Ey, hier soll irgendwo ein Swingerclub sein, habt ihr eine Ahnung, wo wir da hinmüssen?«
Ach, guck an, dachte ich. Die zwei Turteltäubchen wollen also in den Spermapool. Irgendwie sieht man die Menschen gleich mit ganz anderen Augen, wenn man über solche Informationen verfügt. Die Penner erwiesen sich aber zunächst mal als echte Deutsche, indem sie als Erstes auf die Straßenverkehrsordnung hinwiesen: »Hier kannste deine Kiste aber nicht stehen lassen!«, raunzte der eine. Der Bürstenkopf rollte mit den Augen und wollte schon zu einer Erwiderung ansetzen, als zwei junge, verschleierte Frauen vorbeikamen und freundlich riefen: »Der Swingerclub ist da im Nachbarhaus, oberster Stock.«
Ich war verblüfft. Wieso wissen die denn, wo hier Swingerclubs sind, dachte es ganz diskriminierend in mir. Dabei wohnen die vermutlich einfach nur hier, und da weiß man halt, was in der Nachbarschaft so abgeht. Der Typ jedenfalls wirkte nicht weiter überrascht und fragte nur sachlich zurück: »Da oben, über dem Balkon mit dem blinkenden Weihnachtszeug?« »Ja, genau«, antwortete eines der Kopftuchmädchen freundlich, »da vorne ist der Eingang, es gibt auch einen Aufzug direkt nach oben.« Dann fügte sie noch streng an: »Den Wagen können Sie hier aber nicht stehen lassen!«
Als ich kürzlich nachts wieder zum Saray kam, fiel mir sofort auf, dass der Weihnachtsschmuck nun doch entfernt worden war. »Na, hat er endlich aufgegeben?«, fragte ich den Dönermann, der sich freute, mich wiederzusehen. »In gewisser Weise wohl schon«, antwortete er, »ist gestorben.« »Oh«, sagte ich. »Ja«, sagte er, »schon im Dezember. Seither lag der da in seiner Wohnung und ist vergammelt. Hat keiner gemerkt.« »Oh«, sagte ich wieder. »Deswegen noch der Weihnachtsschmuck«, erklärte der Diensthabende weiter, dann hielt er einen Moment inne. »Voll krass, oder? Da liegt der da oben monatelang tot in seinem Bett, und jede Nacht blinkt dieser ganze Weihnachtskram wie ein Leuchtfeuer vor sich hin und jeder guckt da hoch und trotzdem merkt keiner was.« »Ja«, sagte ich, weil ich nicht wusste, was ich sonst sagen sollte. »Das ist doch krank«, sagte der Mann vom Saray, »voll krank. Wir sollten mehr aufeinander aufpassen. Wir sollten uns mehr füreinander interessieren. – Knoblauchkräuterscharf?« Noch ehe ich antworten konnte, sagte er: »Knoblauch. Stimmt’s? Du nimmst immer Knoblauch.« Ich nickte. Er lächelte zufrieden. Dann sagte er: »Willst du hier essen? Setz dich doch. Nimmst du ‘n Tee?« Er wird schon bald wieder normal werden, dachte ich.
Aber für heute nahm ich den Tee dankbar an, setzte mich in den kleinen Garten raus und schaute sinnierend auf die Hipster am Urnenfriedhof, die wiederum auf unsere Seite schauten, auf den Saray und das Haus daneben mit den Obdachlosen davor und dem Swingerclub oben drauf und der dunklen Wohnung darunter, auf deren Balkon nun kein Weihnachtsschmuck mehr blinkte und leuchtete.
Zettelwirtschaft
Die Kommunikation über ausgehängte Zettel hat bei uns im Haus eine lange Tradition. Am Tag meines Einzugs vor anderthalb Jahrzehnten hing ein DIN-A4-Blatt unten im Treppenhaus, auf dem in irritierend sauberer Schönschrift, so eine 14-jährige-Mädchen-Handschrift, zu lesen war: »An die Arschlöcher, die immer ihren Müll aus dem Fenster werfen: Wenn ich Euch erwische, schlage ich Euch die Fresse ein!!!« Orthographisch fehlerfrei, die Anrede regelgerecht mit Großbuchstaben am Wortanfang, das ganze Werk in dickem schwarzen Edding, in scharfem Kontrast dazu »Arschlöcher« und »Fresse« sowie die abschließenden drei Ausrufezeichen mit himmelblauem Filzstift gemalt – eine kleine, kunstvolle Kalligraphie. Was für eine Begrüßung im neuen Heim. So ging Weddinger Willkommenskultur im Jahr 1999.
Ein halbes Jahr später hatte ich dann auch das Problem mit dem Müll verstanden, nachdem ich mehrfach gebrauchte Kondome aus unseren Blumentöpfen gefischt hatte. Ich versuchte es mit einem eigenen Aushang. Weil ich eine schlechte Handschrift habe, wählte ich den Computer für folgende Ermahnung, Times New Roman in Fettdruck und 28 Punkt, in milder Ironie:
»Bewohner in den Stockwerken >1! Es ist erfreulich, dass Sie ein erfülltes Liebesleben pflegen. Es ist noch viel erfreulicher, dass gerade Sie dabei darauf achten, sich nicht zu vermehren, denn sonst sähe es bald in der ganzen Stadt aus wie auf einer Müllkippe. Aber auch zwei von Ihrer Sorte reichen für diesen Hof schon aus. Ficken Sie deshalb doch bitte zukünftig in die Tonne!«
Ich war ganz zufrieden. Die Aufschrift füllte das DIN-A4-Blatt exakt aus, fügte sich in das hiesige Idiom perfekt ein und war doch formvollendet, denn auch ich wählte die groß geschriebene Anrede ebenso gewissenhaft, wie ich auf das Wörtchen »bitte« Wert legte. Um mich in die Tradition der Schönschrift-Ermahnung zu stellen, setze ich ausgesuchte Wörter in Himmelblau ab, um meine Eigenständigkeit zu unterstreichen, wählte ich dafür aber die freundlichen aus, nämlich »erfülltes Liebesleben« sowie »bitte«.
Als ich am nächsten Morgen das Haus verließ, hatte jemand in krakeliger Handschrift dazugesetzt: »Und macht dabei mal das Fenster zu. Oder der Typ soll nicht immer bellen wie ein Hund, wenn er kommt. Das klingt völlig idiotisch.« Idiotisch grün unterstrichen. Ein Freigeist! Als ich abends zurückkehrte, waren zwei weitere Botschaften hinzugekommen: Zuerst ein durchaus gekonnt skizzierter nach oben zeigender Daumen. Und das Anfang des Jahres 2000, Jahre vor Facebook! War Mark Zuckerberg damals zu Besuch im Wedding? Ist ihm hier die Idee für sein soziales Netzwerk gekommen? Das könnte immerhin den Umgangston, der dort heute über weite Strecken herrscht, erklären. Denn die zweite Botschaft lautete: »Ihr seid doch nur neidisch, weil ihr alle nur wichst, ihr Wichser.« Das war zwar deutlich, fiel aber semantisch doch ein bisschen ab im direkten Vergleich.
Am nächsten Morgen fanden sich weitere Ergänzungen: »Selber Wichser!« und: »Du bist doch völlig unterfickt, du frigider Arsch.« Übers Wochenende war ich nicht da, als ich zurückkam, blickte ich staunend auf eine Schlacht von geradezu epischen Ausmaßen. Inzwischen war ein zweites Blatt unter meines gehängt worden, den analogen Diskussionsstrang rekonstruierte ich wie folgt:
»Das nächste Mal ruf ich die Polizei« »Für was denn? Fürs Ficken oder für die Beleidigungen hier?« »Klugscheißer« »Ich zeig Sie an! Wegen der Beleidigung!« »Denkt vielleicht mal jemand daran, dass hier auch Kinder wohnen?« »Die hätte man ja wohl verhüten können. Nehmen Sie sich ein Beispiel an den bellenden Fickern.« »Ich komm dir bald mal nach da oben!« »Ich wohne unten!« »Suche F, 40-50, entsorge meine Kondome auch immer fachgerecht in der Mülltonne.« »Aber bitte trennen! Das ist Bio und Plastik!« »Hat eigentlich jemand die Nummer von der Hausverwaltung?«
Wahrscheinlich hatte sie tatsächlich jemand, denn am nächsten Tag war das Handschriftenkonglomerat verschwunden und ersetzt gegen ein sehr amtlich aussehendes Schreiben mit dem Briefkopf der Verwaltung und der Aufforderung, zukünftig bitte auf Aushänge jeder Art zu verzichten. Was natürlich umgehend zu weiteren handschriftlichen Schimpf-Orgien der Bewohner führte. Immerhin, jetzt waren sich alle untereinander einig und richteten ihren Zorn gemeinsam gegen die Verwaltung. »Kümmert euch mal lieber um die kaputte Klingelanlage!«, »Im Keller sind Ratten!!!«, »Das Flurlicht im 3. OG ist kaputt«, usw. usf. Der Zettel hing noch ein paar Monate da, dann hatte sich die Lage wieder beruhigt.
In den Folgejahren gab es zwar immer wieder mal Aushänge verschiedenster Art, aber ganz schleichend hat sich über die Zeit offensichtlich die Mieterstruktur verändert. Die Ausdrucksweise wurde immer gesitteter, aber auch technischer, Schimpfwörter gerieten völlig aus der Mode, meist ging es nur noch um die ausgefallene Warmwasserversorgung oder kaputte Treppenhausbeleuchtungen, manchmal gab es auch die rituellen »Wir feiern und es könnte lauter werden«-Zettel, nichts Besonderes also.
Bis letzte Woche. Ich fühlte mich fast an meine Anfänge hier zurückversetzt. Denn jetzt hing ein DIN-A4-Blatt im Querformat von innen an der Haustür. In schönster Mädchen-Schreibschrift stand da ein Vierzeiler, für jede Zeile hatte die mutmaßliche Autorin eine eigene Farbe gewählt: »Liebe Nachbarn groß & klein, / darf es auch ein Hallo sein? / Und ein Lächeln noch dazu, / gute Laune haben wir im Nu!«
Gut, da war die Metrik im Abschluss etwas holprig, aber dafür waren »Hallo« und »Lächeln« unterschlängelt, »Nu!« unterstrichen, und daneben prangte ein großer Smiley. Das untere Viertel des Blattes war so zurechtgeschnitten, dass man sich Merk-Fransen abreißen konnte, wie bei den Suche-Wohnung- oder Gitarrenlehrer-bietet-Unterricht-Zetteln, wo immer die Telefonnummer drauf steht. Aber bei uns stand zum Abreißen und Mitnehmen Folgendes: »Love«, »Peace«, »Happiness«, »gute Laune«, »Ruhe«, »guten Schlaf«, ein Smiley, ein Herzchen, ein Friedenszeichen, »Glück«, »gute Noten«, »Gehaltserhöhung«, »neue Liebe«, »Urlaub«, »schöne Träume«, »Gelassenheit«, »gute Vibes«, »positive Ausstrahlung«. Kein Zweifel – wir hatten eine Wahnsinnige im Haus.
Robert aus dem zweiten Stock stand wie vom Donner gerührt vor dem Zettel, als ich hinzu kam. »Was soll das denn?«, fragte er mich fassungslos. Wir bestaunten das Dokument. Erst tippten wir auf eines der Mädchen aus dem Haus, aber das kaufmännische &-Zeichen ließ uns von der Theorie abrücken. So was kennen kleine Mädchen doch gar nicht. Es musste also ein Erwachsener dahin gehängt haben. Aber wer tut so etwas? Und warum? Robert murmelte etwas von »Gentrifzierung«, und dass es nun wohl langsam so weit sei.
Als ich nachts nach Hause kam, waren drei der Zettelchen tatsächlich bereits abgerissen. Hier also die Top-Three der Wünsche meiner Nachbarn: »Ruhe«, »Glück« und »neue Liebe«. Mein Sohn nahm am nächsten Morgen »gute Noten« mit, was immerhin saisonal als Wunsch durchaus angemessen erschien, denn die Halbjahreszeugnisse standen an. Als Nächstes verschwand »Gute Laune«, wie ich feststellte, als ich einkaufen ging. Wieder traf ich dabei auf Robert, der kopfschüttelnd vor dem Aushang stand und den Fortschritt mit seiner Handy-Kamera dokumentierte. »Gute Laune ist weg!«, flüsterte er entsetzt, »irgendjemand hier im Haus wünscht sich allen Ernstes gute Laune. Sie lassen Gehaltserhöhung hängen und nehmen gute Laune mit. Werning, das ist das Ende. Sie werden uns fertig machen!« Er war regelrecht aufgebracht. Ich empfahl ihm, »guten Schlaf« mitzunehmen, aber er zog kopfschüttelnd und fluchend davon. »Man fühlt sich langsam fremd im eigenen Haus«, schimpfte er noch, »die wollen uns zermürben!« Das schien mir etwas übertrieben.
Inzwischen aber bin ich mir nicht mehr so sicher. Erstens: Der Zettel klebt immer noch da, völlig unbeschädigt. Zweitens: Nur noch ein Abschnitt hängt daran, alle anderen haben ihre Abnehmer gefunden. Und drittens: Niemand, wirklich niemand hat handschriftlich etwas dazugeschrieben!
Der Zettel hat mein Bild von den Nachbarn erschüttert. Jeden, den ich treffe, mustere ich misstrauisch. Könnte das jemand sein, der sich nicht zu blöd war, »gute Vibes« mitzunehmen? Wer war es, der sich eine »positive Ausstrahlung« wünschte? Wer sehnte sich nach einer »neuen Liebe«?
Kurz habe ich überlegt, selbst etwas auf den Zettel zu schreiben. Irgendwas Nostalgisches, so in der Art: »Habt Ihr sie noch alle, Ihr Arschlöcher?« Aber ich atme tief durch. Die Zeiten ändern sich eben. Ich reiße den letzten Abschnitt ab. Darauf steht: »Gelassenheit.« Achselzuckend stecke ich ihn mir ins Portmonee.
Packstation
Die Post hat angekündigt, die Einrichtung sogenannter Packstationen in jedem Haus erwägen zu wollen. Deren Sinn soll sein, dass dort vom Paketboten Pakete für die Bewohner hinterlegt werden, die diese dann durch irgendeinen Automatismus ausgehändigt bekommen. Da kann ich nur müde lachen. Eine solche Packstation gibt es bei uns im Haus nämlich schon lange. Sie ist zufällig in unserer Wohnung untergebracht, und der Automatismus, der die Pakete an die Hausbewohner aushändigt, bin ich.
Die Paketboten steigen nämlich nicht so gerne Treppen. Erst recht nicht mit den oft ja auch sehr schweren Paketen. Da trifft es sich gut, dass ich im Erdgeschoss wohne. Und ich bin ja sowieso immer den ganzen Tag zu Hause. Diese beiden Vorzüge scheinen sich inzwischen zuverlässig herumgesprochen zu haben in der Paketzustellerszene.
Ich will aber nicht klagen. Ich treibe ja ohnehin keinen Sport, da sind die mehrmals am Tag klingelnden Paketboten und Nachbarn ein willkommener Anlass, mal vom Schreibtisch aufzustehen. Und man lernt auf diese Weise die anderen Hausbewohner kennen.
Die Menschen in der Seestraße 606 sind nämlich stark gesellschaftlich engagiert. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die lästigen Einzelhändler, die immer noch hartnäckig einige Ladenlokale hier im Wedding sinnlos besetzt halten, endlich loszuwerden. Deshalb bestellen sie eifrig bei Amazon, Zalando oder sogar Manufactum und treiben die immer noch ausharrenden Aktivisten der Occupy-Ladenlokal-Bewegung endgültig in den Ruin. Auf diese Weise sorgen sie für den dringend benötigten Platz für weitere Spielautomaten-Casinos, Shisha-Bars, Ein-Euro-Shops, Nagelstudios, Spätkaufs und Christenläden.
Was hat es nur mit den Christenläden bei uns in der Gegend auf sich? Jetzt hat schon wieder ein neuer aufgemacht. Nach der evangelischen Kirche bei uns gegenüber, dem Palmblatt-Café der Pfingstcharimastiker bei uns im Haus und dem Batik-Laden für »Stofffärben und Begegnungen mit Gott« quer gegenüber hängen nun im ehemaligen Katerstüberl die roten Aushänge mit der zunächst frohe Kunde versprechenden Aufschrift: »neue Bewirtschaftung«. Was mich zu einer hoffnungsvollen Inaugenscheinnahme verführte, denn mit dem Katerstüberl konnte ich nichts anfangen, und ein brauchbares neues Geschäft wäre in unserem Block dagegen durchaus mal wieder angezeigt. Aber dann diese Enttäuschung, als ich den weißen Zettel darunter las: »Abendmahl. Treffpunkt für christlichen Austausch und spirituelle Filmabende.« Was soll der Scheiß? Da faseln alle von der Islamisierung des Abendlandes, und die verdammten Moslems lassen sich ausgerechnet im Wedding reihenweise die Butter vom Brot nehmen? Hier und da ein Falafel-Laden, das kann doch nicht alles sein! Der Einzige, der ernsthaft gegenzuhalten scheint, ist der finstere Obst- und Gemüsehändler in der Togostraße, der eifrig Spendengelder für die Hamas sammelt und »Tod den zionistischen Imperialisten«-Flyer in die Obsttüten legt.
Wie dem auch sei, tagsüber nehme ich also die Pakete für den ganzen Häuserblock an, und ab dem späten Nachmittag kommen die Nachbarn vorbei, um sie wieder auszulösen. Letzte Woche stand der Mann von einem Zustelldienst wie üblich vor der Tür und fragte, ob ich ein Paket für die Künstlerin im vierten OG annehmen würde. Leicht erstaunt war ich, weil er augenscheinlich gar kein Paket dabei hatte. Aber na klar, natürlich nehme ich was an. »Fein«, sagte der Zustell-Mann, »dann hol ich das Päckchen mal eben.« Drei Minuten später rollte er mit einer Art Gabelstapler in den Innenhof, mit einer Euro-Palette und darauf einem zwei Meter hohen Trumm. Ich staunte nicht schlecht. Wir wuchteten das Teil in den Hausflur, wo es zwischenlagern musste, weil es gar nicht durch meine Tür passte. »Fein«, sagte der Zusteller wieder, »jetzt brauch ich nur noch die Euro-Palette zurück.« Ich sah ihn irritiert an. »Aber da ist doch dieses Monstrum drauf?« »Ja, aber hilft nichts, die Palette muss ich wieder mitnehmen. Das müssen Sie da bitte irgendwie runternehmen.« »Ich?« »Na, ist doch Ihr Päckchen!« Ich schnappte nach Luft. »Na gut, ich helfe«, beschwichtigte der Zusteller. Wir begutachteten das vollständig in dicke Folien umwickelte und dergestalt fest mit der Palette verbundene Irgendwas fachmännisch von allen Seiten.
»Ähm, ja«, gab ich mich geschlagen, »dann müssen wir es da wohl irgendwie losmachen. Haben Sie ein Messer?« »Nein«, sagte der Zusteller, »so was darf ich im Wedding nicht dabei haben.« Ich sah ihn verblüfft an und dachte erst, er macht einen Scherz. Da konnte ich noch nicht ahnen, dass einige Monate später DHL offiziell die Belieferung von Teilen des Weddings einstellen würde, wegen zu großer Überfallgefahr. »Im Ernst?«, fragte ich also ungläubig. »Ja«, sagte der Zusteller, »Weisung vom Chef. Keine Messer, keine Scheren, keine Waffen. Könnte bei einem Überfall gegen uns verwendet werden. In Treptow kann ich sogar ne Machete dabei haben, kein Problem. Aber nicht hier.« Immerhin, dachte ich. Der unheilvolle Hang zu irgendwelchen Bürgerwehren wäre damit ja schon mal wirkungsvoll im Ansatz erstickt. Also ging ich im Dienst der guten Sache zurück in die Wohnung und suchte nach einem scharfen Messer, um die Palette aus ihrem Plaste-Sarkophag zu befreien.
Immerhin, die Folien-Mumie war mal eine Abwechslung zu den ewigen Amazon-Paketen. Amazon, Amazon, Amazon, immer wieder Amazon. Egal, wie mies die ihre Angestellten behandeln, egal, wie sehr die den gesamten Kulturmarkt austrocknen mit ihrem Monopolisten-Gebaren, egal, ob die Buchhändler um die Ecke verrecken – die Leute kaufen wie blöd bei Amazon. Kein Wunder, dass die inzwischen über eigene Zustelllösungen nachdenken und deswegen jetzt schon damit experimentieren, ihre Päckchen demnächst durch Drohnen ausliefern zu lassen. Da bin ich ja schon mal gespannt, wie das dann wird, wenn die Dinger hier dauernd im Innenhof landen. Und die sind im Unterschied zu den Zustellern auch garantiert bewaffnet. Schon weil das da vermutlich serienmäßig eingebaut ist. Angesichts der Drohnenbegeisterung bei Militär und Terrorabwehr dürfte es bald im Luftraum ziemlich eng werden. Wobei es natürlich auch schöne Synergie-Effekte geben könnte. Da kann dann so eine patente Mehrzweckdrohne erst die nächste anstehende Exekution eines islamistischen Extremisten, sagen wir, meines Obst- und Gemüsehändlers in der Togostraße, erledigen, und dann anschließend noch ein paar Amazon-Pakete hier im Block ausliefern. Wenn es da mal nicht zu Missverständnissen kommt und am Ende die Amazon-Kunden abgeknallt werden. Obwohl: Vielleicht wäre das realistisch betrachtet der einzige Weg, den Drecksladen doch noch wieder loszuwerden. Mit klassischen Argumenten sind die Leute ja nicht davon abzuhalten, dort zu bestellen, da muss man vielleicht mal etwas handfester werden.
Es klingelte. Die Künstlerin stand vor der Tür und wedelte mit ihrem Paketschein vor meinem Gesicht herum. »Hier wurde ein Päckchen für mich abgegeben?« »Allerdings!«, sagte ich und zeigte anklagend auf das kleiderschrankartige Teil im Hausflur. »Oh«, sagte die Künstlerin, »und ich hatte mich schon gewundert, was das ist. Aber ich habe doch gar nichts Großes bestellt?« Hatte sie aber doch, wie sich herausstellte. In dem Schrankteil waren so eine Art Käseglocken, die brauchte sie für ihre Kunst. Und damit die Dinger nicht beschädigt werden, hat der Absender sie, nun ja, sehr sicher verpackt. Mit Kubikmetern voller Schaumstoffschnipsel drumherum, die nun knöcheltief den ganzen Hausflur bedeckten. Ich half ihr noch kurz, die Glasglocken nach oben zu tragen.
Als ich wieder zurück nach unten kam, klebte an meiner Tür ein Zettel von DHL. Mein Paket sei angekommen, verkündete der Text darauf fröhlich, aber leider habe man mich nicht zu Hause angetroffen. Verdammt.
Am nächsten Tag ging ich zu der angegebenen Adresse, um mein Päckchen abzuholen. Na, mal sehen, wer außer mir hier in der Gegend noch so als Packstation herhalten muss, dachte ich. Es war, wie ich bald darauf feststellte, die Buchhandlung um die Ecke. Die Buchhändlerin warf mir einen eisigen Blick zu, als sie mir mein Päckchen aushändigte. Ich schluckte. Meine Amazon-Bestellung war angekommen.