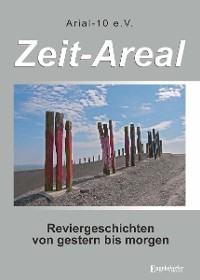Read the book: «Zeit-Areal»
Arial-10 e.V.
Zeit-Areal
Reviergeschichten von gestern bis morgen
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2014

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2014) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte bei den Autorinnen und Autoren
Fotos © Uwe Dachert
Illustrationen © Sarah Sandfort
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
Inhaltsverzeichnis:
Cover
Titel
Impressum
Grußwort des Oberbürgermeisters
270.000 v. Chr. Neandertaler Oog Ungur entzündet zum ersten Mal Kohle
J.M.
1914 Tod eines Försters
Kurt Guske
1944 Frühlingssonne
Eva-Maria van Gessel
1950 Tage des Lichts
Corinna Ziegler
1957 Leuchtzeichen
Bettina Döblitz
1966 Ein glorreicher Herbstanfang
Bettina Döblitz
1968 Hundert Jahre Marienhospital
J.M.
1968 Ruhroel oder war ich ein Held
Kurt Guske
1978 Der Schal
Ulrike Geffert
1999 Jahrtausendwunder
Ulrike Geffert
2000 Ohne Telefon isses ruhig
Jan Langer
2001 Der Traum vom Fliegen
Bettina Döblitz
2005 Veränderung
J.M.
2007 Alles im Dreieck
Eva-Maria van Gessel
2010 Die Halde
Kurt Guske
2012 Energieausbeute
Eva-Maria van Gessel
2014 Bottropie
J.M.
2100 Extraschicht 2100
Jan Langer
Das Bottrop-Gedicht
Kurt Guske
Autorenporträts
Endnoten
Grußwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
das vorliegende Buch enthält ein breit gefächertes Spektrum an ernsten und heiteren Geschichten, sowie humorvollen und einfühlsamen Gedichten.
Handlungen und Ereignisse in und um unsere Stadt herum wurden von den Mitgliedern der Autorengruppe „Arial 10“ aufgegriffen und verarbeitet. Sie bilden den zentralen Bestandteil dieser unterhaltsamen Anthologie, bei der es immer um Menschen und deren Beziehungen geht.
Die Texte der engagierten Autoren sind dabei nicht unter strengen literarischen Bewertungsaspekten entstanden. Vielmehr bildeten persönliche Beobachtungen und Erinnerungen die Grundlage für das Werk. Aber auch von Erzählungen und Erfahrungen Ihrer Vorfahren haben sich die Verfasser inspirieren lassen.
Entstanden ist eine bunte Mischung von Reviergeschichten, die auch einen kleinen Eindruck vom Wandel in unserer Region vermitteln.
Ich wünsche Ihnen viel Freude und gute Unterhaltung beim Lesen.

270.000 v. Chr.
Neandertaler Oog Ungur entzündet zum ersten Mal Kohle
J.M.
Oben auf dem Hügel, es fängt gerade an zur Nacht zu dämmern, neben dem Baum dort, sitzt der Neandertaler Oog Ungur und schaut mit menschlicher Neugier auf das glühende schwarze Ding, das seit heute Morgen nicht erloschen war.
Schon einmal gefragt, wie es wohl wäre, wenn man eine Steinzeit-Dokumentation über die Erfindung des Rades im Fernsehen sieht und tatsächlich den Namen dessen gesagt bekommt, der es erfunden hat? Anstatt dass diese Ereignisse immer so anonym verlaufen und wir so distanziert gegenüber unserer Vergangenheit als Mensch dastehen. So etwas Persönliches, Nachgewiesenes, denn auf Tatsachen Beruhendes wie:
Dies ist eine nachgestellte Szene. Der exzentrische Erfinder Jürgen Molle aus der Steinzeit, seines Zeichens Mittelpaläolithiker, und leider bereits von uns geschiedenes Jahrhundertgenie, erfindet gerade den Speer. Wir schreiben das 4te Jahrhundert des 271ten Jahrtausends vor Christus. Er befestigt einen spitzen Stein an einem langen Stock, um sich am Rücken zu kratzen, da es keiner für ihn übernehmen möchte. Denn seine emanzipierte Frau, Katharina Molle-Krüger, SteinzeitmenschIN, hatte es satt mit seinen Wutanfällen und ist mit den gemeinsamen Kindern zu ihrer Mutter gezogen. Diesen Vorgang bezeugen seine wie immer detaillierten und minutiösen, manchmal leider sehr stark abschweifenden Tage-Bruch-Aufzeichnungen.
Na, so würden wir doch dem Steinzeitalter ganz anders gegenüber stehen. Nun, so ähnlich hätten wir auch vom ersten Kohle-Entdecker Oog Ungur erfahren können. Bloß dass dieser, oben auf dem Hügel sitzend und wissenschaftliche Anstrengungen unternehmend, von einem geworfenen Speer eines Homo Sapiens tödlich getroffen wurde, nachdem er von weiter Ferne zuerst einen Ehestreit gehört hatte. Glück im Unglück mussten seine Hinterbliebenen sich wenigstens nicht mit Patentdiebstahl herumplagen. Denn Jürgen Molle fing es an stark am Rücken zu jucken und deshalb ging er seinen Speer zurückholen. Diesen hatte er vor Wut und blind irgendwohin geworfen, weil seine Frau wieder einmal nach einem Streit abgehauen war. Er erkannte am toten Oog Ungur, dass so ein Speer ziemlich gefährlich sein konnte. Die Tatwaffe nahm er zwar mit, bevor er, nervös und voller Angst gesehen und erwischt worden zu sein, abhaute. Aber die brennende Kohle interessierte ihn kein bisschen. Scheiß Jürgen Molle.
1914
Tod eines Försters
Kurt Guske
Wir haben den 30. Mai 1914. Es ist der Samstag vor dem Pfingstsonntag. Nach einem aufregenden Tag mit seinen 8 Kindern freute sich der königlich preußische Revierförster Paul Töfflinger schon auf den Abend. Heute war er mit dem Direktor von Thyssen, Herrn Becker, verabredet. In seinem Revier gab es einen kapitalen Rehbock, den er Herrn Becker versprochen hatte. Sein gutes Verhältnis mit Herrn Becker bestand aus der beidseitigen Liebe zur Natur. Treffpunkt war die Forststraße in der Nähe der Hohen Heide.
„Guten Abend, Herr Direktor.“
„Guten Abend, Herr Töfflinger.“
„Na, was haben Sie denn Schönes für mich ausgesucht?“
„Einen richtig kapitalen Rehbock, Herr Direktor.“
„Das freut mich aber sehr und wie geht es Ihrer Familie?“
„Danke der Nachfrage Herr Direktor, die Kinder machen schon viel Arbeit, aber sie sind ja von Gott gewollt, und meine Frau bekommt das schon hin.“
„Wunderbar, bestellen Sie ihrer Frau Gemahlin einen schönen Gruß von mir.“
„Vielen Dank, Herr Direktor.“
„Gut dann werde ich mich mal auf den Weg machen.“
„Waidmannsheil, Herr Direktor.“
„Waidmannsdank, Herr Töfflinger.“
Dann trennten sich die beiden Männer, Herr Becker machte sich auf den Weg zum Hochsitz und Revierförster Töfflinger auf den Weg durchs Revier. In der letzten Zeit hatten sich wieder einige Wilddiebe bemerkbar gemacht und Töfflinger legte es darauf an, sie endlich zu erwischen. Leise und höchst aufmerksam ging er durch das Revier Burenbrock.
Derweil machte sich aus Bottrop das Unheil auf den Weg. Es war die Zeit kurz vor dem ersten Weltenbrand, was zu dieser Zeit jedoch noch niemand ahnen konnte. Wer konnte schon voraussehen, dass am 28.6.1914 der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gemahlin durch südslawische Nationalisten erschossen würden, woraufhin Österreich den Serben den Krieg erklärte. Der deutsche Kaiser Wilhelm der Zweite erklärte am 1.8.1914 Russland und am 3.8. Frankreich den Krieg. Das große Morden nahm seinen Anfang.
Doch zurück zu zwei Männern aus Bottrop. Es waren die Wilderer Brüggeman und Fahnenbrock. Auch sie trafen sich an diesem 30. Mai. Sie hatten ebenfalls von dem Rehbock gehört und wollten Jagd auf ihn machen. Sie schlichen durch Vöingholz in Richtung Hohe Heide.
„Wir müssen vorsichtig sein“, sagte Brüggemann, „bestimmt ist der Revierförster auch unterwegs.“
„Das schon, aber er kann ja nicht überall sein!“, meinte Fahnenbrock.
Leise schlichen die beiden weiter durch den Wald. Töfflinger aber, der sich äußerst geschickt und fast geräuschlos durch den Wald bewegte, hörte bald verdächtiges Knacken im Unterholz. Sofort blieb er schon stehen und wartete in der Deckung einer großen Eiche. Sein Puls ging in die Höhe, als er zwei Männer mit Gewehren auf sich zu kommen sah. Als sie nah genug waren, sprang er aus der Deckung und rief: „Stopp, die Gewehre runter.“
Der Wilderer Fahnenbrock war ihm bekannt und befolgte seine Anordnung. Brüggemann aber verschwand im Gesträuch. Der Förster nahm Fahnenbrock fest.
„Habe ich dich endlich“, sagte er zu ihm, „und den anderen bekomme ich auch noch. Den Brüggemann habe ich erkannt.“ Fahnenbrock sagte kein Wort.
Während Töfflinger ihn band, fiel plötzlich ein Schuss. Paul Töfflinger verspürte einen heftigen Schlag in den Rücken und dann kam die große Dunkelheit.
Paul Töfflinger war tot.
Ein beliebter Revierförster und Vater von 8 Kindern heimtückisch in den Rücken geschossen.
Unfassbar!
Brüggemann sprang aus dem Gebüsch und band Fahnenbrock los. „Komm, lass uns schnell abhauen, den Schuss könnte jemand gehört haben.“ Fahnenbrock sagte: „Wir schmeißen ihn in den Graben, dann wird er nicht sofort gesehen.“
Während sie das taten, hörten sie eine laute Stimme.
„Was macht ihr denn da?“
Erschrocken ließen die beiden den Förster liegen und rannten davon. Der junge Mann war ein Sohn des Bauern Riesener. Er sah sofort, was geschehen war, und lief zum Hause Weiß, das in der Nähe lag, und holte Hilfe.
Schnell rannten Theo Weiß, ein guter Freund des Toten und von Riesener, zum Ort des Geschehens. Als Theo sah, was geschehen war, liefen Tränen aus seinen Augen.
„Oh Gott die arme Frau Töfflinger, und sie ist auch noch hoch schwanger.“
Dann brachten sie den toten Förster in das Haus von Theo. Die schwerste Aufgabe stand ihnen noch bevor. Sie mussten Frau Töfflinger die Nachricht vom Tod ihres Mannes beibringen. Theo und Frau Töfflinger hielten sich fest und weinten gemeinsam. 10 Tage nach des Försters Tod gebar Frau Töfflinger ihr neuntes Kind und nannte es Pauline.
Der junge Riesener hatte die beiden erkannt und schon am nächsten Tag wurde Brüggemann verhaftet. Fahnenbrock aber konnte entkommen und hatte sich nach England abgesetzt. Aber Brüggemann kam mit seiner Schuld nicht zurecht. Schon wenige Stunden nach seiner Einlieferung ins Bottroper Gerichtsgefängnis hatte er sich das Leben genommen. Auch Fahnenbrock konnte in England verhaftet werden, doch bevor er ausgeliefert werden sollte, brach der erste Weltkrieg aus. Er verblieb in England in einem Internierungslager.
Der Revierförster aber bekam eine Beerdigung, wie sie Kirchhellen und Grafenwald noch nie erlebt hatten. Alle Honoratioren der beiden Orte und auch die Familie Thyssen sowie ein großer Teil der Bevölkerung waren da. Herrn Töfflinger wurde auf dem Grab ein kleines Denkmal gesetzt.
Seine Frau ließ auf diesen Stein folgenden Spruch einmeißeln: „Du warst die Liebe auf Erden und Deine Liebe war unser Glück.“ Es war für alle ergreifend und viele Tränen wurden an diesem Grab vergossen. Aber trotz aller Trauer musste das Leben für Frau Töfflinger weitergehen.
Acht Kinder und ein Baby wollten versorgt werden. Und dann war da ja noch der kleine Hof, den sie mit ihrem Mann bewirtschaftet hatte. Ja es war eine schwere Zeit für eine mutige und tapfere Frau.
Sie kümmerte sich weiterhin um die zum Forsthaus gehörenden Wiesen und Äcker. Mit Pferd und Wagen fuhr sie mehrmals nach Bottrop, um auf dem Markt Obst, Eier, Butter und selbstgebackenes Brot zu verkaufen. Und auf etwas konnte sie besonders stolz sein. All ihren Kindern ermöglichte sie den Besuch des Gymnasiums, dabei stellte sie ihre eigenen Wünsche hintenan. Als die meisten ihrer Kinder erwachsen waren und das Elternhaus verließen, wurde das Forsthaus zu groß für sie. Sie verließ das Forsthaus und zog auf einen kleinen Kotten der Familie Thyssen. Aber richtig wohl fühlte sie sich hier nicht. Anfang der dreißiger Jahre verließ sie Grafenwald und zog zu ihren Kindern nach Darmstadt, die zum Teil hier sesshaft geworden waren.
Sie kümmerte sich, bis sie 90 Jahre alt war, um den Haushalt ihrer Tochter Doris. Sie starb 1966 im Alter von 93 Jahren. Den Kontakt mit Kirchhellen pflegte sie aber weiterhin. Den engsten Kontakt hatte sie mit der Familie von Rektor Heinrich Schulte Strathaus. Dieser war ein besonders enger Freund ihres Mannes gewesen. Nach seinem Tod hat diese Familie ihr sehr beigestanden.
Noch ein paar Worte zu den Kindern. Gerhard war zunächst Forstamtmann in Hessen und wurde noch Leiter des Forstamtes Zierenberg. Später zog er dann nach Kassel. Sohn Willi war Assistent an der TH in Darmstadt und meldete sich zu ihrem Kummer als Freiwilliger zur Wehrmacht. Er fiel in Stalingrad. Erich wurde technischer Angestellter bei der Firma Henschel und blieb dort bis zum Renteneintritt. Tochter Martha heiratete einen Forstmeister, der dann aber in Italien gefallen ist. Doris heiratete den Eigentümer eines bekannten Ausfluglokals und führte nach seinem Tod dieses weiter. Gertrud war als Lehrerin in Gelsenkirchen-Buer tätig und zog nach ihrer Pensionierung ebenfalls nach Darmstadt. Hedwig blieb unverheiratet und arbeitete über 30 Jahre bei ihrer Schwester Doris im Hotel. Bleibt noch die jüngste, Pauline. Sie heiratete einen Diplom-Ingenieur, welcher 1944 ebenfalls gefallen ist.

Aber was wurde aus Fahnenbrock? Er blieb ja bis 1919 in England interniert und wurde dann nach Deutschland entlassen. Hier wurde er sofort verhaftet und in das Gladbecker Gerichtsgefängnis eingesperrt. Schon bald wurde ihm der Prozess gemacht und zum Unwillen der Bevölkerung freigesprochen. In dem Prozess schob er alles auf seinen ehemaligen Kumpanen Brüggemann und niemand konnte ihm das Gegenteil beweisen. Freispruch aus Mangel an Beweisen. Lachend und als freier Mann verließ er den Gladbecker Gerichtssaal. Aber irgendwie konnte er seine Freiheit nicht lange genießen. Es war die Zeit der Spartakisten, welche für große Unruhen sorgten, und während eines solchen Aufstandes wurde Fahnenbrock tot an einer Mauer der GHH in Oberhausen aufgefunden.
Er war erschossen worden. Seine Mörder konnten nie ermittelt werden.
2014 ist es dann 100 Jahre her, dass der beliebte Förster Paul Töfflinger im Wald der Hohen Heide erschossen wurde.
Den Weg, an dem er ermordet wurde, nennt man ihm zu Ehren „Töfflinger Weg“.
Quellennachweise: Zeitungsartikel der Ruhrnachrichten, Verfasser Theo Täpper, 1975
Friedhelm Wessel: „Geschichten aus Kirchhellen“
1944
Frühlingssonne
Eva-Maria van Gessel
Nach der Landung der West-Alliierten in der Normandie im Juni 1944 begannen sie ihre Invasion in Richtung Reichsgebiet.
Meine Großeltern, die „van Gehsels“, wohnten zu der Zeit mit ihrer Tochter Anneliese und ihrem Sohn Wilhelm in einer Werkswohnung der Rheinischen Stahlwerke, Aegidistraße 23. Schräg gegenüber befand sich die Bäckerei Scheuer. Dort war Wilhelm, gerade sechzehn Jahre alt, noch in der Lehre.
Am 10. Januar musste er zur Notgesellenprüfung, weil er am 13. Januar 1945 nach Sülbeck bei Stadthagen zum Militärdienst eingezogen wurde.
Anfang Februar war er dienstlich im Zug nach Münster unterwegs, nutzte die Gelegenheit und machte einen Abstecher nach Bottrop. Er wollte seine Familie noch einmal besuchen, denn er fürchtete, sie sonst nie mehr wieder zu sehen.
Das „unerlaubte Entfernen von der Truppe“ fiel jedoch auf und Wilhelm wurde zu einer Woche verschärften Arrest verurteilt. Er saß dann vom 15. Februar bis zum 22. Februar in einer Einzelzelle bei der Tagesration von einem Kanten Brot und Wasser in Hameln Obernkirchen ein.
Am 12. März wurde er aus der vormilitärischen Ausbildung entlassen, um später wieder bei der Wehrmacht eingesetzt zu werden.
Die deutschen Truppen mussten zu dem Zeitpunkt bei Wesel nun auch ihren letzten linksrheinischen Brückenkopf aufgeben. Britische, kanadische und US-Luftlande- und Bodentruppen überschritten dann im Raum Wesel-Dinslaken auf breiter Front den Rhein. So geriet auch Bottrop unter Artilleriebeschuss.
Am 24. März 1945 (Wilhelm war wieder im ehemaligen Lehrbetrieb tätig) sollte Stuten gebacken werden. Wilhelm schickte Heinz, den Sohn des Bäckermeisters, los, um die noch fehlende Margarine für den Stutenteig zu besorgen. Heinz stieg aufs klapprige Fahrrad und fuhr bei herrlich sonnigem Wetter los. Er dachte noch: „So ein schöner Frühlingstag!“
Plötzlich kam das Dröhnen eines Aufklärers näher und das Flugzeug überflog den Ortsteil Boy. Als Heinz in Höhe der Hühnerfarm Wittstamm war, hörte er ein Heulen, dann schlug eine Granate in deren Nahbereich ein und er stürzte vor Schreck mit seinem Fahrrad um. An die Margarine dachte er nun nicht mehr, sondern fuhr so schnell er konnte zur Backstube zurück.
Dort waren inzwischen die von diesem Überraschungsangriff aufgeregten und verstörten Anwohner aus den umliegenden Häusern in den Innenhof der Bäckerei gelaufen, ebenso auch Wilhelms Mutter, die natürlich nach ihrem Sohn sehen wollte.
Als um 9.13 Uhr das Hinterhofgebäude getroffen wurde, befand sich das Hausmädchen Mathilde auf der Kellertreppe aus Sandstein und wurde schwer verletzt. Wilhelm und Heinz suchten schnell Schutz hinter den gestapelten Mehlsäcken in der Backstube. Lautes Aufschreien und das Heulen der Granaten war zu hören und die beiden zuckten zusammen, als wieder eine in direkter Nähe einschlug.
Kurz danach stürmte Herr Eisenkopf, ein Mieter aus dem Hinterhaus, herein und rief: „Willi, Willi, komm schnell! Deine Mutter!“
Wilhelm, panisch vor Angst, rannte zu ihr und stolperte über Körperteile. Aus den Augenwinkeln heraus registrierte er den abgerissenen Arm des Fräulein Salomon, sowie das Bein von Frau Pawlinski, das er an ihrer zuvor getragenen Sandale erkannte, die noch an den Fuß geschnallt war.
Wilhelm entdeckte seine Mutter Anna in einer Blutlache – sie lag schwerstverletzt von Granatsplittern getroffen im Hof. Der rechte Oberschenkel war zerfetzt, der andere lag verdreht neben ihr. Wilhelm und Heinz sahen schockiert, wie ihr das Blut pulsierend und schnell aus dem Rumpf floss. Die Mutter war nicht mehr ansprechbar. Wilhelm schrie verzweifelt: „Mutter, verlasse mich nicht!“ Es gab aber keine Möglichkeit ihr noch zu helfen – sie verblutete an Ort und Stelle.
Wilhelm zog zitternd seine Bäckerschürze aus, breitete sie über seine Mutter aus, saß lange noch weinend und regungslos da.
Eine weitere Granate schlug in unmittelbarer Nähe des Hauses, Aegidistraße 5 / Ecke Blankenstraße, ein und Willi Schnitzler kam dabei ebenfalls ums Leben.
Der Pfarr-Rektor Anton Vohs war gerade in der Nähe, eilte herbei und spendete den Opfern die letzte Ölung.
Die wärmende Frühlingssonne vermochte nun niemanden mehr zu erreichen.
Am Nachmittag, gegen drei Uhr, heulten die Sirenen und Wilhelm, Heinz und die anderen Überlebenden vom Vormittag rannten verzweifelt zum Schutzbunker an der Kreuzung Aegidistraße / Ecke Tannenstraße.

So wollte auch der Pfarr-Rektor Anton Vohs sich in Sicherheit bringen, zuvor hatte er noch am Pfarrhaus den Drahtfunk abhören können: „Achtung, Achtung, feindlicher Fliegerverband!“
Doch zeitgleich wurde der Kirchturm von St. Peter mit einem Volltreffer zerstört. Anton Vohs sprang reflexartig in den Kellerabgang des Pfarrhauses – auch er wurde, wie noch weitere Menschen, bei diesem letzten Angriff auf die Ortsteile Boy und Batenbrock getötet.
Die nachfolgenden Tage verbrachten Wilhelm, Heinz und ihre überlebenden Angehörigen überwiegend in ihren Kellern, weil die Alliierten Streitkräfte immer näher kamen und den Artilleriebeschuss ostwärts fortsetzten. Man hörte, wie die Granaten über Bottrop hinweg in Richtung Gelsenkirchen gelenkt wurden. Niemand wusste, was noch geschehen würde. Wilhelm und seine Schwester Anneliese beobachteten durch die Kellerfenster, wie die inzwischen von vielen Bürgern gefürchteten Nazis Kontrollfahrten durchführten und nachschauten, wo eventuell schon weiße Laken hingen – das war eine sehr gefährliche Situation. Die Parteigetreuen trugen goldgelbe Uniformen und wurden spöttisch „Goldfasane“ genannt.
Am 29. März liefen einzelne Wehrmachtssoldaten die Straße entlang (die Truppe hatte sich wohl aufgelöst) – da wussten die Anwohner, dass sie nicht mehr lange in ihren Kellern ausharren müssen.
Am Karfreitag, den 30. März, hörte man von weitem so etwas wie Kettengerassel und ein Dröhnen. Die „Goldfasane“ waren nun nicht mehr zu sehen. Frau Klinger, die direkte Nachbarin der „van Gehsels“ kam aufgeregt herüber: „Hört ihr das auch? Das sind bestimmt die Alliierten. Nun sind wir doch vogelfrei!“, schrie sie verängstigt. „Wir haben so viel Schreckliches erleben müssen, werden wir nun auch noch erschossen?“
Das donnernde Geräusch kam immer näher und die Anwohner hängten schnell weiße Tücher heraus.
Die Amis waren inzwischen mit ihren Panzern von Kirchhellen durch den Ortsteil Eigen gefahren und kamen nun auch die Aegidistraße entlang.
Wilhelm und Heinz waren (wie viele andere auch) vom Geschehen traumatisiert, aber für den Rest des Lebens befreundet.
The free sample has ended.