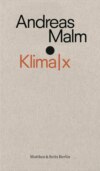Volume 241 page
About the book
Die wissenschaftlichen Fakten bezüglich der Klimakrise, die Daten, die das Massenaussterben und die Erderwärmung beziffern, liegen auf dem Tisch, an dem führende Politikerinnen und Politiker regelmäßig zusammenkommen, um Klimaziele zu vereinbaren. Auf den Straßen vor den Tagungshotels und Regierungspalästen protestieren nicht erst seit gestern immer mehr Menschen. Sie starten Petitionskampagnen und sammeln Unterschriften. Trotzdem haben wir es mit einer nach wie vor boomenden Industrie für fossile Brennstoffe zu tun, die Gewinne steigen kontinuierlich. Ist es also an der Zeit, das kaputt zu machen, was uns kaputt machen wird? In diesem mitreißenden Manifest fordert Andreas Malm nichts weniger als die Eskalation: Wir müssen die Förderung fossiler Brennstoffe zum Stillstand bringen – mit unserem Handeln, unseren Körpern, mit allem, was uns zur Verfügung steht. In seiner historisch fundierten Lesart der Geschichte erfolgreicher sozialer Bewegungen – für das Frauenwahlrecht, gegen die Apartheid – zeigt Andreas Malm, dass jeder dieser Kämpfe Grenzen überschritten hat: Eigentum wurde zerstört, Infrastruktur angegriffen. Nur so konnte der notwendige Druck aufgebaut werden, um Veränderung voranzutreiben. Mit der Leidenschaft eines Aktivisten und dem Wissen eines Forschers diskutiert Andreas Malm das Spannungsfeld zwischen Gewaltfreiheit und direkter Aktion, Strategie und Taktik, Demokratie und sozialer Veränderung. Und zeigt uns, wie wir in einer Welt kämpfen können, die längst in Flammen steht.