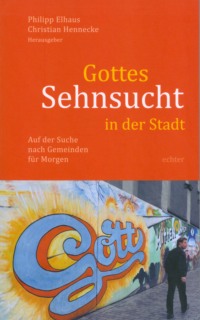Read the book: «Gottes Sehnsucht in der Stadt»
Philipp Elhaus
Christian Hennecke
Herausgeber
Gottes
Sehnsucht
in der Stadt
Auf der Suche
nach Gemeinden
für Morgen
Philipp Elhaus
Christian Hennecke
Herausgeber
Gottes
Sehnsucht
in der Stadt
Auf der Suche
nach Gemeinden
für Morgen

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.d-nb.de› abrufbar.
© 2011 Echter Verlag GmbH, Würzburg
www.echter-verlag.de Umschlag: Peter Hellmund Umschlagbild: KNA-Bild, Bonn Satz: Hain-Team, Bad Zwischenahn (www.hain-team.de) Druck und Bindung: CPI books GmbH ISBN 978-3-429-03440-5 (Print) ISBN 978-3-429-04618-7 (PDF) ISBN 978-3-429-06016-9 (Epub)
Inhalt
Vorwort
I.
Fresh expressions: Die ökumenische Frage nach einer neueren Kirchengestalt
Philipp Elhaus – Christian Hennecke: Gottes Sehnsucht in der Stadt. Auf der ökumenischen Suche nach Gemeinden für morgen
Michael Herbst: Dem „Englischen Patienten“ geht es besser. Was können wir von der Anglikanischen Kirche lernen?
II.
Eine weltkirchliche Lerngemeinschaft: Deutschland – England
Dirk Stelter: Die anglikanische Kirche Reformatorisch und katholisch zugleich
John Finney: Fresh Expressions. Anglikanische Antworten in postmodernen Kirchensituationen
Philipp Elhaus: Ich bin ganz viele. Eine evangelische Perspektive zur Zukunft der Gemeinde
Gerhard Wegner: Potentiale provozieren. Über die Selbstwirksamkeit des Glaubens und seine Verkleisterung
Volker Roschke: Fresh expressions of church. Ein neues Betriebssystem für eine Kirche von morgen
Medard Kehl: „Mach ein leichtes Zelt daraus“ – zur Architektur der Kirche von morgen
Matthias Sellmann: „Der Stadtaffe muss die Stadt im Blut haben“. Selbstbilder der Citypastoral in pastoraltheologischer Perspektive
III.
Aufbrechende Kirchenlandschaften: ein neuer Blick auf eine Kirche, die im Kommen ist
Christian Hennecke: Mind the gap. Ein Erfahrungsbericht
Volker Roschke: Kirche zukunftsfähig aufstellen. Erfahrungen mit church planting in Deutschland
Christina Brudereck: Gottes Sehnen in der Stadt
Matthias Paul: Wo kommen wir denn dahin? Nach London
Annette Reus: Kirche mit „Beginnern“. Oder: „Gemeinde auf Zeit“ mit jenen, die als Einsteiger oder nur sporadisch mit Kirche zu tun haben
Christian Schröder: „Meine Kirche ist Open Source“
G. Burkhard Wagner: „nebenan“ in der Platte
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
Vorwort
Ebenso lustvoll wie spannend war es, als wir im September 2009 mit einer ökumenischen Reisegruppe nach London aufbrachen, um Beispiele für eine missionarisch ausgerichtete Kirche und für fresh expressions of church kennen zu lernen. Wir waren ordentlich vorbereitet, hatten viel gehört über „unchurched“ und „dechurched“, über Säkularisierung und Entkirchlichung wie über die missionarische Neuausrichtung in der anglikanischen Kirche. „Gott spricht mit uns in einer Sprache, die wir verstehen“, hatte Bischof Finney bei der Vorbereitung gesagt, „der Sprache des Geldes“. So waren wir neugierig. „Dem englischen Patienten geht es besser“, hatten wir ja gelesen (s. S. 39 ff).
Die erste Begegnung hatten wir in der St. Johns Church beim Hyde Park. Ein Grundlagengespräch mit Kerry Thorpe, bei dem man sofort merkte: Von dieser konsequent auf Außenstehende gerichteten missionarischen Perspektive können wir viel lernen. Da geht es nicht mehr um die altbackene Alternative von Komm-Struktur und Geh-Struktur. Nicht: ‚Geh, damit die anderen kommen‘, sondern: ‚Geh, um bei den Menschen zu leben‘. Das erfordert eine Pluralität von kirchlichen Lebensformen, die in England auf regionaler Ebene entstehen, die aber auch der Bischof von sich aus auf den Weg bringen kann.
Schon vor dem Gespräch entdeckten wir im Eingang der Kirche eine Preisliste. Ein Trauergottesdienst kostet hier 125 Pfund, eine Trauung 254 Pfund. Für Kirchennutzung sowie Tätigkeiten des Pfarrers und des Music Director sind saftige dreistellige Beträge festgesetzt. (Schön übrigens: Die Taufe kostet ganze 12 Pfund. Ein Missionssakrament ist sie – dort wie hier.) Die Liste macht schnell deutlich: So vertraut vieles erscheint, die kirchlichen Strukturen sind doch auch sehr unterschiedlich. Unser Kirchensteuersystem ist dort fremd. Damit treten die Folgen von religiöser Pluralisierung und Säkularisierung offenkundig viel schärfer zu Tage als bei uns. Unser System ist vergleichsweise stabiler. Es ermöglicht damit vieles an guter Arbeit. Aber es birgt die Gefahr, sich über die geistliche Erosion der Volkskirche hinwegzutäuschen. Die anglikanische Kirche schaut manchen Realitäten, die wir zwar benennen, aber noch nicht wirklich spüren (bis 2030 30% weniger Kirchenglieder, die 50% weniger Geld, so das EKD-Papier „Kirche der Freiheit“) deutlich schärfer ins Angesicht. Schon damit ist sie ein spannendes Lernfeld.
In den nächsten Tagen erfuhren wir vieles über den missionarischen Aufbruch in der anglikanischen Kirche als Mission shaped church. Hoch interessante Zielgruppengemeinden erlebten wir. Legacy XS – eine Kirche für junge Leute, Skater und BMX-Fahrer, mit einem ausgewachsenen Skatingcenter und auch noch einer angelagerten Art Jugendkommunität. Oder Church on the corner, eine Kirche in der früheren Kneipe – eine Gemeinde, für junge Berufstätige zwischen 20 und 30 – ausschließlich.
Die Messychurch, die es in England inzwischen an bald 200 Orten gibt, erlebten wir, eine Art von Familienkirche, ein niederschwelliges Angebot für Eltern und Kinder mit Essen, Spiel, Begegnung und Gottesdienst. Sie wirkt einem Kindernachmittag o.ä. bei uns ähnlich, versteht sich aber – und das ist die Differenz – als eigenständige Form gemeindlichen Lebens, nicht nur als „Veranstaltung“ im Gemeindeleben. Dieses Projekt ist nach meiner Kenntnis das einzige, das einen aus unserer Reisegruppe unmittelbar zur Nachahmung inspirierte, weil es auch innerhalb einer Gemeinde ohne große Anpassungsprobleme umsetzbar ist (s. den Bericht von Matthias Paul. S. 257).
Auch church-planting-Projekte in engeren Sinn (konkret im „Ableger“-Modus) sahen wir (St. Stephen‘s in Twickenham; All Souls in St. Margarets). Sie sind eindrucksvoll. Mit Zustimmung des Bischofs hat etwa eine lebendige Gemeinde ein Team entsandt, das eine Kirche mit neuem Leben füllt, in die vorher nur noch wenige alte Leute kamen und die sonst vor der Schließung gestanden hätte. Der Bischof übernahm auch die Personalkosten für den Pastor. Dabei, so hören wir, muss das Team von Haupt- und Ehrenamtlichen schon immer so groß sein, dass eine kritische Mindestgröße überschritten wird, damit ein einladender Gottesdienst gefeiert werden kann. Heute sind in der neu belebten Gemeinde am Sonntag 120 Erwachsene und 120 Kinder, ein zweiter Gottesdienst musste ins Programm.
So gibt es ein ganzes Netz von neu gegründeten Gemeinden in London. Das alles ist faszinierend, etliche Gemeinden mit einer kräftigen missionarischen „Körpersprache“. Da wüsste ich auch manche Kirche bei uns, für die ich mir so etwas wünschen würde. Gleichwohl ließ mich das Londoner Modell auch etwas ratlos zurück. Die Gemeinden, die wir trafen, haben alle einen bestimmten Frömmigkeitsstil, den sie selbst im Spektrum der anglikanischen Kirche als den „charismatisch-evangelikalen“ Typ bezeichnen. Die Gottesdienste sind alternativ wie bei uns im durch Willow Creek inspirierten „zweiten Programm“. In London steht die Gemeinde Holy Trinity Brompton im Hintergrund, eine Mega-Church, in der der Alpha-Kurs entwickelt wurde. Es war großartig, sie kennen zu lernen. Nur: das alles scheint mir auf deutsche volkskirchliche Verhältnisse kaum übertragbar. Die Gemeinde, die in diesem Stil mit 300 Personen Gottesdienst feiert und nun ein Gründungsteam an einen anderen Ort senden könnte – sie kenne ich eigentlich nicht. Ein Erneuerungskonzept für die Breite unserer Kirche kann ich hier im Moment nicht recht erkennen. Ich weiß, dass es auch in England verschiedene church-planting-Modelle gibt. Nach dem, was wir erleben konnten, habe ich an dieser Stelle aber nach London mehr offene Fragen als vorher.
Es konnte nun wahrlich nicht überraschen, dass offenkundig das Meiste nicht ohne Weiteres auf deutsche Verhältnis zu übertragen ist. Wir hatten ja auch das liebevoll bösartige Diktum von irgendjemandem gehört, die Deutschen sollten endlich ihre eigenen missionarischen Hausaufgaben machen und aufhören, die englischen Gemeinden mit ständigen Besuchsreisen von der Arbeit abzuhalten.
Was aber habe ich in England gelernt?
Am Wichtigsten scheint mir die generelle Ausrichtung auf den missionarischen Auftrag der Kirche, „a strong mission focus“ – die Einsicht, dass es eine gesamtkirchliche Aufgabe ist, mit dem Evangelium neu auf bisher nicht erreichte Menschen und Milieus zuzugehen. Das ist zuerst keine Strukturfrage, sondern eine geistliche und theologische Herausforderung an die Menschen in der Kirche. Viele Papiere unserer deutschen Kirchen postulieren diesen Neuaufbruch seit Jahren, die Wirklichkeit ist noch längst nicht immer soweit. In England aber wird vieles davon erfahrbar, und zwar so, dass es ansteckt und einlädt. Vielleicht macht es die etwas gebrochene Wahrnehmung des Eigenen im Fremden leichter. So jedenfalls ging es unserer Reisegruppe. Ich glaube, dass war der Hauptertrag unserer Englandreise: Eine kräftige Ermutigung, sich auf eine missionarische Ausrichtung der kirchlichen Arbeit kreativ und auch mutig einzulassen. Diesem Geist konnte sich – so unterschiedlich die kirchlichen Vorprägungen waren – eigentlich keiner in unserer Gruppe entziehen. Das war bemerkenswert.
Die Sozialformen, mit denen das in England geschieht, sind bei uns noch relativ wenig in Erscheinung getreten. Sehr eingeleuchtet aber hat mir das Plädoyer für eine mixed economy, eine Pluralität an bewährten und neuen Gemeindeformen und Gemeindeprofilen. Mixed economy – das dürfte für unsere Volkskirche vor allem heißen: Unsere Mission muss plural sein in ihren Formen und auch in ihren Frömmigkeitsstilen. Und unsere Volkskirche muss in all ihrer Pluralität missionarisch sein.
Natürlich brauchen wir eine mixed economy in den Gemeindeformen und haben sie in Teilen schon. Ich bin inzwischen Landessuperintendent für einen Sprengel in der hannoverschen Landeskirche mit gut 200, meist ländlichen Kirchengemeinden. Nicht wenige sind strukturell relativ gesund und zukunftsfähig. Zu meiner Freude gibt es viele Kirchengemeinden mit einer beachtlichen missionarischen Ausstrahlungskraft. Noch weniger als früher halte ich jetzt etwas davon, unsere Kirchengemeinden klein – oder gar kaputt zu reden. Das stimmt geistlich nicht, und es stimmt – bei allen Problemen – oft auch empirisch nicht. Und vor allem: Das Allermeiste, was ich an gelingender missionarischer Arbeit in unserer Kirche kenne, läuft in und mit den Gemeinden.
Deshalb bin ich mir bei allem entschlossenen Ja zu einem missionarischen Neuaufbruch der Kirche auch nicht sicher, wie groß die historischen Metaphern sind, die man bemühen sollte. Die Antwort hängt sicher davon ab, wie stark man jeweils die Krise wahrnimmt, das variiert konfessionell und regional. Aber ob es sich wirklich um eine „kopernikanische Wende“ – so die Einleitung S. 19 – handelt oder doch eher um den stets nötigen Prozess der reformatio der ecclesia semper reformanda, darüber lasst uns in 30 Jahren noch einmal reden.
Mixed ecnonomy: Das muss besonders für die unterschiedliche Profilierung von Gemeinden gelten, ganz besonders im städtischen Bereich. Hier sind unterschiedliche Stile, Gottesdienstformen, Zielgruppen, Schwerpunkte hoch notwendig. Da ist noch einiges zu tun. Das war auch eines der Ergebnisse der Diskussion um das EKD-Impulspapier „Kirche der Freiheit“, das für 2030 nur noch 50% Parochialgemeinden im Blick hatte und 50% Profil- und Passantengemeinden. Nicht um die Relativierung der Gemeinde könne es primär gehen, so wurde in der Diskussion immer wieder gesagt, sondern um deren Profilierung. Das leuchtet mir für den Bereich, den ich überschaue, sehr ein. In den schwach besiedelten und entkirchlichten Gebieten Ostdeutschlands mag das noch einmal anders aussehen, in ausgeprägter Diasporasituation ebenfalls – da stellen sich ganz andere strukturelle Frage nach Gemeindeformen. Auch das ist dann mixed economy: Auf unterschiedliche Situationen unterschiedlich reagieren.
Dazu kommen die zwingend notwendigen Ergänzungen zur Parochialgemeinde: Die Menschen, die sich um Bildungszentren sammeln oder um Klöster und Kommunitäten, in der Schule oder auf Freizeiten (unsere Jugendarbeit läuft ja selten nur noch im klassischen Modell der Parochie). Auch um missionarische „Leuchttürme“ wie etwa den Expo-Wal in Hannover. An der Küste erlebe ich die unerhörten missionarischen Chancen der kirchlichen Arbeit unter Urlaubern. Es gibt schon manche fresh expressions – aber es können noch viel mehr werden.
An dieser Stelle sehe ich auch strukturelle Probleme und Hausaufgaben: Das System der Geldverteilung in unserer Kirche führt leicht zu einem Verteilungswettbewerb zwischen Gemeinden und anderen Formen kirchlicher Vergemeinschaftung. Dabei ziehen neue und innovative Formen (aus verständlichen Gründen) zu oft den Kürzeren, denn über die Verteilung entscheiden Gemeindevertreter. Und nachdenklich gemacht hat mich in England: Kommunikativ und missionarisch begabte Leute – und allermeist sind wir solchen in den besuchten Projekten begegnet – gibt es dort wiehier, Gott sei Dank. Die anglikanische Kirche aber ist weiter darin, solchen Personen durch spezielle Aufträge Freiräume zu verschaffen, ihre Gabe für eine missionarisch frische Kirche einzusetzen. Bei uns besteht die Gefahr, dass die Routineaufgaben in Kirchengemeinde und Kirchenkreis viel Energie absorbieren. Hier könnten wir im Blick auf missionarisch-strategischen „Unternehmergeist“ (entrepreneurial spirit) – das Wort fiel in England einmal – einiges lernen, denke ich.
Übrigens: Rechtlich gibt es in unserer Kirche jede Menge Möglichkeiten, neue Gemeindeformen zu etablieren. Die hannoversche Kirchenverfassung etwa sieht eine ganze Reihe von Gemeindemodellen vor. Ich befürchte hier auch keinen kirchenleitenden Strukturkonservativismus. Auch finanziell bekommt man für eine gute Idee aus irgendeinem Fördertopf oft eine Anschub-finanzierung. Schützen muss man frische Ideen in unseren evangelischen Strukturen allerdings wohl vor Bedenkenträgern und vor der Fülle der zu beteiligenden Gremien, die mürbe machen können. Nötig sind vor allem aber Menschen, die mit geistlichem Elan neue Ideen entwickeln und anpacken. Ich würde mich sehr freuen, in den kommenden Jahren die eine oder andere fresh expression in meinem Sprengel mit fördern zu können.
Zwei Dinge vor allem sind es, die ich an diesem Buch und der dahinter stehenden Bewegung hervorragend finde: Einmal die leidenschaftliche Suche nach neuen Wegen, missionarisch ausstrahlungsfähige Volkskirche zu sein. Ich nehme in all unserem Nachdenken – auch in diesem Buch – ein Suchen wahr nach neuen Wegen. Den missionarischen Königsweg kennt ja offensichtlich im Moment niemand. Es sind viele kleine Schritte, die erprobt werden. Aber diese missionarische Pfadfinderarbeit ist nötig – im Vertrauen auf Gottes Auftrag und auf seine Verheißung.
Und dann den ökumenischen Charakter. Und der ist ja doppelt. Einmal das Lernen bei den anglikanischen Geschwistern. Und dann das gemeinsame Lernen durch evangelische und katholische Christen. Beides habe ich im konkreten Vollzug als außerordentlich bereichernd erlebt.
Besonders bemerkenswert finde ich die gar nicht alltägliche evangelisch-katholische Zusammenarbeit. Sie ist noch einmal etwas anderes als der offizielle ökumenische Dialog über Apostolizität, Amt und Eucharistie einerseits und die Basisökumene auf Gemeindeebene. Offizielle Vertreter und Multiplikatoren in Bistum und Landeskirche stellen sich gemeinsam den Herausforderungen des Kircheseins von morgen. Das finde ich zukunftsweisend, auch für die Ökumene. Dass das in kollegialer Inspiration und großer Geschwisterlichkeit möglich ist, dafür bin ich besonders dankbar.
Landessuperintendent Dr. Hans Christian Brandy, Stade
I.
Philipp Elhaus – Christian Hennecke
Gottes Sehnsucht in der Stadt
Auf der ökumenischen Suche nach Gemeinden für morgen
Dieses gemeinsame Buch, unsere ökumenische Spurensuche, hat eine lange Geschichte. Gemeinsam steht am Anfang eine Wahrnehmung: Unsere Kirchen sind im Übergang, in einem tiefgreifenden Umbruchsprozess. Was inzwischen zu einem Gemeinplatz geworden zu sein scheint, ist aber vielfach ausdeutbar: auf der einen Seite stehen diejenigen, die die vergangenen Jahrzehnte als vielfache Abbruchs- oder Dekadenzgeschichte der Kultur und/oder der Kirchen sehen und zumeist schnell Schuldige und Ursachen für den diagnostizierten Glaubensschwund ausmachen können. Je nach hermeneutischer Färbung kommt man dann auf je andere Denkschriften.
Die gemeinsame Wahrnehmung, die uns in unserer ökumenischen Zusammenarbeit von Anfang an geprägt hat, war aber eine andere: Es ist ja Gott, der seine Kirche führt und leitet – und sein Geist ist es, der immer wieder und zu jeder Zeit Neues schafft und hervorbringt. Umarmt uns so Gott mit der Wirklichkeit dieser Zeit – was zeigt er uns da an Chancen, an Herausforderungen, an „Zeichen der Zeit“, auf die wir aus der Kraft des Evangeliums antworten können?
Die Großwetterlage: mitten in der Wandlung
Wer aus dieser Perspektive schaut, könnte einen eucharistischen Grundansatz wählen: wir stehen im Prozess der Wandlung. Noch theologisch abgründiger und begründbarer: wir sind in einem Prozess des Pascha, des Leidens und Sterbens und Auferstehens. Eine milieuhaft geprägte Kirchengestalt, in der wir gewissermaßen ins Christsein hineingeboren wurden, geht unwiderruflich zu Ende. Mit allen Nebenwirkungen. Denn es zeigt sich, dass die inneren Bilder und die pastorale Praxis, ja, das gesamte kirchliche Gefüge auf dieser Grundlage basierten. Wer denkt, dass deswegen einige Korrekturmaßnahmen den Ursprungszustand wiederherstellen können, der täuscht sich sehr. Strukturmaßnahmen der Kirchen, die zu größeren pastoralen Räumen und Regionen führen, Fusionen und ähnliches sind zunächst notwendige Renovierungsarbeiten, aber keine Erneuerung. Sie sind Versuche des Erhalts eines für die katholische Kirche notwendigen sakramentalen Gestaltgefüges bzw. Anpassungsleistungen eines auf dem Gegenüber von Pfarramt und Gemeinde basierenden kirchlichen Versorgungssystems der evangelischen Kirchen.
Auch die Dauerbaustelle christlicher Initiation kann nicht erfolgreich bearbeitet werden, wenn nicht grundlegend bedacht wird, dass das Christwerden heute eine Frage persönlicher Wahl oder – theologisch gesprochen – Berufung ist und deswegen nicht einfach durch neue Wege des Konfirmationsunterrichts oder der Kommunion- und Firmvorbereitung gelöst werden kann. Nein, wir befinden uns in einem evangelisierenden und katechumenalen Umfeld – und das führt auch zu einem grundlegenden Neubedenken der Christwerdungsprozesse.
Die kopernikanische Wende der Ekklesiopraxis
Die Pointe dieser Veränderungen aber heißt auch: die Sozialgestalten, die kirchlichen Orte, werden sich transformieren, sie tun es schon. Noch mehr: schon seit Jahren ist ein Prozess im Gange, der gewissermaßen zu einer kopernikanischen Wende der Ekklesiopraxis führt: war in einer (noch) gemeindekirchlichen Perspektive die klassische Gemeinde „Kern und Stern“, ja, geheime Mitte kirchlicher Gestalt und Existenz, um die herum auch noch andere kirchliche „Planeten“ kreisten, so rückt nun die gelebte und erfahrene Christuswirklichkeit – die „Sonne“ – in die Mitte, und es bildet sich ein „Planetensystem“ kirchlicher Orte, gewissermaßen ein Netzwerk, in dem unterschiedliche Zentren kirchlicher Existenz ein Gesamtgefüge vielfältiger Einheit abbilden. Diese Perspektive reicht weiter als die vielerorts fomulierte notwendige Ergänzung der Ortsgemeinde durch plurale gemeindliche Formen. Sie wagt es, Kirche aus christologischer und soziologischer Sicht als Ensemble unterschiedlicher Räume zu denken, die erst in ihrer Vielfalt sowohl die Phantasie des Heiligen Geistes als auch die Facetten unterschiedlicher Lebenswirklichkeiten spiegeln können.
Wie bei der astronomischen Entdeckung des Kopernikus führt dies zu gründlichen Neubestimmungen und zu nicht geringen Irritationen und Regressionen: aus dem Mittelpunkt gerückt muss die klassische örtliche „Territorialgemeinde“ in der katholischen Kirche auch angesichts der prekären Begleitung durch Priester und Hauptberufliche ihr Profil entwickeln als lebensräumlich und wohnraumnah verortete Gemeinde im Sinne der basiskirchlichen Ansätze, die weltkirchlich ausgereift sind und in den vergangenen Jahren im deutschen Sprachraum in experimentalen Entwicklungsprozessen wachsen.1 Seitens der evangelischen Kirche steht dieser Perspektivenwechsel vielerorts noch bevor. Doch der Trend zu Regionalisierungsprozessen und Fusionen weist in die gleiche Richtung, wenn man ihn nicht nur pragmatisch als Optimierung bestehender Arbeit angesichts schwindender Ressourcen fasst, sondern mit der theologischen Frage nach dem Auftrag im konkreten lokalen Kontext verbindet.
Zugleich wächst die Einsicht, dass seit mindestens einem Jahrzehnt Familienbildungsstätten, Kindergärten, Altenheime, Schulen und andere Einrichtungen, Verbände und Kirchliche Bewegungen zu unterschiedlich intensiven kirchlichen Existenzräumen werden. Es stellt sich die Frage neu, wie diese „Schaufenster“ des Evangeliums und der Kirche, die im übrigen gesellschaftlich mehr wahrgenommen und geschätzt werden als innerkirchlich, als Orte des Kircheseins entwickelt werden können und wie phänomenologisch und induktiv ihre implizite Ekklesiologie gehoben werden kann. Denn hier begegnet vielen Menschen Kirche authentisch, mit Bezug zur alltäglichen Lebenswelt und wird entsprechend als „unsere Kirche“ wahrgenommen.
Ebenfalls neu in den Blick rückt aber die Perspektive, dass Gemeinden gegründet werden könnten: eben weil Menschen heute in anderer Weise zum Christsein kommen und ihr Christsein bezeugen und leben wollen, entstehen neue Gemeindeformen, entstehen neue Initiativen – eigentlich überall. Und hierbei geht es nicht um schrille Sonderfälle, sondern um eine genuine Bewegung leidenschaftlicher Christen – in allen Konfessionen.
Das betrifft also beide Konfessionen gleichermaßen – und das macht unseren Prozess so spannend, und die Frage lautet: Was ist gemeint, wenn wir von Kirche sprechen, wie geht Kirche heute und morgen – wie „kirchen“ wir, um diese Dynamik einmal in einem Neologismus zu beschreiben? Die Fragen, die sich daraus ergeben, sind Legion – und sie sind brisant, angefangen von der Grundproblematik, wie denn die klassisch geprägten Gemeinden zu den neuen Sozialgestalten stehen.
Vielleicht hat niemand dies so tief und so bewegend formuliert wie Dietrich Bonhoeffer, der 1944 voraussah, dass die gesellschaftlichen und kulturellen Transformationen zu einer veritablen Neugeburt kirchlicher Wirklichkeit führen müssen. Die paschatheologische Relevanz der „ecclesia semper reformanda“ wird bei ihm in aller Deutlichkeit formuliert:
„Du wirst heute zum Christen getauft. All die alten großen Worte der christlichen Verkündigung werden über dir ausgesprochen und der Taufbefehl Jesu Christi wird an dir vollzogen, ohne dass du etwas davon begreifst. Aber auch wir selbst sind wieder ganz auf die Anfänge des Verstehens zurückgeworfen. Was Versöhnung und Erlösung, was Wiedergeburt und Heiliger Geist, was Feindesliebe, Kreuz und Auferstehung, was Leben in Christus und Nachfolge Christi heißt, das alles ist so schwer und so fern, dass wir es kaum mehr wagen, davon zu sprechen. In den überlieferten Worten und Handlungen ahnen wir etwas ganz Neues und Umwälzendes, ohne es noch fassen und aussprechen zu können. Das ist unsere eigene Schuld. Unsere Kirche, die in diesen Jahren nur um ihre Selbsterhaltung gekämpft hat, als wäre sie ein Selbstzweck, ist unfähig, Träger des versöhnenden und erlösenden Wortes für die Menschen und für die Welt zu sein. Darum müssen frühere Worte kraftlos werden und verstummen, und unser Christsein wird heute nur aus zweierlei bestehen: im Beten und Tun des Gerechten unter den Menschen. Alles Denken, Reden und Organisieren in den Dingen des Christentums muss neugeboren werden aus diesem Beten und diesem Tun. Bist du groß bist, wird sich die Gestalt der Kirche sehr verändert haben. Die Umschmelzung ist noch nicht zu Ende, und jeder Versuch, ihr vorzeitig zu neuer organisatorischer Machtentfaltung zu verhelfen, wird nur eine Verzögerung ihrer Umkehr und Läuterung sein. Es ist nicht unsere Sache, den Tag vorauszusagen – aber der Tag wird kommen –, an dem wieder Menschen berufen werden, das Wort Gottes so auszusprechen, dass sich die Welt darunter verändert und erneuert …“ (Widerstand und Ergebung, DBW 8, 435).
Wir stehen nicht – wie er – vor diesem Prozess. Wir sind mitten drin in diesem reinigenden, läuternden und kreativen Wandlungsgeschehen. Und genau das hat uns auf den Weg gebracht, gemeinsam nach neuen Gemeinden für morgen zu suchen