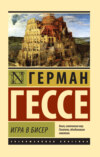Read the book: «Peter Camenzind»
Peter Camenzind
Hermann Hesse
Inhaltsverzeichnis
Peter Camenzind von Hermann Hesse
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Impressum
Peter Camenzind von Hermann Hesse
Meinem Freund Ludwig Finckh
Peter Camenzind
I.
Im Anfang war der Mythus. Wie der große Gott in den Seelen der Inder, Griechen und Germanen dichtete und nach Ausdruck rang, so dichtet er in jedes Kindes Seele täglich wieder.
Wie der See und die Berge und die Bäche meiner Heimat hießen, wußte ich noch nicht. Aber ich sah die blaugrüne glatte Seebreite, mit kleinen Lichtern durchwirkt, in der Sonne liegen und im dichten Kranz um sie die jähen Berge, und in ihren höchsten Ritzen die blanken Schneescharten und kleinen, winzigen Wasserfälle, und an ihrem Fuß die schrägen, lichten Matten, mit Obstbäumen, Hütten und grauen Alpkühen besetzt. Und da meine arme, kleine Seele so leer und still und wartend lag, schrieben die Geister des Sees und der Berge ihre schönen kühnen Taten auf sie. Die starren Wände und Flühen sprachen trotzig und ehrfürchtig von Zeiten, deren Söhne sie sind und deren Wundmale sie tragen. Sie sprachen von damals, da die Erde barst und sich bog und aus ihrem gequälten Leibe in stöhnender Werdenot Gipfel und Grate hervortrieb. Felsberge drängten sich brüllend und krachend empor, bis sie ziellos vergipfelnd knickten, Zwillingsberge rangen in verzweifelter Not um Raum, bis einer siegte und stieg und den Bruder beiseite warf und zerbrach. Noch immer hingen von jenen Zeiten her da und dort hoch in den Schlüften abgebrochene Gipfel, weggedrängte und gespaltene Felsen, und in jeder Schneeschmelze führte der Wassersturz hausgroße Blöcke nieder, zersplitterte sie wie Glas oder rannte sie mit mächtigem Schlage tief in weiche Matten ein.
Sie sagten immer dasselbe, diese Felsberge. Und es war leicht sie zu verstehen, wenn man ihre jähen Wände sah, Schicht um Schicht geknickt, verbogen, geborsten, jede voll von klaffenden Wunden. „Wir haben Schauerliches gelitten,“ sagten sie, „und wir leiden noch.“ Aber sie sagten es stolz, streng und verbissen, wie alte unverwüstliche Kriegsleute.
Jawohl, Kriegsleute. Ich sah sie kämpfen, mit Wasser und Sturm, in den schauerlichen Vorfrühlingsnächten, wenn der erbitterte Föhn um ihre alten Häupter brüllte und wenn die Bachstürze frische, rohe Stücke aus ihren Flanken rissen. Sie standen mit trotzig gestemmten Wurzeln in diesen Nächten, finster, atemlos und verbissen, streckten dem Sturm die zerspaltenen Wetterwände und Hörner entgegen und spannten alle Kraft in trotzig geduckter Sammlung zusammen. Und bei jeder Wunde ließen sie das grausige Rollen der Wut und Angst vernehmen, und durch alle fernsten Rüfenen klang gebrochen und zornig ihr schreckliches Stöhnen wieder.
Und ich sah Matten und Hänge und erdige Felsritzen mit Gräsern, Blumen, Farnen und Moosen bedeckt, denen die alte Volkssprache merkwürdige, ahnungsvolle Namen gegeben hatte. Sie lebten, Kinder und Enkel der Berge, farbig und harmlos an ihren Stätten. Ich befühlte sie, betrachtete sie, roch ihren Duft und lernte ihre Namen. Ernster und tiefer berührte mich der Anblick der Bäume. Ich sah jeden von ihnen sein abgesondertes Leben führen, seine besondere Form und Krone bilden und seinen eigenartigen Schatten werfen. Sie schienen mir, als Einsiedler und Kämpfer, den Bergen näher verwandt, denn jeder von ihnen, zumal die höher am Berge stehenden, hatte seinen stillen, zähen Kampf um Bestand und Wachstum, mit Wind, Wetter und Gestein. Jeder hatte seine Last zu tragen und sich festzuklammern, und davon trug jeder seine eigene Gestalt und besondere Wunden. Es gab Föhren, denen der Sturm nur auf einer einzigen Seite Äste zu haben erlaubte, und solche, deren rote Stämme sich wie Schlangen um überhängende Felsen gebogen hatten, sodaß Baum und Fels eins das andere an sich drückte und erhielt. Sie sahen mich wie kriegerische Männer an und erweckten Scheu und Ehrfurcht in meinem Herzen.
Unsere Männer und Frauen aber glichen ihnen, waren hart, streng gefaltet und wenig redend, die besten am wenigsten. Daher lernte ich die Menschen gleich Bäumen oder Felsen anschauen, mir Gedanken über sie zu machen und sie nicht weniger zu ehren und nicht mehr zu lieben als die stillen Föhren.
Unser Dörflein Nimikon liegt auf einer dreieckigen, zwischen zwei Bergvorsprünge geklemmten schrägen Fläche am See. Ein Weg führt nach dem nahen Kloster, ein zweiter nach einem viereinhalb Stunden entfernten Nachbarort, die übrigen am See gelegenen Dörfer erreicht man zu Wasser. Unsere Häuser sind im alten Holzstil erbaut und haben kein bestimmtes Alter, es kommen fast niemals Neubauten vor und die alten Häuslein werden je nach Bedürfnis stückweise repariert, dies Jahr die Diele, ein andermal ein Stück am Dach, und mancher halbe Balken und manche Latte, die früher einmal etwa zur Stubenwand gehört haben, findet man jetzt als Sparren im Dach und wenn sie auch dazu nimmer dienen und doch noch zu gut zum Verbrennen sind, so kommen sie das nächste mal beim Flicken des Stalls oder Heubodens oder als Querlatte an der Haustüre zur Verwendung. Ähnlich ist es mit den darin Wohnenden selber; jeder spielt so lang er kann seine Rolle mit, tritt dann zögernd in den Kreis der Unbrauchbaren und taucht schließlich ins Dunkel unter, ohne daß viel Aufsehens davon gemacht würde. Wer nach jahrelanger Fremde zu uns heimkehrt, findet nichts verändert, als daß ein paar alte Dächer erneuert und ein paar neuere alt geworden sind; die Greise von ehemals sind zwar dahin, aber es sind andere Greise da, welche die gleichen Hütten bewohnen, die gleichen Namen tragen, dasselbe dunkelhaarige Kindervolk bewachen und an Gesicht und Gebahren sich von den indessen Weggestorbenen kaum unterscheiden.
Unsrer Gemeinde mangelte eine häufigere Zufuhr frischen Blutes und Lebens von außen her. Die Bewohner, ein leidlich rüstiges Geschlecht, sind fast alle untereinander aufs engste verschwägert und reichlich drei Viertel tragen den Namen Camenzind. Er füllt die Seiten des Kirchenbuchs und steht auf den Kirchhofkreuzen, prangt an den Häusern in Ölfarbe oder in derber Schnitzarbeit und ist auf den Wagen des Fuhrhalters, auf den Stalleimern und auf den Seebooten zu lesen. Auch über meines Vaters Haustür stand gemalt: „Dieses Haus haben gebauen Jost und Franziska Camenzind,“ doch ging das nicht meinen Vater, sondern dessen Ahn, meinen Urgroßvater an; und wenn ich auch vermutlich einmal sterben werde ohne Kinder dazulassen, so weiß ich doch, daß wieder ein Camenzind das alte Nest besiedeln wird, wenn anders es bis dorthin noch steht und ein Dach über hat.
Ungeachtet der scheinbaren Eintönigkeit gab es dennoch in unsrer Bürgerschaft Böse und Gute, Vornehme und Geringe, Mächtige und Niedrige und neben manchen Klugen eine ergötzliche kleine Sammlung von Narren, die Kretins gar nicht mitgerechnet. Es war wie überall ein kleines Abbild der großen Welt und da Große und Kleine, Schlaumeier und Narren unlöslich untereinander verwandt und vervettert waren, traten sich strenger Hochmut und bornierter Leichtsinn oft genug unter demselben Dach auf die Zehen, so daß unser Leben für die Tiefe und Komik des Menschlichen hinreichenden Raum bot. Nur lag ein ewiger Schleier von verheimlichter oder unbewußter Bedrücktheit darüber. Das Abhängigsein von den Naturmächten und die Kümmerlichkeit eines arbeitsvollen Daseins hatten im Verlauf der Zeiten unsrem ohnehin alternden Geschlecht eine Neigung zum Tiefsinn eingegeben, der zu den scharfen, schroffen Gesichtern zwar nicht übel paßte, sonst aber keinerlei Früchte zeitigte, wenigstens keine erfreulichen. Eben darum war man froh an den paar Narren, welche zwar noch still und ernsthaft genug waren, aber doch einige Farbe und einige Gelegenheit zu Gelächter und Spott hereinbrachten. Wenn einer von ihnen durch einen neuen Streich von sich reden machte, ging ein frohes Wetterleuchten über die faltigen, braunen Gesichter der Söhne Nimikons und zur Lust am Spaße selber kam noch als feine pharisäische Würze der Genuß der eigenen Überlegenheit, welche vor Vergnügen schnalzte im Gefühl, vor solchen Irrungen oder Fehltritten sicher zu sein. Zu jenen Vielen, die in der Mitte zwischen Gerechten und Sündern standen und von beiden gern das Annehmliche mitgenossen hätten, gehörte auch mein Vater. Es wurde kein Narrenstreich reif, der ihn nicht mit seliger Unruhe erfüllt hätte, und er schwankte alsdann zwischen der teilnehmenden Bewunderung für den Anstifter und dem feisten Bewußtsein der eigenen Makellosigkeit possierlich hin und wider.
Zu den Narren selbst gehörte mein Oheim Konrad, ohne daß er deshalb etwa meinem Vater und anderen Helden an Verstand etwas nachgegeben hätte. Vielmehr war er ein Schlaukopf und ward von einem ruhelosen Erfindungsgeist umgetrieben, um den die andern ihn ruhig hätten beneiden dürfen. Aber freilich glückte ihm nichts. Daß er, statt darüber den Kopf hängen zu lassen und tatlos tiefsinnig zu werden, immer wieder Neues begann und dabei ein merkwürdig lebhaftes Gefühl für das Tragikomische seiner eigenen Unternehmungen hatte, war gewiß ein Vorzug, wurde ihm aber als lächerliche Sonderbarkeit angeschrieben, kraft welcher man ihn zu den unbesoldeten Hanswürsten der Gemeinde zählte. Meines Vaters Verhältnis zu ihm war ein dauerndes hin und her zwischen Bewunderung und Verachtung. Jedes neue Projekt seines Schwagers versetzte ihn in eine gewaltige Neugierde und Aufregung, die er vergebens hinter lauernd ironischen Fragen und Anspielungen zu verstecken trachtete. Wenn dann der Oheim seines Erfolges sicher zu sein glaubte und den Großartigen zu spielen begann, ließ er sich jedesmal hinreißen und schloß sich dem Genialen in spekulierender Brüderlichkeit an, bis der unvermeidliche Mißerfolg da war, über den der Oheim die Achseln zuckte, während der Vater im Zorn ihn mit Hohn und Beleidigung übergoß und monatelang keines Blickes und Wortes mehr würdigte.
Konrad war es, dem unser Dorf den ersten Anblick eines Segelboots verdankte, und meines Vaters Nachen hat dazu herhalten müssen. Das Segel- und Seilwerk war vom Oheim nach Kalenderholzschnitten sauber ausgeführt und daß unser Schifflein für ein Segelboot zu schmal gebaut war, ist am Ende nicht Konrads Schuld gewesen. Die Vorbereitungen dauerten wochenlang, mein Vater wurde vor Spannung, Hoffnung und Angst schier zu Quecksilber und auch das übrige Dorf sprach von nichts soviel wie von Konrad Camenzinds neuestem Vorhaben. Es war ein denkwürdiger Tag für uns, als das Boot an einem windigen Spätsommermorgen zum erstenmal in See gehen sollte. Mein Vater, in scheuer Ahnung einer möglichen Katastrophe, hielt sich fern und hatte auch mir zu meiner großen Betrübnis das Mitfahren verboten. Der Sohn des Bäckers Füßli begleitete den Segelkünstler allein. Aber das ganze Dorf stand auf unserem Kiesplatz und in den Gärtchen und wohnte dem unerhörten Spektakel bei. Seeabwärts blies ein flotter Ostwind. Zu Anfang mußte der Beck rudern, bis das Boot in die Bise geriet, sein Segel blähte und stolz davonjagte. Wir sahen es bewundernd um den nächsten Bergvorsprung entschwinden und richteten uns darauf ein, den schlauen Oheim bei seiner Heimkehr als Sieger zu begrüßen und uns unserer höhnischen Aftergedanken zu schämen. Als jedoch in der Nacht das Boot zurückkehrte, hatte es kein Segel mehr, die Schiffer waren mehr tot als lebendig und der Bäckerssohn hustete und meinte: „Ihr seid um ein Hauptvergnügen gekommen, leichtlich hätte es auf den Sonntag zwei Leichenschmäuse geben können.“ Mein Vater mußte zwei neue Planken in den Nachen basteln, und seither hat sich nie wieder ein Segel in der blauen Fläche gespiegelt. Dem Konrad rief man noch lange, so oft er irgend etwas eilig hatte, nach: „Mußt Segel nehmen, Konrad!“ Mein Vater fraß den Ärger in sich hinein und lange Zeit, so oft der arme Schwager ihm begegnete, sah er beiseite und spuckte in großen Bogen aus, zum Zeichen unaussprechlicher Verachtung. Das dauerte so lang, bis Konrad eines Tags mit seinem feuersicheren Backofenprojekt bei ihm vorsprach, welches dem Erfinder unendlichen Spott auf den Hals brachte und meinen Vater auf vier bare Taler zu stehen kam. Wehe dem, der ihn an diese Viertalergeschichte zu erinnern wagte! Lange später, als einmal wieder Not im Hause war, sagte die Mutter einmal so beiläufig, es wäre doch gut wenn jetzt das sündlich verdubelte Geld noch da wäre. Der Vater wurde dunkelrot bis an den Hals, aber er bezwang sich und sagte nur: „Ich wollt’, ich hätt’ es an einem einzigen Sonntag versoffen.“
Am Ende jedes Winters kam der Föhn mit seinem tieftönigen Gebrause, das der Älpler mit Zittern und Entsetzen hört und nach welchem er in der Fremde mit verzehrendem Heimweh dürstet.
Wenn der Föhn nahe ist, spüren ihn viele Stunden voraus Männer und Weiber, Berge, Wild und Vieh. Sein Kommen, welchem fast immer kühle Gegenwinde vorausgehen, verkündigt ein warmes, tiefes Sausen. Der blaugrüne See wird in ein paar Augenblicken tinteschwarz und setzt plötzlich hastige, weiße Schaumkronen auf. Und bald darauf donnert er, der noch vor Minuten unhörbar friedlich lag, mit erbitterter Brandung wie ein Meer ans Ufer. Zugleich rückt die ganze Landschaft ängstlich nah zusammen. Auf Gipfeln, die sonst in entrückter Ferne brüteten, kann man jetzt die Felsen zählen und von Dörfern, die sonst nur als braune Flecken im Weiten lagen, unterscheidet man jetzt Dächer, Giebel und Fenster. Alles rückt zusammen, Berge, Matten und Häuser, wie eine furchtsame Herde. Und dann beginnt das grollende Sausen, das Zittern im Boden. Aufgepeitschte Seewellen werden streckenweit wie Rauch durch die Luft dahingetrieben, und fortwährend, zumal in den Nächten, hört man den verzweifelten Kampf des Sturmes mit den Bergen. Eine kleine Zeit später redet sich dann die Nachricht von verschütteten Bächen, zerschlagenen Häusern, zerbrochenen Kähnen und vermißten Vätern und Brüdern durch die Dörfer.
In Kinderzeiten fürchtete ich den Föhn und haßte ihn sogar. Mit dem Erwachen der Knabenwildheit aber bekam ich ihn lieb, den Empörer, den Ewigjungen, den frechen Streiter und Bringer des Frühlings. Es war so herrlich, wie er voll Leben, Überschwang und Hoffnung seinen wilden Kampf begann, stürmend, lachend und stöhnend, wie er heulend durch die Schluchten hetzte, den Schnee von den Bergen fraß und die zähen alten Föhren mit rauhen Händen bog und zum Seufzen brachte. Später vertiefte ich meine Liebe und begrüßte nun im Föhn den süßen, schönen, allzureichen Süden, welchem immer wieder Ströme von Lust, Wärme und Schönheit entquellen, um sich an den Bergen zu zersprengen und endlich im flachen, kühlen Norden ermüdet zu verbluten. Es gibt nichts Seltsameres und Köstlicheres als das süße Föhnfieber, das in der Föhnzeit die Menschen der Bergländer und namentlich die Frauen überfällt, den Schlaf raubt und alle Sinne streichelnd reizt. Das ist der Süden, der sich dem spröden, ärmeren Norden immer wieder stürmisch und lodernd an die Brust wirft und den verschneiten Alpendörfern verkündigt, daß jetzt an den nahen, purpurnen Seen Welschlands schon wieder Primeln, Narzissen und Mandelzweige blühen.
Alsdann, wenn der Föhn verblasen hat und die letzten schmutzigen Lawinen zerlaufen sind, dann kommt das Schönste. Dann recken sich berghinan auf allen Seiten die beblümten gelblichen Matten, rein und selig stehen die Schneegipfel und Gletscher in ihren Höhen und der See wird blau und warm und spiegelt Sonne und Wolkenzüge wieder.
Alles dieses kann schon eine Kindheit und zur Not auch ein Leben erfüllen. Denn alles dieses redet laut und ungebrochen die Sprache Gottes, wie sie nie über eines Menschen Lippen kam. Wer sie so in seiner Kindheit vernommen hat, dem tönt sie sein Leben lang nach, süß und stark und furchtbar, und ihrem Bann entflieht er nie. Wenn einer in den Bergen heimisch ist, der kann jahrelang Philosophie oder historia naturalis studieren und mit dem alten Herrgott aufräumen, — wenn er den Föhn wieder einmal spürt oder hört eine Laue durch’s Holz brechen, so zittert ihm das Herz in der Brust und er denkt an Gott und ans Sterben.
An meines Vaters Häuschen grenzte ein umzäunter, winziger Garten. Es gedieh dort ein herber Salat, Rüben und Kohl, außerdem hatte die Mutter eine rührend schmale, dürftige Rabatte für Blumen angelegt, in welcher zwei Monatrosenstöcke, ein Georginenbusch und eine Handvoll Reseden hoffnungslos und kümmerlich verschmachteten. An den Garten stieß ein noch kleinerer, kiesiger Platz, welcher bis zum See reichte. Dort standen zwei beschädigte Fässer, einige Bretter und Pfähle, und unten im Wasser lag unser Weidling angebunden, welcher damals noch alle paar Jahre neu geflickt und geteert wurde. Die Tage, an denen dies geschah, sind mir fest im Gedächtnis geblieben. Es waren warme Nachmittage im Vorsommer, über dem Gärtchen taumelten die schwefelgelben Citronenfalter in der Sonne, der See war ölglatt, blau und still und leise schillernd, die Berggipfel dünn umdünstet, und auf dem kleinen Kiesplatz roch es gewaltig nach Pech und Ölfarbe. Auch nachher duftete der Nachen noch den ganzen Sommer hindurch nach Teer. So oft ich, viele Jahre später, irgendwo am Meere den eigentümlich aus Wassergeruch und Teerbrodem gemischten Duft in die Nase bekam, trat mir sogleich unser Seeplätzlein vor’s Auge, und ich sah wieder den Vater in Hemdärmeln mit dem Pinsel hantieren, sah die bläulichen Wölkchen aus seiner Pfeife in die stillen Sommerlüfte steigen und die blitzgelben Falter ihre unsicheren, scheuen Flüge tun. An solchen Tagen zeigte mein Vater eine ungewöhnlich behagliche Laune, pfiff Triller, was er vortrefflich konnte, und gab vielleicht sogar einen einzelnen kurzen Jodler von sich, diesen jedoch nur halblaut. Die Mutter kochte alsdann etwas Gutes auf den Abend und ich denke mir jetzt, sie tat es in der stillen Hoffnung, Camenzind möchte diesen Abend nicht ins Wirtshaus gehen. Er ging aber doch.
Daß die Eltern die Entwicklung meines jungen Gemütes sonderlich gefördert oder gestört hätten, kann ich nicht sagen. Die Mutter hatte immer beide Hände voll Arbeit und mein Vater hatte sich gewiß mit nichts auf der Welt so wenig beschäftigt als mit Erziehungsfragen. Er hatte genug zu tun, seine paar Obstbäume kümmerlich im Stand zu halten, das Kartoffeläckerlein zu bestellen und nach dem Heu zu sehen. Ungefähr alle paar Wochen aber nahm er mich abends, ehe er ausging, bei der Hand und verschwand stillschweigend mit mir auf den über dem Stall gelegenen Heuboden. Dort vollzog sich alsdann ein seltsamer Straf- und Sühneakt: ich bekam eine Tracht Prügel, ohne daß der Vater oder ich selbst genauer gewußt hätte wofür. Es waren stille Opfer am Altar der Nemesis und sie wurden ohne Schelten seinerseits oder Geschrei meinerseits dargebracht, als schuldiger Tribut an eine geheimnisvolle Macht. Immer wenn ich in späteren Jahren einmal vom „blinden Schicksal“ reden hörte, fielen diese mysteriösen Szenen mir wieder ein und schienen mir eine überaus plastische Darstellung jenes Begriffs zu sein. Ohne es zu wissen, befolgte mein guter Vater dabei die schlichte Pädagogik, die das Leben selbst an uns zu üben pflegt, indem es uns hie und da aus heiteren Lüften ein Donnerwetter sendet, wobei es uns überlassen bleibt nachzusinnen, durch was für Missetaten wir eigentlich die oberen Mächte herausgefordert haben. Leider stellte dies Nachsinnen bei mir sich nie oder nur selten ein, vielmehr nahm ich jene ratenweise Züchtigung ohne die wünschenswerte Selbstprüfung gelassen oder auch trotzig hin und freute mich an solchen Abenden stets, nun wieder meinen Zoll entrichtet und ein paar Wochen Strafpause vor mir zu haben. Viel selbständiger trat ich den Versuchen meines Alten, mich zur Arbeit anzuleiten, entgegen. Die unbegreifliche und verschwenderische Natur hatte in mir zwei widerstrebende Gaben vereinigt: eine ungewöhnliche Körperkraft und eine leider nicht geringere Arbeitsscheu. Der Vater gab sich alle Mühe einen brauchbaren Sohn und Mithelfer aus mir zu machen, ich aber drückte mich mit allen Chikanen um die mir auferlegten Arbeiten und noch als Gymnasiast hatte ich für keinen der antiken Heroen so viel Mitgefühl wie für Herakles, da er zu jenen berühmten, lästigen Arbeiten gezwungen ward. Einstweilen kannte ich nichts Schöneres als mich auf Felsen und Matten oder am Wasser müßiggängerisch herumzutreiben.
Berge, See, Sturm und Sonne waren meine Freunde, erzählten mir und erzogen mich und waren mir lange Zeit lieber und bekannter als irgend Menschen und Menschenschicksale. Meine Lieblinge aber, die ich dem glänzenden See und den traurigen Föhren und sonnigen Felsen vorzog, waren die Wolken.
Zeigt mir in der weiten Welt den Mann, der die Wolken besser kennt und mehr lieb hat als ich! Oder zeigt mit das Ding in der Welt, das schöner ist als Wolken sind! Sie sind Spiel und Augentrost, sie sind Segen und Gottesgabe, sie sind Zorn und Todesmacht. Sie sind zart, weich und friedlich wie die Seelen von Neugeborenen, sie sind schön, reich und spendend wie gute Engel, sie sind dunkel, unentrinnbar und schonungslos wie die Sendboten des Todes. Sie schweben silbern in dünner Schicht, sie segeln lachend weiß mit goldenem Rand, sie stehen rastend in gelben, roten und bläulichen Farben. Sie schleichen finster und langsam wie Mörder, sie jagen sausend kopfüber wie rasende Reiter, sie hängen traurig und träumend in bleichen Höhen wie schwermütige Einsiedler. Sie haben die Formen von seligen Inseln und die Formen von segnenden Engeln, sie gleichen drohenden Händen, flatternden Segeln, wandernden Kranichen. Sie schweben zwischen Gottes Himmel und der armen Erde als schöne Gleichnisse aller Menschensehnsucht, beiden angehörig — Träume der Erde, in welchen sie ihre befleckte Seele an den reinen Himmel schmiegt. Sie sind das ewige Sinnbild alles Wanderns, alles Suchens, Verlangens und Heimbegehrens. Und so wie sie zwischen Erde und Himmel zag und sehnend und trotzig hängen, so hängen zag und sehnend und trotzig die Seelen der Menschen zwischen Zeit und Ewigkeit.
O, die Wolken, die schönen, schwebenden, rastlosen! Ich war ein unwissendes Kind und liebte sie, schaute sie an und wußte nicht, daß auch ich als eine Wolke durch’s Leben gehen würde — wandernd, überall fremd, schwebend zwischen Zeit und Ewigkeit. Von Kinderzeiten her sind sie mir liebe Freundinnen und Schwestern gewesen. Ich kann nicht über die Gasse gehen, so nicken wir einander zu, grüßen uns und verweilen einen Augenblick Aug’ in Auge. Auch vergaß ich nicht, was ich damals von ihnen lernte: ihre Formen, ihre Farben, ihre Züge, ihre Spiele, Reigen, Tänze und Rasten, und ihre seltsam irdisch-himmlischen Geschichten.
Namentlich die Geschichte der Schneeprinzessin. Ihr Schauplatz ist das mittlere Gebirg, im Vorwinter, bei warmem Unterwind. Die Schneeprinzessin erscheint mit kleinem Gefolge, aus gewaltiger Höhe kommend, und sucht sich einen Rastort in weiten Bergmulden oder auf einer breiten Kuppe aus. Neidisch sieht die falsche Bise die Arglose sich lagern, leckt heimlich gierend am Berg empor und überfällt sie plötzlich wütend und tosend. Sie wirft der schönen Prinzessin zerfetzte schwarze Wolkenlappen entgegen, höhnt sie, krakehlt sie an, möchte sie verjagen. Eine Weile ist die Prinzessin unruhig, wartet, duldet, und manchmal steigt sie kopfschüttelnd, leise und höhnisch wieder in ihre Höhe zurück. Manchmal aber sammelt sie plötzlich ihre geängsteten Freundinnen um sich her, enthüllt ihr blendend fürstliches Angesicht und weist den Kobold mit kühler Hand zurück. Er zaudert, heult, flieht. Und sie lagert sich still, hüllt ihren Sitz weitum in blassen Nebel, und wenn der Nebel sich verzogen hat, liegen Mulden und Kuppel klar und glänzend mit reinem, weichem Neuschnee bedeckt.
In dieser Geschichte war so etwas Nobles, etwas von Seele und Triumph der Schönheit, das mich entzückte und mein kleines Herz wie ein frohes Geheimnis bewegte.
Bald kam auch die Zeit, daß ich mich den Wolken nähern, zwischen sie treten und manche aus ihrer Schaar von oben betrachten durfte. Ich war zehn Jahr alt, als ich den ersten Gipfel erstieg, den Sennalpstock, an dessen Fuß unser Dörflein Nimikon liegt. Da sah ich denn zum erstenmal die Schrecken und die Schönheiten der Berge. Tiefgerissene Schluchten, voll von Eis und Schneewasser, grüngläserne Gletscher, scheußliche Muränen, und über allem wie ein Glocke hoch und rund der Himmel. Wenn einer zehn Jahre lang zwischen Berg und See geklemmt gelebt hat und rings von nahen Höhen eng umdrängt war, dann vergißt er den Tag nicht, an dem zum erstenmal ein großer, breiter Himmel über ihm und vor ihm ein unbegrenzter Horizont lag. Schon beim Aufstieg war ich erstaunt, die mir von unten her wohlbekannten Schroffen und Felswände so überwältigend groß zu finden. Und nun sah ich, vom Augenblick ganz bezwungen, mit Angst und Jubel plötzlich die ungeheure Weite auf mich herein dringen. So fabelhaft groß war also die Welt! Unser ganzes Dorf, tief unten verloren liegend, war nur noch ein kleiner heller Fleck. Gipfel, die man vom Tale aus für eng benachbart hielt, lagen viele Stunden weit auseinander.
Da fing ich an zu ahnen, daß ich nur erst ein schmales Blinzeln, noch kein gediegenes Schauen von der Welt gehabt hatte und daß da draußen Berge stehen und fallen und große Dinge geschehen konnten, von denen auch nicht die leiseste Kunde je in unser abgetrenntes Bergloch kam. Zugleich aber zitterte etwas in mir gleich dem Zeiger des Kompasses mit unbewußtem Streben mächtig jener großen Ferne entgegen. Und nun verstand ich auch die Schönheit und Schwermut der Wolken erst ganz, da ich sah, in was für endlose Fernen sie wanderten.
Meine beiden erwachsenen Begleiter lobten mein gutes Steigen, rasteten ein wenig auf der eiskalten Kuppe und lachten über meine fassungslose Freude. Ich aber, nachdem ich mit dem ersten großen Staunen fertig war, brüllte vor Lust und Erregung laut wie ein Stier in die klaren Lüfte hinaus. Das war mein erstes, unartikuliertes Lied an die Schönheit. Ich war auf einen dröhnenden Widerhall gefaßt, aber mein Geschrei verklang in die ruhigen Höhen spurlos wie ein schwacher Vogelpfiff. Da war ich sehr beschämt und hielt mich still.
Dieser Tag hatte irgend ein Eis in meinem Leben gebrochen. Denn nun kam ein Ereignis um das andere. Zunächst nahm man mich des öfteren auf Bergfahrten mit, auch auf schwierigere, und ich drang mit sonderbar beklommener Wollust in die großen Geheimnisse der Höhen ein. Darauf ward ich zum Gaishirten ernannt. An einer von den Halden, wohin ich gewöhnlich meine Tiere trieb, gab es einen windgeschützten Winkel, von kobaltblauem Enzian und hellrotem Steinbrech überwuchert, das war mir der liebste Platz in der Welt. Das Dorf war von dort aus unsichtbar und auch vom See war nur über Felsen weg ein schmaler, blanker Streifen zu erblicken, dafür brannten die Blumen in lachend frischen Farben, der blaue Himmel lag wie ein Zeltdach auf den spitzigen Schneegipfeln und neben dem feinen Geläut der Ziegenglocken tönte ununterbrochen der nicht weit entfernte Wasserfall. Dort lag ich in der Wärme, staunte den weißen Wölklein nach und jodelte halblaut vor mich hin, bis die Gaisen meine Trägheit bemerkten und sich allerlei verbotene Streiche und Lustbarkeiten leisten wollten. Es gab dabei gleich in den ersten Wochen einen herben Riß in meine Phäakenherrlichkeit, als ich mit einer verlaufenen Gais zusammen in eine Klamm abstürzte. Die Gais war tot und mir tat der Schädel weh, außerdem ward ich jämmerlich geprügelt, lief meinen Alten davon und ward unter Beschwörungen und Wehklagen wieder eingebracht.
Leichtlich hätten diese Abenteuer meine ersten und letzten sein können. Dann wäre dies Büchlein ungeschrieben und manche andere Mühe und Torheit ungeschehen geblieben. Ich hätte vermutlich irgend eine Base geheiratet oder läge vielleicht auch irgendwo beiseit ins Gletscherwasser gefroren. Es wäre auch nicht übel. Aber alles kam anders und es steht mir nicht zu das Geschehene mit Ungeschehenem zu vergleichen.
Mein Vater tat jeweils ein wenig kleinen Dienst im Welsdörfer Kloster. Nun war er einstmals krank und befahl mir ihn dort abzusagen. Das tat ich indessen nicht, sondern entlehnte beim Nachbar Papier und Feder und schrieb einen manierlichen Brief an die Klosterbrüder, gab den der Botenfrau mit und ging auf eigene Faust in den Berg.
Nächste Woche komme ich eines Tags nach hause, da sitzt ein Pater und wartet auf denjenigen, der den schönen Brief geschrieben hat. Mir ward etwas bänglich, aber er lobte mich und suchte meinen Alten zu bereden, daß er mich bei ihm lernen lasse. Der Oheim Konrad war dazumal gerade wieder in Gunst und wurde befragt. Natürlich war er sofort dafür entflammt, daß ich lernen und später studieren und ein Gelehrter und Herr werden müsse. Der Vater ließ sich überzeugen, und so gehörte nun auch meine Zukunft zu den gefährlichen Oheimsprojekten, gleich dem feuersicheren Backofen, dem Segelschiff und den vielen ähnlichen Phantastereien.
Es ging sogleich an ein gewaltiges Lernen, zumal in Lateinisch, biblischer Geschichte, Botanik und Geographie. Mir machte das alles vielen Spaß und ich dachte nicht daran, daß das welsche Zeug mich vielleicht Heimat und schöne Jahre kosten könne. Das Lateinische allein tats auch nicht. Mein Vater hätte mich zum Bauer gemacht, wenn ich auch die ganzen viri illustres vorwärts und rückwärts auswendig gekonnt hätte. Aber der kluge Mann hatte mir auf den Grund meines Wesens gesehen, wo als Schwerpunkt und Kardinaluntugend meine unbesiegbare Trägheit hauste. Ich entrann, wo es nur gehen wollte, der Arbeit und lief statt dessen den Bergen oder dem See nach oder lag seitwärts versteckt an der Halde, las, träumte und faulenzte. In dieser Erkenntnis gab er mich schließlich weg.
Dies ist eine Gelegenheit, ein kurzes Wort über meine Eltern zu sagen. Die Mutter war ehedem schön gewesen, davon war aber nur der feste, grade Wuchs und die anmutigen, dunklen Augen übrig geblieben. Sie war groß, überaus kräftig, fleißig und still. Obwohl sie reichlich so klug wie der Vater und an Körperkraft ihm überlegen war, herrschte sie doch nicht im Hause, sondern ließ das Regiment ihrem Manne. Er war mittelgroß, hatte dünne und fast zarte Glieder und einen hartnäckigen, schlauen Kopf mit einem Gesicht, das von heller Farbe und ganz voll von kleinen, ungemein beweglichen Falten war. Dazu kam eine kurze, senkrechte Stirnfalte. Sie verdunkelte sich, so oft er die Brauen bewegte, und gab ihm ein grämlich leidendes Aussehen; es schien dann, als versuche er sich auf etwas sehr Wichtiges zu besinnen und sei selber ohne Hoffnung je darauf zu kommen. Man hätte eine gewisse Melancholie an ihm wahrnehmen können, aber niemand achtete darauf, denn die Bewohner unsrer Gegend sind fast alle von einer stetigen, leichten Trübe des Gemüts befangen, dessen Ursache die langen Winter, die Gefahren, das mühselige Sichdurchschlagen und die Abgeschlossenheit vom Weltleben sind.