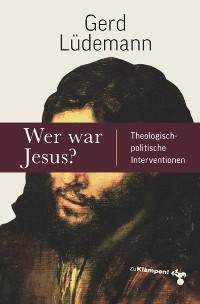Read the book: «Wer war Jesus?»

Informationen zum Buch
Die Frage nach dem historischen Jesus hat nicht nur theologische Konsequenzen, sondern auch politische. In knappen Interventionen geht Gerd Lüdemann dieser Dimension seines Wissensgebiets nach.
Informationen zum Autor
Gerd Lüdemann, Jahrgang 1946, ist Professor für Geschichte und Literatur des frühen Christentums an der Universität Göttingen. Er leitet die Abteilung "Frühchristliche Studien" am Institut für Spezialforschungen sowie das Archiv "Religionsgeschichtliche Schule" der Theologischen Fakultät Göttingen.Ihm wurde als ausgewiesenem Neutestamentler die Bezeichnung seines Lehrstuhls als Lehrstuhl für Neues Testament vom Präsidenten der Universität Göttingen als Folge der Beanstandung seiner Lehre durch die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen verboten, weil er sich in seinen Veröffentlichungen und in seiner wissenschaftlichen Arbeit kritisch mit Fragen des evangelischen Bekenntnisses auseinandergesetzt hat und die Ergebnisse seiner Forschungsarbeit den evangelischen Kirchen in Niedersachsen und der Leitung der Universität Göttingen nicht genehm sind.
Gerd Lüdemann
Wer war Jesus?
Theologisch-politische Interventionen

Impressum
© 2011 zu Klampen Verlag • Röse 21 • D-31832 Springe
info@zuklampen.de • www.zuklampen.de Titelgestaltung: »In Zeiten wie diesen« – Büro für Kommunikation, Konzept & Kreation, Hannover Konvertierung: Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH, KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
ISBN 978-3-86674-119-5
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über ‹http://dnb.d-nb.de› abrufbar.
Inhaltsübersicht
Vorwort
DER GOTT DES ALTEN TESTAMENTS
1. Gott wurde spät erfunden
2. Schwelgen in Ausrottungsphantasien
3. Intolerantes Evangelium
JESUS
4. Wer war Jesus?
5. Als Johannes der Täufer Karriere machte
6. Jede Zeit malte ihr Bild von Jesus
AUFERSTEHUNG
7. Das Grab des Gekreuzigten war nicht leer
8. Die Legende vom heiligen Grab
CHRISTLICHE JUDENFEINDSCHAFT
9. Wer war schuld am Tode Jesu?
10. Das falsche Feindbild von Judas, dem Verräter
11. Pius-Bruderschaft – Keine Zukunft mehr
PAULUS
12. Das Fundament der Kirche war nicht nur männlich
13. Der Gründer des Christentums
LUTHER UND CALVIN
14. Aus dem christologischen Tollhaus befreit
15. Eifern um Gottes Ehre
DER PAPST ALS BIBELAUSLEGER
16. Papst Benedikts Jesus-Buch: »Eine peinliche Entgleisung«
17. Jesus von Nazareth aus der Sicht des Papstes
18. Wider die Mariendogmen
19. Liebe den Gleichgesinnten wie dich selbst
DIE KIRCHEN HEUTE
20. Gott muss Werte erst erlernen
21. Gemeinschaft von Thron und Altar
22. Zwischen Dogma und Wirrwarr
23. Wie viel Zweifel ist erlaubt?
THEOLOGISCHE FAKULTÄTEN
24. Ketten des Dogmas
25. Muss ein Theologieprofessor gläubig sein?
VERSCHIEDENES
26. Der Schmerzensmann
27. Beten nach dem Tode Gottes
28. Glaube und Wissen
VORWORT
Im vorliegenden Band lege ich eine Auswahl von Essays vor, von denen die meisten in deutschen Tages- und Wochenzeitungen erschienen sind. Die Essays behandeln die Bibel und ihre Wirkungsgeschichte, das frühe Christentum und heutige kirchlich-theologische Praxis, das Verhältnis von Glaube und Geschichte. An wenigen Stellen habe ich sie leicht überarbeitet, gelegentliche Überschneidungen indes nicht künstlich ausgeglichen.
Die meisten Texte kreisen um die Frage nach Jesus von Nazareth. Diese Frage hat nicht nur theologische Konsequenzen, sondern auch politische, denn die Kirchen gründen ihre Machtansprüche bis heute auf einen mythischen Jesus, der mit dem historischen Jesus nichts zu tun hat.
Die Gelegenheit, wissenschaftliche Probleme, die mein Spezialgebiet betreffen, vor einem großen Publikum literarisch bearbeiten zu dürfen, ist für mich immer eine große Herausforderung. Ich muss auf zumeist knappem, vorgegebenem Raum präzise formulieren, meine größeren wissenschaftlichen Werke ziehen daraus auch Nutzen.
Charakter und Entstehungsgeschichte der vorgelegten Beiträge bringen es mit sich, dass jeder einzelne kurz, aber für sich verständlich ist. Dies hat den Vorteil, dass der Leser einen raschen Zugang zum Gesamtthema gewinnen kann.
Göttingen, im Januar 2011
Gerd Lüdemann
DER GOTT DES ALTEN TESTAMENTS
1. Gott wurde spät erfunden1
Das Christentum versteht sich seit alters als eine Religion, die auf den Geschichtstaten Gottes ruht, von denen im Alten und im Neuen Testament die Rede ist. In den Satz »Gott hat Israel aus Ägypten geführt und Jesus Christus von den Toten erweckt« konnten bisher die meisten Theologen einstimmen. Nun war die Auferstehung Jesu schon immer Gegenstand der Kritik auch in der Öffentlichkeit, während der Auszug Israels aus Ägypten davon verschont blieb. Doch gerade am Exodus und dem mit ihm verbundenen Thema des vorstaatlichen Israel hat sich, fast unbemerkt, eine wissenschaftliche Revolution vollzogen.
Die historisch-kritische Erforschung des Alten Testaments ist älter als 200 Jahre. Sie führte zu einer Durchforstung aller alttestamentlichen Bücher. Forscher gewannen unter anderem die bis heute verlässliche quellenkritische Erkenntnis, dass am Anfang der Bibel zwei verschiedene Schöpfungsberichte vorliegen. Dennoch hielten sich die Gelehrten an einem Punkt meistens mit der Quellenkritik zurück: Sie sahen in den ersten Büchern der Heiligen Schrift das ideale Bild von Israel, das der Gott Jahwe zu seinem Volk gemacht hat, im Kern als glaubwürdig an.
Israel in Ägypten, Moses Rolle bei dem Empfang der Zehn Gebote und die Einnahme des Gelobten Landes blieben so, bei aller Kritik im Einzelnen, historisch unangetastet. Das Blatt wendete sich aber, als man erkannte: Das in der Bibel entworfene Bild des vorstaatlichen Israel (vor 1000 v. Chr.) entspringt theologischen Fiktionen aus der nachstaatlichen Zeit (ab dem 6. Jahrhundert v. Chr.).
Archäologische Forschungen im Verein mit subtilen textlichen Beobachtungen haben diesem Paradigmenwechsel schnell zum Erfolg verholfen. Erst jetzt wurde evident: Die älteste Erwähnung Israels auf der Sieges-Stele des Pharao Merenptah, die dieser im Jahre 1208 v. Chr. aufrichten ließ, ist ein starkes Argument gegen das bisher geltende biblische Geschichtsbild.
Da die Inschrift Israel nämlich als eine Gruppe von offenbar schon länger in Palästina ansässigen Menschen erwähnt, widerspricht sie dem alttestamentlichen Bild von dem in zwölf Stämmen vereinigten Israel, das nach biblischer Chronologie ungefähr zu derselben Zeit von außen in das Land Kanaan eingedrungen ist.
Überdies beziehen sich ägyptische Dokumente – die für die Zeit, da Israel in Ägypten gewesen sein soll (14. Jahrhundert v. Chr.), reichlich fließen – weder auf Israels Aufenthalt in und Flucht aus Ägypten noch auf Mose, der gemäß biblischer Darstellung Kontakt zum Pharaonischen Königshaus hatte. Aus all dem ergibt sich kurioserweise, dass die Israeliten ursprünglich selber Kanaanäer waren.
Die ältere Forschung meinte, eine Verehrung Jahwes habe es immer nur zusammen mit dem Ersten Gebot gegeben, das die Existenz anderer Götter zwar nicht bestreitet, aber die alleinige Verehrung Jahwes befiehlt. Indes herrscht mittlerweile Konsens: Weder der Exklusivitätsanspruch Jahwes noch gar die Behauptung, außer Jahwe gebe es überhaupt keine anderen Götter, stand am Anfang des Jahwe-Glaubens. Denn für das achte vorchristliche Jahrhundert haben Inschriften in Palästina einen toleranten Jahwe-Kult belegt. Diese erst in den letzten Jahrzehnten entdeckten Quellen erwähnen zahlreiche lokale Jahwe-Götter und belegen so das Phänomen eines Polyjahwismus. Sie nennen weiter das Götterpaar Jahwe und seine Gemahlin Aschera. Demnach war eine exklusive Jahwe-Verehrung im Sinne des biblischen Moses zu dieser Zeit in Israel und Juda noch unbekannt. Erst nach dem Untergang Judas im Jahre 587 v. Chr. ersannen findige theologische Köpfe das Erste Gebot im Zuge der Deutung des Volksgeschicks. Motto: Weil Israel fremden Göttern diente und nicht Jahwe allein, musste es zur Katastrophe kommen.
Spätestens hier entsteht für den christlichen Glauben ein Dilemma. Denn die Kirche betrachtet – weil sie sich als neues Israel auffasst – von Beginn an das im Alten Testament berichtete Handeln Jahwes an Israel als festen Bestandteil der Heilsgeschichte, die zu Jesus Christus führt.
Wenn jedoch der historische Rahmen der Geschichtsbücher des Alten Testaments fiktiv ist und es sich beim biblischen Israel, ja selbst bei dem exklusiven Gott Jahwe um theologische Konstrukte des nachstaatlichen Judentums handelt, dann sind die biblische Frühgeschichte Israels und damit die Vorgeschichte Jesu Christi vollständig entleert. Sie lösen sich in Nebel auf und mit ihnen auch die Auferstehung Jesu, denn das Zentraldatum christlichen Glaubens gilt in der Theologie inzwischen auch als unhistorisch.
Diese Erkenntnisse besiegeln nicht nur den Tod des alttestamentlichen Geschichtsgottes, sondern auch das Ende des Vaters Jesu Christi. Sie nehmen aber auch dem Islam, der sich als Reform der beiden anderen Religionen versteht, sein monotheistisches Fundament.
2. Schwelgen in Ausrottungsphantasien1
Über das Jahr 2006 haben die christlichen Kirchen als Losung ein Wort aus dem Buch Josua gestellt, Kapitel 1, Vers 5. Der Gott Jahwe verspricht dort Josua, dem Nachfolger Moses, vor dem Einzug in das gelobte Land Kanaan: »Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht.«
Die Wahl dieses Spruchs als Jahreslosung lebt förmlich von der Nicht-Berücksichtigung seines biblischen Kontextes: der im Josuabuch von Gott befohlenen Vernichtung der Urbewohner Kanaans. Deren Anfang macht die Zerstörung Jerichos, beschrieben in Kapitel 6, Vers 21: »Sie vollstreckten den Bann aber an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwerts, an Mann und Frau, jung und alt, Rindern, Schafen und Eseln.« Andere Städte unterliegen derselben gräulichen Maschinerie der Ausrottung. Bei diesen Säuberungsaktionen in Jericho sowie in anderen Städten Kanaans lässt Gott Josua nicht fallen und verlässt ihn nicht.
Der große französische Bibelkritiker Ernest Renan hat seinen Abscheu vor diesen »bluttriefenden Barbarensitten« vor gut einem Jahrhundert so ausgedrückt: »Die menschliche Grausamkeit nahm die Form eines Paktes mit der Göttlichkeit an. Man legte ein feierliches Gelöbnis ab, alles zu töten, und verbot damit sich selbst, der Vernunft oder dem Mitleid Folge zu leisten. Man weihte eine Stadt oder ein Land der Vernichtung und glaubte Gott zu beleidigen, wenn man den gräulichen Eid nicht hielt.«
Immerhin hat der Bann wenig mit Rache, Hass oder Plünderung zu tun. Er ist vielmehr eine rituelle Heiligmachung mit dem Ziel, der Gottheit als Spenderin des Lebens gefangene Menschen und Tiere als Opfergaben zurückzugeben. Wer wie später König Saul den Bann brach und sich an gesundem Vieh bereicherte, wurde daher unverzüglich bestraft.
Nun hat der Heilige Krieg so, wie ihn das Josuabuch beschreibt, niemals stattgefunden. Die neuere Forschung zeigt deutlich: Die biblische Erzählung über den Auszug aus Ägypten und die Eroberung Kanaans ist keine Wiedergabe des historischen Verlaufs. Ihre Verfasser sind vielmehr politisch machtlose Theologen, die im babylonischen Exil mehr als ein halbes Jahrtausend nach dem vermeintlichen Einzug ins Gelobte Land aus Eifer für Gott in Ausrottungsphantasien schwelgen.
Jedoch besteht das Problem für uns heute gar nicht darin, ob die Erzählungen Faktum oder Fiktion sind. Ärgernis erregt, dass die rituelle Zerstörung überhaupt befohlen wird. Die Texte aus dem Josuabuch schildern die totale Abschlachtung der kanaanäischen Bevölkerung, und es gibt keine einzige Passage im Alten Testament, die den Bann kritisiert oder seine Anordnung durch Gott bestreitet. Der Bann hat einen erschreckend grundsätzlichen Charakter: Gott lässt seine Exekutoren nicht fallen und verlässt sie nicht.
Die Jahreslosung für 2006 stammt aus einem der schlimmsten Zeugnisse für die blutige Seite der Bibel, die indes nicht auf das Alte Testament beschränkt ist, wie etwa das letzte Buch der Bibel, die »Offenbarung des Johannes«, zeigt. Die Kirchenführer, die diese Losung auserkoren und aus dem Kontext gerissen haben, sollten sie daher schleunigst wieder aus dem Verkehr ziehen.
3. Intolerantes Evangelium1
Die frühchristliche Botschaft sagt eine von Gott herbeigeführte neue Epoche an. Sie begann mit dem Kommen seines Sohnes in die Welt, fand in der Auferstehung Jesu von den Toten einen vorläufigen Höhepunkt und sollte sich bei dessen Wiederkunft am Ende der Zeit vollenden. Das Evangelium, wörtlich übersetzt »Frohbotschaft«, hat Jesus Christus zur Mitte. Am Glauben daran, dass Gott ihn zum Heiland bestimmt hat, entscheiden sich Heil und Unheil der Menschen. »Wer da glaubt und getauft wird, wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden« (Mk 16,16), heißt es griffig am Schluss des ältesten Evangeliums.
Die Frohbotschaft wandelte sich unversehens zur Drohbotschaft, wenn das Angebot zur Rettung verweigert wurde. Kirchenführer setzten bald Rechtgläubigkeit mit Gehorsam gleich. Sie projizierten ein an der Unterdrückung orientiertes soziales Gefüge in den Himmel und zeigten sich von einer Kultur der Unterordnung geprägt. Vor allem der kanonische Status, durch den die Texte des Neuen Testaments zur ewigen Norm für die Kirche erklärt wurden, hat den Blick dafür getrübt, dass die »heiligen Schriften« aus massiven Machtkämpfen hervorgingen und durch sie geprägt sind.
Bis zum Ende des ersten Jahrhunderts – mit begünstigt durch die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 – hatte die Kirche sich über das ganze römischen Reich ausgedehnt, und zweieinhalb Jahrhunderte später war sie bereits Staatsreligion. Den Boden für ihren enormen Erfolg hatte das Judentum bereitet. Ihm verdankte die Kirche die hochstehende Ethik und das Alte Testament. Welch eine Ironie der Geschichte, dass die christliche Religion ihrer jüdischen Mutter keinerlei Dankbarkeit zeigte, sondern sie zusammen mit anderen Widersachern in das Reich der Finsternis verbannte. Doch erwies sie sich auch gerade darin als eine Tochter, die von der Mutter gelernt hatte. Denn Erbe Israels war auch das Bewusstsein der Erwählung und vor allem der exklusive Monotheismus, der alle anderen Formen der Verehrung Gottes oder der Götter als Götzendienst verurteilte.
Bei ihrer Mission führten die Christen die religiöse Intoleranz des Ersten Gebotes (»Ich bin Jahwe, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir«) in die griechisch-römische Welt ein. Kein Wunder, dass die rivalisierenden heidnischen Religionen, die eine große Duldsamkeit auszeichnete, der Kirche kein Paroli zu bieten vermochten. Diese konnte sich fast ungehindert durch den römischen Staat ausbreiten und war Nutznießerin von dessen toleranter Religionspolitik.
Auch hielten sich die Christenverfolgungen in Grenzen. Von der Sehnsucht nach dem Martyrium getrieben, schlugen sich die Christen oft selbst die Köpfe blutig, weil viele römische Statthalter ihnen nicht den Gefallen der Hinrichtung taten. Einmal an der politischen Macht beteiligt, wussten Bischöfe das staatliche Schwert gegen Heiden, Ketzer und Juden in einem Ausmaß zu lenken, das die Intensität bisheriger Religionsverfolgungen weit übertraf. Beidieser Unduldsamkeit blieb es bis an die Schwelle der Neuzeit.
Entgegen der populären These, dass Luthers Freiheitsverständnis von Toleranz geprägt sei, steht die Unduldsamkeit des Reformators gegenüber Katholiken, Juden, Türken, Heiden und evangelischen Ketzern fest. Die Forderung nach Toleranz erhoben Humanisten und christliche Minderheiten zunächst ohne Erfolg. Sie hat sich historisch gegen die christlichen Kirchen durchgesetzt. Und nicht zufällig verlief der Prozess so und nicht anders. Denn die Gesamtrichtung der Heiligen Schrift im Alten und Neuen Testament hat Gott und seine Herrschaft zum Ziel.
Es mag mit dieser gewalttätigen Seite des christlichen Glaubens zusammenhängen, dass im und vom christlichen Abendland aus so viele Kriege geführt wurden, obwohl »Friede« ein Grundbegriff der Heiligen Schrift ist. Indes kommt es darauf an, wie sich »Friede« – der Bibel zufolge – ereignet. Und hier lautet ihre Botschaft, dass der Herr Jesus Christus das Friedensreich durch die Macht, die ihm seit seiner Auferweckung durch Gott zu eigen ist, notfalls mit Zwang durchsetzt. Damit ist für die an ihn Glaubenden ein Gewaltpotential zugänglich gemacht, das sie guten Gewissens gegen Feinde des Evangeliums einsetzen dürfen.
Intoleranz scheint notwendig ein Wesensmerkmal der christlichen Religion zu sein. Das bekennt ein so renommierter Theologe wie Karl Barth auch ganz offen: »Kein gefährlicherer, kein revolutionärerer Satz als dieser: dass Gott Einer, dass Keiner ihm gleich ist! Wird dieser Satz so ausgesprochen, dass er gehört und begriffen wird, dann pflegt es immer gleich 450 Baalspfaffen miteinander an den Leib zu gehen. Gerade das, was die Neuzeit Toleranz nennt, kann dann gar keinen Raum mehr haben.« Es wäre daher verfehlt zu meinen, die Freiheit im allgemeinen und die Religionsfreiheit im besonderen liege in der Konsequenz der christlichen Lehre – auch wenn die »aufgeklärten« Funktionäre der Volkskirche es gern anders hätten, da nur unter dieser Voraussetzung die weitere Mitarbeit der Kirchen im säkularen Staat möglich ist.
Tatsächlich können Theologie und Kirche, welche die Bibel als Richtmaß nehmen, die Religions- und Gewissensfreiheit – Toleranz – ohne taktische Hintergedanken schwerlich gutheißen. Denn Toleranz bedeutet, die Menschenwürde auch ohne ausdrückliche oder stillschweigende Berufung auf Gott unbedingt anzuerkennen. Damit wird sich der eifernde, Gehorsam fordernde Jahwe der Bibel nie abfinden.
JESUS
4. Wer war Jesus?1
Jesus stammt vom Lande. Ein dörfliches Milieu prägt seine Predigt. Sie nennt den Sämann auf dem Acker, den Hirten mit seiner Herde, die Vögel unter dem Himmel oder die Lilien auf dem Felde. Das winzige Senfkorn im Garten wird dem Dorfmenschen Jesus zum Bild für das sichere Kommen des Reiches Gottes – für damalige Juden der zukünftige Vollendungszustand, wenn Gott allein und unbestritten als König herrschen wird.
Aufgewachsen ist Jesus mit mehr als fünf Geschwistern in dem galiläischen Ort Nazareth. Seine Muttersprache war Aramäisch, was nicht ausschließt, dass er einige Brocken Griechisch verstanden hat. Wie die meisten seiner Zeitgenossen konnte Jesus weder lesen noch schreiben. Er arbeitete als Zimmermann. In der heimatlichen Synagoge lernte er Partien aus der Thora auswendig – nicht nur viele Einzelgebote, sondern auch spannende Erzählungen von den Wunderpropheten Elia und Elisa.
Ein Blick auf den Apostel Paulus, der Jesus persönlich niemals begegnet ist, lässt die Grenzen von Jesu Umfeld erkennen. Paulus kam nicht vom Dorf, sondern war Städter. Seine Briefe, die in passablem Griechisch geschrieben sind, spiegeln das Stadtleben wider. In ihnen finden sich Hinweise auf das Rechtsleben, auf Theater und Wettspiele. Jesus dagegen hat wohl niemals ein Theater oder eine Arena gesehen. Dabei war die von griechischer Kultur geprägte Stadt Sepphoris, wo Jesus als Zimmermann Arbeit gefunden hätte, keine fünf Kilometer von Nazareth entfernt. Von Abkunft und Bildung her standen sich in Paulus und Jesus zwei verschiedenen Welten gegenüber. Bei einem Treffen hätte Paulus gegenüber einem solchen Naturburschen wie Jesus nur mit den Achseln gezuckt, dieser aber die spitzfindige theologische Argumentation des Paulus mit Kopfschütteln quittiert.
Indes stimmten trotz aller Unterschiede Jesus und Paulus in wesentlichen Punkten überein. Als Juden glaubten sie an den einen Gott, der Himmel und Erde gemacht und Israel als sein Volk erwählt hatte. Beide lebten in der Gewissheit, Jerusalem sei Mittelpunkt der ganzen Welt. An diesem Ort sollte am Ende der Tage der »Retter« erscheinen; hier befand sich das kultische Zentrum des Judentums, der Tempel. Gleichzeitig hielten die von Gott angeordneten großen Feste wie Passah, Pfingsten und Laubhüttenfest den Zyklus des Jahres zusammen. Dieses Grundgerüst religiöser Überzeugungen teilten Jesus und Paulus mit den meisten Juden ihrer Zeit.
Einen wichtigen Anstoß erhielt Jesus von Johannes dem Täufer, der in der Wüste lebte. Er stand in einer langen Reihe von jüdischen Unheilspropheten, die angesichts des bevorstehenden »Tages Gottes« zur Umkehr mahnten. Zugleich verband er seine Predigt mit der Ansage einer Sündenvergebung, die jenen zuteil werden sollte, die sich von ihm taufen ließen. Damit sei gewährleistet, dass sie dem bevorstehenden Endgericht entgehen könnten. Seine Verkündigung zündete wie der Blitz und führte zahlreiche Juden, darunter Jesus, zu ihm an den Jordan.
Die Mitglieder der Priesteraristokratie in Jerusalem dürften über den Sonderling am Jordan und seine Anhänger irritiert gewesen sein. Hatte Gott nicht ihnen allein den Tempeldienst, der Sühne und Sündenvergebung bewirkte, anvertraut? Für die Machthaber wurde es spätestens dort brenzlig, wo Johannes« Gerichtspredigt auf den politischen Bereich übergriff. Dies bekam der Landesherr Jesu, Herodes Antipas, zu spüren, als Johannes dessen thorawidrige Eheschließung mit einer Verwandten anprangerte. Daraufhin ließ Antipas den Täufer kurzerhand als einen Aufrührer hinrichten.
Wie lange sich Jesus in der Umgebung des Täufers aufgehalten hat, bleibt unklar. Doch zeigt die in den Evangelien sichtbare Rivalität zwischen Jesus- und Johannesjüngern, dass Jesus schon bald nach seiner Taufe durch Johannes eigene Wege gegangen sein muss. Dieser Aufbruch war bei Jesus mit zweierlei verbunden: Ihm behagte auf Dauer die asketische Grundhaltung des Johannes nicht. Ferner entdeckte Jesus in sich die Fähigkeit, Besessene zu heilen. Dies wertete er gegenüber seinen Jüngern als untrüglichen Beweis dafür, dass unter ihnen das Reich Gottes, jene Verwirklichung der reinen Theokratie, vorab präsent sei. O-Ton Jesus: »Wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen.«
Jesu Wunderkraft sprach sich in Galiläa bald herum. Die Exorzismen, durch die er psychisch Kranke gesund machte, sind die am besten bezeugten »Wunder« im Neuen Testament. Nerven- und Geisteskrankheiten wurden damals auf die Besessenheit von Dämonen zurückgeführt. Als Oberster dieser bösen Geister galt Satan. Ihn sah Jesus laut eigenem Zeugnis »wie einen Blitz aus dem Himmel fallen«. Damit war die Überwindung Satans, die fromme Juden erst von der Zukunft erwarteten, im Umkreis Jesu bereits gegenwärtige Realität. Jesus heilte Männer, Frauen, Kinder und entriss sie – mythologisch gesprochen – Satans Herrschaft, die keine mehr war.
Das Reich Gottes zeigte sich Jesus zufolge vorab nicht nur in seinen Heilungen – es schlug sich auch in Jesu Gewissheit nieder, am bald eintretenden Ende der Zeiten werde ein von ihm ausgewählter Zwölferkreis von Jüngern als Repräsentant des »wahren« Israel das übrige Israel richten. Diese Erwartung verband sich bei ihm aber nicht mit der Sicht, dass er als Messias oder Menschensohn der kommende Retter sei. Vielmehr ging es ihm darum, dem Reich Gottes den Weg zu bahnen.
Jesu Leben war in seiner entscheidenden Phase geprägt von dem felsenfesten Glauben, im Namen Gottes dessen Gesetz vollgültig auslegen zu müssen. Zu weiten Teilen war seine Thorainterpretation als Verschärfung des Willens Gottes wahrzunehmen. So verbot er die Ehescheidung mit Hinweis auf die gute Schöpfung Gottes, bei der Mann und Frau in der Ehe unwiderruflich ein Fleisch geworden seien. Das Liebesgebot spitzte er auf die Forderung der Feindesliebe zu. Das Schwören verbot er. Ab und zu reduzierte er die Thora und setzte dadurch die Speisegebote faktisch außer Kraft. Aber all das, was nach Autonomie aussah, war gegründet in Theonomie. Jesus konnte diese freien und gleichzeitig radikalen Interpretationen des Gesetzes nur durchführen, weil er meinte, dazu von Gott, den er liebevoll mit »Abba« (= Papa) anredete, die Vollmacht erhalten zu haben.
Exorzist, Gesetzesausleger und Zukunftsprophet war er, gleichzeitig aber auch Dichter und Weisheitslehrer. Jesus erzählte spannende Geschichten von Betrügern und sah in ihrer realistischen Einschätzung der jeweiligen Situation ein Vorbild für sich und seine eigenen Jünger. Das Leben Jesu in dieser Phase ähnelte dem eines unmoralischen Helden. Jesus arbeitete nicht mehr, was für einen jüdischen Lehrer untypisch war, und verlangte von seinen Jüngern, seinem Beispiel zu folgen. Er selbst ließ sich von seinen Verehrern aushalten.
In seine Erzählungen waren Klugheitsregeln eingebettet, die man eher von Philosophen erwartet hätte. In Gleichnissen veranschaulichte er, wie Gott sein Reich herbeiführen werde, nämlich leise und gleichzeitig doch unwiderruflich. Wieder andere Gleichnisse legen schlagend dar, dass Gott das Verlorene sucht. Jesus lieferte in seinem Leben den Kommentar dazu: Er war oft zu Gast bei Zöllnern und Huren. Manchmal bekamen seine Gleichnisse auch einen drohenden Klang: Im endzeitlichen Gericht, unmittelbar vor der Errichtung seines Reiches, vernichte Gott seine Feinde. Dann wende er das Schicksal der Armen, Hungernden und Weinenden zum Guten, zum heilvollen Vollendungszustand, wie die Seligpreisungen der Bergpredigt schlagend darlegen.
Jesus hatte in Galiläa Erfolg. Viele Menschen waren ihm zugetan. Nun zog es ihn nach Jerusalem, um Volk und Führung zur Umkehr aufzurufen. Als er offen Kritik an den im Tempel herrschenden Zuständen äußerte, hatte er in den Augen der jüdischen Führung die Tabugrenze überschritten. Was nun folgte, war nichts im Vergleich zu den Wortwechseln zwischen Jesus und seinen Kritikern in Galiläa. Die Jerusalemer Lokalaristokratie verleumdete Jesus – der doch von Gott allein die Errichtung seines Reiches in naher Zukunft erwartet hatte – als politischen König Israels. Damit war sein Schicksal besiegelt, und Pilatus machte kurzen Prozess. Aber auch Jesu Traum vom Reich Gottes erfüllte sich nicht, sein Leben endete im Fiasko am Kreuz.
An Stelle des Reiches Gottes aber kam die Kirche. Nicht lange nach dem Schock von Karfreitag behaupteten die engsten Jünger, sie hätten Jesus »gesehen«; dieser sei von den Toten erweckt worden und habe auf Petrus (= Stein) seine Kirche gegründet. Als auferstandener Gottessohn erteile er ihnen persönlich Weisungen. Fortan war nicht mehr das Kommen des Gottesreiches zentral; vielmehr rückten die Wiederkunft des auferstandenen Jesus und seine geheimnisvolle Gegenwart bei den Mahlfeiern in den Mittelpunkt. Urplötzlich beanspruchte Jesus Würdetitel, die er zu seinen Lebzeiten abgelehnt hatte: er nannte sich »Herr«, der allen Herren dieser Welt überlegen sei, »Menschensohn«, der auf den Wolken des Himmels zum Endgericht erscheine, »Gesalbter«, der zur Rechten Gottes sitze. Die dogmatische Lehre über Christus (»Christologie«), die alle Vollmachtsansprüche des historischen Jesus deutlich übertraf, war damit geboren. Sie rückte den historischen Jesus, der zwischen sich und Gott deutlich unterschieden hatte (»niemand ist gut außer einem einzigen, nämlich Gott«), in die Nähe Gottes, ja setzte beide gleich (»ich und der Vater sind eins«).
Wusste sich Jesus allein zu seinen jüdischen Zeitgenossen gesandt, so erweiterte sich das Blickfeld der Kirche rasch gewaltig. Zur aramäisch sprechenden Urkirche stießen bald griechischsprachige Juden – die den Mann aus Nazareth nicht einmal persönlich kannten – und trugen die christliche Botschaft zu den Heiden. Ihr berühmtester Schüler und einstiger Verfolger, der Expharisäer Paulus, »sah«, ebenso wie die engsten Jesusjünger vor ihm, den Auferstandenen und fühlte sich von diesem zum Apostel der Heiden berufen. Dieser jüdische Gelehrte gab der Heidenmission den entscheidenden Impuls, indem er sie im großen Stil organisierte und schrifttheologisch begründete. Motto: Die heilige Schrift Israels ist ein rein christliches Buch, die das Kommen Jesu und der Kirche im Voraus angekündigt hat.
War es schon eine Tragödie, dass der historische Jesus in Jerusalem einer politischen Intrige zum Opfer fiel, so gilt das gesteigert von der Art und Weise, wie die ersten Christen Jesu Predigt vom Gottesreich zur Lehre von der Gründung der Kirche durch den »Auferstandenen« verfälschten. Bis heute haben sie darin fromme Nachfolger gefunden.