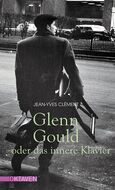Read the book: «Was mich umtreibt»
GALEN STRAWSON
Was mich umtreibt Tod, Freiheit, Ich …
Philosophische Essays
Aus dem Englischen
von Wera Elisabeth Homeyer

Inhalt
Vorwort
Einleitung
1Das Bewusstsein vom Ich
2Ein Irrtum unserer Zeit
3Ich habe keine Zukunft
4Alles eine Frage des Glücks
5Wie man ist, dazu kann man sich nicht machen
Ein Gespräch mit Tamler Sommers
6Die dümmste Behauptung
7Wahrhafter Naturalismus
8Das ungeschichtliche Leben
9Two Years’ Time
Anmerkungen
Vorwort
Die meisten der vorliegenden Arbeiten sind Versuche, Gedankengänge besser darzulegen, mit denen ich mich ursprünglich an ein Publikum professioneller Philosophen gewandt hatte. Den ersten Essay schrieb ich 1995, den letzten 2016. Zwei Essays erschienen im London Review of Books («Das Bewusstsein vom Ich» 1996 und «Wahrhafter Naturalismus» 2013), weitere zwei in The Times Literary Supplement («Alles eine Frage des Glücks» 1998 und «Ein Irrtum unserer Zeit» 2004). «Wie man ist, dazu kann man sich nicht machen» erschien zum ersten Mal im März 2003 in The Believer; thematisch stimmt dieser Essay zum Großteil mit «Alles eine Frage des Glücks» überein, er ist jedoch weniger formal. «Die dümmste Behauptung» ist eine Kurzfassung des 2017 am Wolfson College in Oxford gehaltenen Isaiah Berlin-Vortrags unter dem Titel «A Hundred Years of Consciousness: A Long Training in Absurdity». «Das ungeschichtliche Leben» wurde für die von Zachary Leader herausgegebene Sammelschrift On Life-Writing verfasst, die 2015 bei Oxford University Press erschienen ist. Eine Kurzfassung von «Ich habe keine Zukunft» erschien in Philosophy Now im Jahr 2007. «Two Years’ Time» wurde 2016 in der Zeitschrift Areté unter dem Titel «Whisper, Memory» veröffentlicht.
Die meisten Essays habe ich geringfügig überarbeitet und Zitate aus anderen Arbeiten übernommen. Sie sind nicht zusammenhängend, stehen aber im Hinblick auf einige wichtige Aspekte in einer äußerst nützlichen Beziehung zueinander. Mein besonderer Dank gilt Edwin Frank bei New York Review Books, der mich dazu ermuntert hat, die Essays zusammenzustellen und gemeinsam in einem Band zu veröffentlichen. Thematisch überschneiden sie sich in gewissen Punkten direkt, was sicherlich stören würde, wäre das Buch dazu bestimmt, an einem Stück gelesen zu werden; das ist es aber nicht. Die Quellenangaben zu den zahlreichen Zitaten liefere ich am Ende des Buches.
Vor zwanzig Jahren waren Arbeiten zu breit angelegten Themen rar und oftmals schwer zugänglich. «Things are different today» («Heute sehen die Dinge anders aus»), um mit Mick Jaggers zeitlosen Worten zu sprechen. Bulletins über den Tod, die Ewigkeit, das Bewusstsein, die Willensfreiheit, die Liebe, das Gedächtnis, die Wahrheit, die Existenz, das Selbst und den Kosmos treffen täglich in den E-Mail-Accounts ein. Viele von ihnen sind mitreißend, fundiert und kenntnisreich. Manchmal fühlt man sich allerdings förmlich überschwemmt. «Es gibt einfach zu vieles, um darüber nachzudenken.» Das von Saul Bellow beklagte «schwachsinnige Inferno» der Mainstream-Kultur ist schon schlimm genug, das sophistizierte Dampfbad sofort verfügbarer Hochkultur ist nicht immer besser. Steigt der Druck, gilt es noch immer, so seltsam restaurativ dies auch erscheinen mag, sich der Worte zu erinnern, die Descartes 1642 schrieb: «Es ist dem Individuum unmöglich, die große Anzahl neuer Bücher zu studieren, die jeden Tag veröffentlich werden.»
Ich habe mich mit vielen, vielen Menschen unterhalten oder mit ihnen korrespondiert. Sie haben mir geholfen, über diese Themen nachzudenken. Darunter Miri Albahari, Andrea Ashworth, David Auerbach, Anita Avramides, Julian Barnes, Barry Dainton, Daniel Dennett, Rosemary Dinnage, Francis Duncan, Owen Flanagan, Jerry Fodor, Helen Frowe, Rebecca Goldstein, Mark Greenberg, Simon Halliday, Paul Harris, Aaron Hauptman, Robyn Hitchcock, Mark Johnston, Jean Knox, Robert Kuhn, Douglas MacLean, Avishai Margalit, Annalena McAfee, Ian McEwan, Michelle Montague, Iris Murdoch, Thomas Nagel, Redmond O’Hanlon, Derek Parfit, David Pears, Philip Pettit, Antonia Phillips, Amélie Rorty, John Ryle, Marya Schechtman, Claude Silvestre, Michael Smith, David Sosa, Patrick Stokes, P. F. Strawson, Charles Taliaferro, Rosemary Twomey, Samantha Vice, Kathy Wilkes, Susan Wolf, Paul Woodruff, und Dan Zahavi.
Ich danke Susan Barba, Daniel Drake, Sara Kramer sowie Gregory Nipper für ihre professionelle Hilfe bei der Nachbearbeitung und in den verschiedenen Phasen des Korrekturlesens.
Einleitung
Manche Menschen bekommen schon sehr früh einen Begriff von Unendlichkeit. Vor allem bei kleinen Kindern mit einer Vorliebe für Zahlen ist dies durchaus nicht ungewöhnlich – erst kürzlich konnte ich das bei einem meiner Enkel beobachten. Ein Leben lang bleibt die Unendlichkeit verstörend für uns Menschen, insbesondere, wenn sie als Ewigkeit verstanden wird und, was unweigerlich geschieht, zum Gedanken an den Tod weiterführt. Doch gerade als Kinder trifft uns diese Erkenntnis mit großer Wucht, wie ich aus eigenem Erleben bestätigen kann. Obwohl es keinen Todesfall in meiner Familie gegeben hatte und meine Freundin aus Kindertagen (mit fünf Jahren hatten wir uns «verlobt») auch erst sehr viel später durch einen tragischen Unfall ums Leben kommen sollte, hatte ich seit meinem vierten Lebensjahr panische Angst vor dem Tod. Als ich mit 22 Monaten ganze drei Tage ohne Besuchserlaubnis meiner Familie im Krankenhaus verbringen musste, kam mir dies schier unendlich vor. (Es half auch nichts, dass man mir sagte, dass meine Eltern sonst ernstlich erkranken könnten.) Das areligiöse Umfeld, in dem ich aufwuchs, war für eine Bewältigung dieser Angst auch nicht gerade zuträglich. Am schlimmsten jedoch litt ich in meiner Kindheit unter dem Umstand, dass ich kaum schlafen konnte – zum einen, weil ich ein ungemütliches Armeebett im Dachzimmer eines großen, kalten Hauses mein Eigen nannte, vor dessen Tür sich obendrein ein feuerverzinktes Ungetüm von einem Wassertank befand, zum anderen, weil alle Übrigen weit weg waren. Mein Bruder und meine Schwester schliefen in dem Stockwerk unter mir und meine Eltern sogar zwei Treppenfluchten (21 Stufen und noch einmal 16 Stufen) tiefer. So lag ich Nacht für Nacht allein in der Dunkelheit wach und dachte über den Tod nach, über die zukünftige ewig währende Nicht-Existenz meiner selbst, und noch viel schlimmer, meiner gesamten Familie. (Auf S. 93 werde ich kurz darauf eingehen.) Sehr viel später habe ich während einer kurzen Psychotherapie meinem Therapeuten gegenüber geäußert, ich sei «mit dem Tod aufgewachsen», was etwas melodramatisch klingt, aber in gewisser Weise durchaus zutrifft. Bis ins junge Erwachsenenalter hinein beschäftigte mich das Thema Tod nachhaltig. Der Friedhof St. Giles lag nur ein paar hundert Meter von unserem Haus in Oxford entfernt. Und obwohl ich ja wusste, dass es für die unendliche Dauer des Totseins, also der Nicht-Existenz, keinen Unterschied macht, beunruhigte es mich stark, dass auf dem Friedhof offensichtlich kein Platz mehr war. Ich wünschte mir, wenn es schon für eine so lange Zeit sein müsste, wenigstens an einem Ort gemeinsam mit meiner Familie begraben zu sein.
Wie vielleicht alle Kinder, sehnte ich mir, als ich noch sehr klein war, eine gute Fee herbei, die mir jedweden Wunsch erfüllen könnte. Ich wusste bereits aus den mir bekannten Märchen, dass es wohl wenig klug wäre, alle meine zukünftigen Wünsche von dieser Fee erfüllen zu lassen, denn wenn sich etwas rächt, dann Habgier. So wünschte ich mir also ausschließlich, endlich schlafen zu können, wann immer ich wollte – auch wenn es noch so verlockend erschien, sich eine Süßigkeiten-Maschine herbeizaubern zu lassen.
Eine kindliche Fixierung auf den Tod ist zwar eine Besonderheit, ungefähr so, wie als Linkshänder oder mit roten Haaren geboren zu werden, aber nicht unbedingt außergewöhnlich, wie ich 1974 herausfinden sollte, als mir das Buch The Discovery of Death in Childhood and After von Sylvia Anthony in die Hände fiel. Bereits Dreijährige können sich des Todes sehr bewusst sein. In den späten Siebzigerjahren, meine Tochter war ungefähr drei, hatte einer ihrer Spielkameraden mit starken Todesgedanken zu kämpfen. Im Gegensatz zu mir war er jedoch in der Lage, seinen Ängsten offen Ausdruck zu geben. Wurde die Angst des Nachts zu groß, schrie ich manchmal. Kamen dann meine Eltern zu mir, was durchaus nicht immer der Fall war und lang anhaltendes Weinen erforderte, behielt ich alles für mich und erfand schnell einen Albtraum, in dem ich von Wölfen verfolgt wurde. Ein Grund dafür, dass ich meinen Eltern die Gedanken über Tod und Ewigkeit nicht anvertrauen konnte, war sicherlich, dass ich tief im Innern bereits wusste, dass ich richtig lag, und dies nicht auch noch aus ihrem Mund bestätigt wissen wollte. Vergeblich versuchte ich dann, die Ritterfiguren von meiner Zimmertapete zu meiner Verteidigung einzusetzen – auch sie waren nicht gegen die Ewigkeit gewappnet. Immer wieder erfand ich eine Geschichte von einem kleinen Jungen, der mit seiner Mutter in einem rot-weiß gepunkteten Fliegenpilz wohnte, nur um meine Gedanken vom Tod abzulenken. An viel erinnere ich mich nicht mehr, aber meine Einbildungskraft reichte nie lang genug aus, um alles Düstere aus meinen Gedanken zu verbannen.
Der Tod war also eines der ersten Themen (und damit meine ich die eigentlichen, großen Themen, Fragen «kosmischer Ordnung», nicht Dinge wie die Größe meiner Ohren oder die Gepäckausgabe in Heathrow), die mich nachhaltig beschäftigten, und doch nimmt er in diesem Buch nur einen marginalen Platz ein. Seither bin ich mein Leben lang ein Mensch geblieben, der von Besorgnis umgetrieben wurde, und damit bin ich nicht allein. Wir alle sind im «kosmischen Sinne» verstört, sobald wir uns nicht ausschließlich darum kümmern müssen, zu überleben, es warm zu haben oder uns zu ernähren, wie es leider viel zu vielen Menschen auf dieser Welt ergeht. Natürlich sind einige Menschen in höherem Maße besorgt als andere, aber dies kann allein der Tatsache geschuldet sein, dass wir mehr Zeit dazu haben, uns Gedanken zu machen. Vielleicht haben wir nur deshalb mehr Zeit, weil wir «Schlaflose» sind. Besäße ich ein magisches, unfehlbares Instrument zum Messen meiner Betroffenheit, einen «Sorgometer», ich läge bestimmt oberhalb der 85 Prozent – wie weit darüber, vermag ich nicht zu sagen –, und doch mäße dieser «Sorgometer» nur die bewussten, offen zutage tretenden Ängste.
Die hier zusammengestellten Texte beschäftigen sich mit der Freiheit des Willens, dem Bewusstsein, dem Tod, aber auch damit, was es bedeutet, als Philosoph ein wahrhafter «Naturalist» zu sein, einer, der an nichts Übernatürliches glaubt. Sie handeln von der Idee des Ichs, dem Bewusstsein, ein Selbst zu sein oder eines zu besitzen; von diesem Selbst in der Zeit, vom Narrativen im Leben und en passant von menschlicher Leichtgläubigkeit ohne Grenzen. Bei den Kapiteln, welche das «Narrative», also das «Erzählerische» abhandeln («Ein Irrtum unserer Zeit» und «Das ungeschichtliche Leben») schwingt etwas Polemik mit, denn ich schrieb sie gegen den anscheinend allgemein verbreiteten Konsens, dass jeder, der sein Leben in irgendeiner Form «anpasst», notwendigerweise auch ein «narratives» Leben führt. Meines Erachtens liegt dieser Sicht eine schwerwiegende, ja sogar schädliche Fehleinschätzung zugrunde. Es berührt mich immer noch zutiefst, wie viel Dankbarkeit mir im Laufe der Jahre dafür entgegengebracht wurde, dass ich dem meine eigene Position entgegengesetzt habe. All jene Menschen bestätigten mir, dass sie sich immer irgendwie «falsch» gefühlt hätten, nicht in der allgemein anerkannten «narrativen» Art zu leben. Ihr Echo macht all die Feindseligkeiten wett, die ich durch Verfechter des «Pro-Narrativen» erfahren musste. (Was bedeutet es überhaupt, «narrativ» zu leben? Ich weiß es bis heute nicht, und ich glaube, ich kann auch keinen besseren Erklärungsversuch unternehmen als auf den Seiten 255f.)
Vor rund zehn Jahren, kam es mir in den Sinn, dass meine «nicht-narrative» Sicht des Lebens (wie auf den Seiten 65-68 erläutert) in der 1995 begonnenen Einnahme des Antidepressivums Fluoxetin begründet liegen könnte. Zumindest könnte dies jemand mutmaßen, der nicht daran glaubt, dass ein Mensch von Natur aus überhaupt in der Lage ist, eine «ungeschichtliche» Sicht auf das Leben zu haben. Zu keinem Zeitpunkt war ich selbst jedoch von der Richtigkeit dieser Annahme überzeugt, denn ich kannte zahlreiche Personen, die trotz der Einnahme von Fluoxetin eine stark narrative Sichtweise beibehielten. Einige Jahre später stieß ich auf einen Tagebucheintrag aus dem Juli 1994, einer Zeit, lange bevor ich mich mit diesem Thema befasst hatte: «Nichts Narratives, keinerlei Entwicklung in meinem Leben. Es scheint mir, mein Leben habe keine weitere Ausdehnung als über den jeweiligen Moment hinaus – dass ich eine Person bin, die von einem Tag zum anderen fortbesteht. Zum Teil traf dies wohl schon immer zu, es hat sich allerdings in letzter Zeit gravierend verstärkt. Was den einzelnen Tag überdauert und ihn mit dem folgenden verbindet, sind Probleme oder noch zu erledigende Dinge. Sie halten mein Leben zusammen. Ich besitze nicht wirklich ein Selbst. Ich denke, im Vergleich zu anderen, entspricht das der Wahrheit.» Manch einem mag es seltsam erscheinen, dass eine Person zutiefst von der Vorstellung des Todes verängstigt sein kann, ohne das eigene Leben wirklich als «Lebensgeschichte» zu begreifen. Eigentlich ist die Erklärung recht einfach, sie bedarf allerdings auch einer näheren Erläuterung, da die Diskussion um das «Narrative» oft recht konfus geführt wird.
Für alle «Nicht-Narrativen» sind Søren Kierkegaards Schriften Inbegriff der irrigen Annahme, dass nur ein strikt auf die eigene Geschichte gerichtetes Leben dem Urteil der Unendlichkeit standhält. Kierkegaard postuliert, dass es absolut notwendig sei, sich selbst im Blick zu behalten. In Die Krankheit zum Tode, unter dem Pseudonym Anti-Climacus veröffentlicht, schreibt er: «Im Grunde kommt jeder in der Ewigkeit so an, dass er die genaueste Anzeige auch von jeder geringsten Kleinigkeit, die er verübte oder unterließ, selbst mitbringt und abliefert.» Jeder habe also «bis ins kleinste Detail» Rechenschaft über sein Leben abzulegen.
Johann Wolfgang von Goethe bietet ein erstes Gegenargument:
«Nehmen wir sodann das bedeutende Wort vor: ‹erkenne Dich selbst›, so müssen wir es nicht im asketischen Sinne auslegen. Es ist keineswegs die Heautognosie (i.e. Selbst-Erkenntnis) unserer modernen Hypochondristen, Humoristen und Heautontimorumenen (i.e. Masochisten) damit gemeint; sondern es heißt ganz einfach: gib einigermaßen Acht auf Dich selbst, nimm Notiz von Dir selbst, damit du gewahr werdest, wie Du zu Deinesgleichen und der Welt zu stehen kommst. Hierzu bedarf es keiner psychologischen Quälerei, jeder tüchtige Mensch weiß und erfährt, was es heißen soll; es ist ein guter Rat, der einem Jeden praktisch zum größten Vorteil gedeiht.»
In ihrem Buch The Sovereignty of Good untermauert Iris Murdoch diese These. Sie stellt die Idee der Selbst-Erkenntnis als Befreiung infrage und bringt ihr ein tiefes Misstrauen als «Mechanismus der Phantasie» entgegen. Ihrer Auffassung nach kontrolliere dieser Mechanismus unser ethisch-emotionales Welt-Verständnis:
«Selbst-Erkenntnis im Sinne eines minutiösen Verstehens des eigenen ‹Apparats›, erscheint mir, bis vielleicht auf sehr rudimentärem Niveau, meistens enttäuschend … Es ist nicht die Untersuchung des ‹Phantasie-Apparats› selbst, die befreiend wirkt, sondern etwas außerhalb desselben Gelegenes. Eine eingehende Betrachtung des ‹Phantasie-Apparats› fungiert wohl eher als Wirkungsverstärker.»
Albert Camus bringt dies wie folgt auf den Punkt – und damit stimmen wohl auch religiös eingestellte «Narrative» überein:
«Denn wenn es eine Sünde gegen das Leben gibt, so besteht sie vielleicht nicht so sehr darin, an ihm zu verzweifeln, als darin, auf ein anderes Leben zu hoffen und sich der unerbittlichen Größe dieses Lebens zu entziehen.»
Auch in den beiden Essays, in denen ich mich mit der Frage nach dem Bewusstsein beschäftige, klingt durchaus eine gewisse Polemik an. (In «Die dümmste Behauptung» und weniger direkt in «Wahrhafter Naturalismus»). Polemik deshalb, weil ich die aktuelle Debatte zutiefst deprimierend finde. Auf beiden Seiten sind die Fronten verhärtet und es besteht kaum Offenheit für die Argumente der jeweils anderen. Da sind zum einen diejenigen, die, so wie ich selbst, wissen, dass Bewusstsein existiert, und die von Grund auf respektieren, dass wir genau wissen, was dieses Bewusstsein ist und dass nichts im Leben mit größerer Gewissheit existiert. Ihnen gegenüber stehen die Zweifler, die all dies negieren oder doch zumindest zum Teil ablehnen, auch wenn sie selbst das nicht unbedingt so von sich behaupten würden – zwecklos, jemanden aus dieser Liga überzeugen zu wollen, man wird noch nicht einmal Gehör finden. Trotzdem möchte ich drei Dinge mit Nachdruck klarstellen:
Erstens ist es absolut inkohärent, einzuräumen, dass Bewusstsein zwar «irgendwie» existiert, gleichzeitig aber die Realität von Bewusstsein anzuzweifeln oder gar zu verneinen. Zweitens gibt uns auch die Naturwissenschaft keinerlei Grund, auf irgendeine Weise anzuzweifeln, dass bewusste Erfahrungen etwas anderes sind, als sie zu sein scheinen; vor allem das subjektive Erleben in all seiner Vielfalt und Fülle von Geruch, Geschmack, Fühlen, Sehen, Hören, Denken und Emotionen. Drittens kann auch die Naturwissenschaft nicht widerlegen, dass bewusste Erfahrungen etwas zutiefst Physisches sind, ebenso physisch wie die Erdanziehungskraft, wie Bewegung oder Elektrizität. Bei diesem dritten Punkt bedarf es einer gewissen Erklärungsarbeit, da viele von uns einen blinden Fleck entwickelt haben, wenn es darum geht, was überhaupt als physisch begriffen werden kann. Aber der Schlüssel zur Erklärung ist einfach: Wir haben keine Kenntnis darüber. Wie kommen wir dann dazu, zu denken, wir wüssten mehr über die eigentliche Natur des Physischen, als es in Wahrheit der Fall ist?
Nirgends jedoch scheiden sich die Geister so sehr wie an der Frage nach dem freien Willen. Wenngleich diese Fragestellung eine der ältesten der Menschheit überhaupt ist, erfährt man wohl schwerlich sonst so viel Ablehnung, wie wenn man das Fehlen der Willensfreiheit postuliert. Man wird von Hass-Briefen förmlich überschwemmt, äußert man sich nur in diese Richtung. Einige dieser Nachrichten sind hässlich, andere bedrohlich, doch allesamt sprechen sie für die Stichhaltigkeit des Arguments. Eine zehn Jahre alte Mail bewahre ich noch immer: «Ich möchte Ihnen nur sagen, dass Sie wohl der bescheuertste Idiot überhaupt sind und dass dies das schlimmste, zusammenhangloseste und absurdeste philosophische Argument ist, das ich je gelesen habe. Schreiben Sie nicht – nie wieder!»
Es fällt schwer, dies nicht als Bestätigung zu werten. Die Heftigkeit, die einem aus diesen Äußerungen entgegenschlägt, spricht dafür, dass die Schreiber die Berechtigung des Arguments durchaus anerkennen, und dies lässt ihren Ärger etwas deplatziert erscheinen. Stimmen sie im Grunde mit uns überein? Und warum machen sie uns dies dann zum Vorwurf? Und sollten sie denken, dass wir falsch liegen, warum dann dieses Gefühl der Beleidigung? Was wohl hätten sie Einstein erwidert, als er äußerte: «Würde ein Wesen von höherer Intelligenz und Einsicht den Menschen und sein Handeln betrachten, so müsste es unweigerlich über die menschliche Illusion, nach freiem Willen zu handeln, schmunzeln.» (Auf S. 122 zitiere ich diese Passage noch ausführlicher).
Der letzte der hier aufgenommenen Texte handelt von meinen Erfahrungen in den 1960er-Jahren – die mich nicht umtreiben. Als Craig Raine, Herausgeber des literarischen Magazins Areté, dem verlegerischen Äquivalent zu Thompson’s Hound of Heaven, mich bat, meine Erinnerungen an diese Zeit niederzuschreiben, war ich daran absolut nicht interessiert und versuchte auf jede erdenkliche Weise, drum herumzukommen. Ich fragte seine Tochter, die Dramatikerin Nina Rain, wie ich wohl der Forderung ihres Vaters entgehen könne, worauf sie mir schlicht antwortete: «Kannst du nicht.»
Ich empfinde Philosophie – und damit meine ich Philosophie in ihrem umfassendsten Sinne – als eine zutiefst konkrete, sinnliche Aktivität, und damit stehe ich nicht allein. Die Welt der Ideen erscheint mir genauso plastisch wie die Welt der Seen und Berge, ja sogar in noch stärkerem Maße. Die Topographie der geistigen Welt lässt sich ebenso wenig ändern wie man Samarkand in größere Nähe zu Buchara versetzen könnte, selbst wenn man neue Perspektiven entdecken kann oder feststellt, dass man die Landkarte falsch gezeichnet hat oder der Mensch die Erde lange Zeit für eine Scheibe hielt. Ideen besitzen in der Welt des Geistes die gleiche Körperlichkeit in ihrer Ausdehnung, ihrer natürlichen Begrenzung und in ihrem Panorama. Man kann sie berühren. Sie besitzen einen individuellen Geschmack, ästhetische Eigenschaften, emotionale Schattierungen, Kurven, Oberflächen, Innenseiten, versteckte Plätze, Struktur, Geometrie, dunkle Gänge, lichtvolle Plätze, Auren, Kraftfelder und sie sind kombinationsfähig.
Mit den Worten Bertrand Russells: «Reisen ist ein Vergnügen, sowohl in der geistigen als in der physischen Welt, und es ist gut, zu wissen, dass wenigstens in der geistigen Welt es weite Gebiete gibt, die noch sehr unvollkommen erforscht sind.»