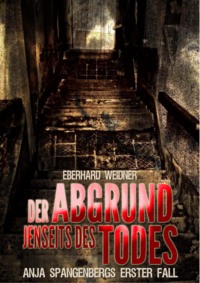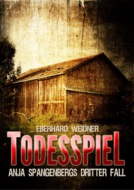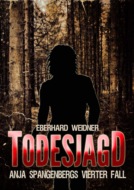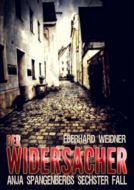Read the book: «DER ABGRUND JENSEITS DES TODES»

INHALTSVERZEICHNIS
COVER
TITEL
PROLOG
DER ERSTE REITER
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
DER ZWEITE REITER
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
DER DRITTE REITER
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
DER VIERTE REITER
KAPITEL 11
KAPITEL 12
EPILOG
NACHWORT
WEITERE TITEL DES AUTORS
LESEPROBE
1. TEIL
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
PROLOG
I
Was ihr von Anfang an besonders an ihm gefiel, war seine sanfte und mitfühlende Art. Deshalb dachte Nadine zunächst auch, er müsste schwul sein. Aber das war ihr egal, denn nach einem Liebesabenteuer stand ihr ohnehin nicht der Sinn.
Nicht nach der furchtbaren Diagnose, die der Arzt ihr soeben mitgeteilt hatte.
Er stand vor dem Eingang der radiologischen Praxis in der Maistraße. Beinahe kam es ihr so vor, als hätte er dort auf sie gewartet.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte er.
Sie musste blinzeln, weil ihre Augen in Tränen schwammen. Erst dann erkannte sie ihn.
»Sie? Was machen Sie denn hier?«
»Ich habe auf Sie gewartet.«
»Aber … Aber warum?«
»Ich dachte mir, dass Sie jetzt bestimmt jemanden brauchen, der sich um Sie kümmert.« Er deutete auf das Praxisschild, auf dem »RPM – Radiologische Praxis München« und die Öffnungszeiten standen. »Schlimme Neuigkeiten?«
Um das zu erkennen, musste man weder Hellseher noch Gedankenleser sein. Vermutlich genügte ein einziger Blick in Nadines verheultes Gesicht, um die bittere Wahrheit zu erkennen.
Normalerweise hätte sie ihn für aufdringlich gehalten. Sie kannten sich doch kaum! Und dennoch hatte er auf dem Gehsteig vor der Praxis auf sie gewartet. Doch in ihrer gegenwärtigen Gemütslage traten diese Überlegungen und ihr natürliches Misstrauen fremden Männern gegenüber in den Hintergrund. Schließlich hatte er bislang mit allem recht gehabt, was er gesagt hatte. Sie hatte soeben tatsächlich schlimme Neuigkeiten erfahren. Und sie brauchte dringend jemanden, der sich um sie kümmerte. Wieso dann nicht er?
Nadine nickte.
»Möchten Sie gern darüber reden?«
Sie zögerte und sah sich um. Sie standen mitten auf dem Bürgersteig. Passanten machten einen Bogen um sie und hasteten links und rechts an ihnen vorbei. Manche warfen ihnen verärgerte Blicke zu, weil sie im Weg standen. Doch sie beide waren von all der Hektik um sie herum völlig unberührt, als umgäbe sie eine schützende Sphäre.
Nadines erster Impuls bestand darin, ihm eine Abfuhr zu erteilen. Was ging es ihn an, was mit ihr los war? Sie kannte ihn doch kaum! Eher sollte sie mit ihrer besten Freundin Anne oder ihrer Mutter darüber sprechen. Andererseits verspürte sie das drängende Bedürfnis, die furchtbare Diagnose vorerst vor ihren Angehörigen und Freunden geheim zu halten. Auch wenn sie nicht genau sagen konnte, warum sie das tun wollte.
Sie richtete den Blick wieder auf ihn und sah das tiefempfundene Mitgefühl in seinen ausdrucksstarken Augen. Das gab letztendlich den Ausschlag.
»Aber nicht hier!«, sagte sie und sah sich erneut unbehaglich um.
»Ich kenne ein Café ein Stück die Straße hinunter. Lassen Sie uns dort einen Kaffee trinken. Dann können Sie sich alles von der Seele reden.«
Nadine zögerte nicht länger. Obwohl sie ihn kaum kannte, hatte sie sofort das Gefühl, bei ihm in guten Händen zu sein. Er wirkte so sanft und mitfühlend und war bestimmt ein guter Zuhörer. Wieso sollte sie ihm daher nicht ihr Herz ausschütten, wo er gerade zur Hand und darüber hinaus dazu bereit war, ihr zuzuhören?
»Ich heiße übrigens Nadine«, sagte sie und reichte ihm die Hand.
Er nahm sie. Nicht fest und zupackend, wie es manche Männer taten, als wollten sie ihre Männlichkeit durch einen besonders festen Händedruck unter Beweis stellen. Sondern vorsichtig und sanft, als wollte er ihr um keinen Preis auf der Welt wehtun. Auch das gefiel ihr.
»Mein Name ist Johannes.«
Der Name passt zu ihm! Zum ersten Mal seit der Diagnose musste sie unwillkürlich lächeln. Es klang wie ein biblischer Name. Sie wusste allerdings nur wenig über die Bibel und die Geschichten und Gestalten, die darin geschildert wurden. Dennoch löste der Name ein positives Gefühl in ihr aus. Normalerweise ging sie nicht mit fremden Männern mit. Aber als sie an seiner Seite die Straße überquerte und zu dem Café ging, von dem er gesprochen hatte, bereute sie den spontanen Impuls kein bisschen.
»Sind Sie Priester?«
Sie saßen an einem Fenstertisch und konnten auf die Straße hinaussehen. Wenn Nadine sich zur Seite gebeugt hätte, hätte sie das Gebäude sehen können, in dem die radiologische Praxis lag, die sie erst vor Kurzem verlassen hatte. Doch sie hatte kein Bedürfnis danach. Nicht nach dem, was sie dort erfahren hatte.
Nachdem sie Platz genommen hatten, sprachen sie eine Weile nicht miteinander. Es war, als fühlten sie sich mit einem Mal in Gegenwart des anderen befangen. Sie gaben bei der Bedienung ihre Bestellungen auf. Und erst nachdem Johannes seinen Kaffee und Nadine ihren Cappuccino bekommen hatte, brach Nadine schließlich das Schweigen und stellte ihre Frage.
Er schüttelte den Kopf und hob fragend die Augenbrauen. »Nein. Wie kommen Sie darauf?«
»Ihre mitfühlende und sanfte Art erinnert mich an einen Priester.«
Ein wehmütiger Ausdruck erschien auf seinem Gesicht. »Ich hätte liebend gern ein geistliches Amt übernommen.« Er schüttelte erneut den Kopf. »Aber es sollte nicht sein.«
»Warum nicht? Was ist passiert?«
Er senkte den Blick und sah auf die Kaffeetasse, die vor ihm stand und die er noch nicht angerührt hatte. Dann hob er den Blick wieder. Er sah sie lächelnd an und seufzte tief, bevor er antwortete: »Das ist Schnee von gestern und unwichtig. Außerdem sind wir nicht hier, um über mich zu sprechen, sondern über Sie. Wieso erzählen Sie mir nicht, welche Diagnose der Arzt Ihnen mitgeteilt hat?«
»Woher wissen Sie von der Diagnose?« Sie sah ihn misstrauisch an. Vielleicht war es doch ein Fehler gewesen, allzu vertrauensvoll einem Fremden gegenüber zu sein.
»Wieso wären Sie sonst in der radiologischen Praxis gewesen, wenn Sie dort nicht untersucht worden sind und eine Diagnose erhalten haben. Und Ihr Zustand, als Sie wieder herauskamen, sprach gelinde gesagt Bände. Man muss daher kein Einstein sein, um eins und eins zusammenzuzählen und auf zwei zu kommen. Also erzählen Sie schon! Sie werden sehen, danach fühlen Sie sich besser.«
Nadine bezweifelte das. Wieso sollte sie sich auch nur einen Deut besser fühlen, sobald sie die niederschmetternde Diagnose in Worte gefasst hatte? Andererseits sah er sie so voller Mitgefühl an, wie sie es sich von dem Arzt in der radiologischen Praxis gewünscht hätte. Doch der war vollkommen emotionslos gewesen. Wie ein Diagnose-Roboter! Er hatte einen eiskalten Eindruck vermittelt, als er ihr das Ergebnis der Untersuchung unter Verwendung möglichst vieler unverständlicher Fachbegriffe mitgeteilt hatte. Es hatte sich für sie eher so angehört, als würde er den Wetterbericht auf Suaheli verlesen. Allerdings mit einer verheerenden Wetterprognose! Deshalb tat es jetzt auch so gut, jemandem wie Johannes gegenüberzusitzen. Er war ein Mensch, der den Eindruck erweckte, als könnte er ihre Angst und ihr Leid nicht nur nachempfinden, sondern sogar teilen. Und vielleicht hatte er ja recht, und sie fühlte sich danach tatsächlich besser.
»Seit ein paar Wochen leide ich unter mörderischen Kopfschmerzen.« Sie beobachtete den Mann aufmerksam, um zu sehen, wie er auf ihre Worte reagierte. »Außerdem war mir oft übel, vor allem bei nüchternem Magen. Und manchmal hatte ich Sehstörungen.«
Johannes verzog das Gesicht, als könnte er ihre Qualen in diesem Moment am eigenen Leib nachempfinden. »Wie furchtbar! Was unternahmen Sie gegen die Beschwerden?«
Sie senkte den Blick und sah auf ihren Cappuccino, der ebenfalls noch unberührt war. Momentan drehte sich ihr schon bei dem Gedanken, etwas zu sich zu nehmen, der Magen um.
»Ich dachte zuerst, es wäre nur eine Phase, die von selbst wieder vorübergeht. Daher nahm ich Schmerztabletten, die ich rezeptfrei in der Apotheke bekam. Doch irgendwann wirkten sie nicht mehr, und die Schmerzen wurden von Tag zu Tag heftiger. Vor allem in der Nacht quälten sie mich, sodass ich kaum noch schlafen konnte. Deshalb ging ich schließlich zu meinem Hausarzt. Der schickte mich zum Neurologen. Und der Neurologe überwies mich, nachdem ich ihm die Symptome geschildert hatte, umgehend zum MRT in die radiologische Praxis. Darüber hinaus verschrieb er mir ein stärkeres Schmerzmittel, mit dem die Schmerzen halbwegs zu ertragen sind.«
»Und was wurde bei der Magnetresonanztomografie festgestellt?« Johannes bewies mit seiner Frage, dass er die von Nadine gebrauchte Abkürzung kannte.
Die Kernspin- oder Magnetresonanztomografie, kurz MRT, ist eine Methode der modernen medizinischen Diagnostik. Mithilfe eines starken Magnetfeldes und ganz ohne Röntgenstrahlen werden dabei detailgenaue Schichtbildaufnahmen des menschlichen Körpers erzeugt.
Nadine hob den Kopf und sah Johannes an. Erneut standen ihr Tränen in den Augen. Sie verschleierten ihren Blick, sodass sie den feinfühligen Mann nur noch verschwommen sah.
»Die Untersuchung hat ergeben, dass sich in meinem Gehirn …« Sie verstummte, weil ihre Stimme versagte. Doch sie atmete einmal tief durch und zwang sich dazu, weiterzusprechen. »… eine große Geschwulst gebildet hat. Ich … Ich habe einen Gehirntumor.«
Johannes sah ebenfalls so aus, als würde er gleich in Tränen ausbrechen. »Das tut mir ja so leid«, sagte er flüsternd und legte seine rechte Hand auf ihre linke.
Normalerweise betrachtete sie es als plumpe Anmache, wenn ein Mann, den sie kaum kannte, sie absichtlich berührte. Doch bei Johannes war es etwas anderes. Sie spürte, dass er es ernst meinte und keine Hintergedanken hatte. Seine Anteilnahme und sein Mitleid waren echt und kamen aus tiefstem Herzen. Deshalb sah sie seine Geste nicht als Versuch, die Situation auszunutzen und sie anzumachen, sondern als das, was sie wirklich war. Er wollte ihr durch die Berührung Trost spenden und ihr demonstrieren, dass sie nicht allein war.
Sein Verhalten rührte sie zu Tränen. Aber sie riss sich zusammen. Sie wollte nicht wieder weinen. Vor allem nicht hier in aller Öffentlichkeit. Wenn sie erst einmal damit anfing, konnte sie wahrscheinlich nicht mehr so leicht damit aufhören. Außerdem hatte sie im Sprechzimmer des Arztroboters, der sie mit seinen Gletschereisaugen die ganze Zeit nur mitleidlos angesehen hatte, schon mehr als genug Tränen vergossen.
Nadine schniefte und schluckte. »Danke.«
Johannes schüttelte den Kopf. »Sie müssen sich nicht bei mir bedanken. Das ist doch selbstverständlich.«
»Nein, das ist es nicht!«, widersprach sie heftiger, als sie es beabsichtigt hatte. Doch sie war momentan außerstande, ihre Gefühle zu kontrollieren. »Vorhin, vor der Praxis, sind Hunderte von Menschen an mir vorbeimarschiert, ohne überhaupt zu bemerken, dass es mir nicht gut geht. Sie haben es jedoch sofort gesehen und mich gefragt, ob Sie mir helfen können. Das macht Sie zu etwas ganz Besonderem.«
Johannes winkte ab. Es war ihm ersichtlich unangenehm, als etwas Besonderes bezeichnet zu werden. Vermutlich wechselte er deshalb rasch das Thema. »Kann der Tumor entfernt werden?«
Für einen winzigen Augenblick hatte Nadine das Gefühl, sein Blick bekäme bei dieser Frage etwas Lauerndes. Und seine bislang so gefühlvollen Augen erinnerten sie jäh an die kalten Augen eines hungrigen Reptils. Doch nachdem sie überrascht geblinzelt hatte, war dieser Eindruck wieder verschwunden. Daher redete sie sich ein, dass sie sich getäuscht haben musste. Stattdessen machte sie einen Lichtreflex dafür verantwortlich.
Sie seufzte und schüttelte den Kopf. Dann wiederholte sie die Worte des Arztes, die sich in ihr Gedächtnis eingebrannt hatten: »Der Tumor liegt an einer extrem ungünstigen Stelle und ist dort nicht ohne Weiteres zugänglich. Deshalb ist er chirurgisch nicht entfernbar.«
»Wie sieht die Therapie aus?«
»Eine Kombination aus Bestrahlung und Chemotherapie.«
»Und die Erfolgsaussichten?«
Nadine senkte den Blick und schüttelte stumm den Kopf. Sie konnte ihm nicht antworten. Denn jetzt brach sie gegen ihren ausdrücklichen Willen doch wieder in Tränen aus.
Am Abend verließ sie ihre kleine Wohnung und horchte, ob jemand im Treppenhaus war. Erst dann eilte sie die Stufen nach unten. Sie wollte niemandem begegnen. Vor allem hatte sie keine Lust auf ein Gespräch mit einem Nachbarn, bei dem sie so tun müsste, als ginge es ihr gut und als wäre alles in bester Ordnung. Obwohl das Gegenteil der Fall war und ihr Leben seit der Diagnose am Nachmittag buchstäblich in Trümmern lag.
Außerdem hatte Johannes darauf bestanden, dass niemand sah, wie sie das Haus verließ. Er wollte ihr etwas zeigen. Und da es sich um eine Überraschung handelte, die sie auf andere Gedanken bringen sollte, durfte niemand diese Überraschung verderben.
Nadine konnte den Grund für seine Heimlichtuerei nicht nachvollziehen. Aber wenn sie ihm damit einen Gefallen tat, wollte sie seiner Bitte gern nachkommen. Schließlich gab er sich ebenfalls viel Mühe, um ihr eine Überraschung zu bereiten und sie auf andere Gedanken zu bringen.
Als sie das Haus verließ, sah sie sich in alle Richtungen um, doch es war niemand in der Nähe. Sie kam sich vor wie ein Geheimagent in einem schlechten Film. Unwillkürlich musste sie kichern. Ihr wurde bewusst, dass es sich um das erste Zeichen echten Humors handelte, seit sie die Diagnose bekommen hatte. Vermutlich war das der eigentliche Grund, warum Johannes darauf bestanden hatte. Wenn sie sich dabei lächerlich vorkam, musste sie über sich selbst lachen und fühlte sich sofort besser. Er sollte sich diese Behandlungsmethode patentieren lassen. Damit könnte er ein Vermögen verdienen.
Es war bereits dunkel. Auf dem Gehsteig vor dem Haus waren kaum Passanten unterwegs. Nadine hielt dennoch den Kopf gesenkt. Sie kam an ihrem Auto vorbei, das sie am Straßenrand geparkt hatte, ließ es aber stehen. Johannes wollte sie in der Nähe mit seinem Wagen abholen. Bis zur vereinbarten Zeit waren es noch fünfzehn Minuten. Doch es war nicht weit bis zum Treffpunkt. Nadine musste lediglich zweimal abbiegen und insgesamt weniger als einen halben Kilometer laufen. Dann hatte sie den Spielplatz erreicht, der um diese Uhrzeit verlassen war. Sämtliche Kinder, die sonst hier spielten, waren zu Hause und lagen teilweise schon in ihren Bettchen.
Nadine sah auf die Uhr. Sie war zu früh dran. Um nicht gesehen zu werden, stellte sie sich hinter den Stamm eines Kastanienbaums. Von dort behielt sie die Straße im Auge. Sobald ein Scheinwerferpaar auftauchte, beobachtete sie den Wagen erwartungsvoll. Doch jedes Auto fuhr am Spielplatz vorbei, ohne die Geschwindigkeit zu drosseln.
Nach dem tröstenden Gespräch mit Johannes im Café und der Zusage, ihn am späten Abend hier zu treffen, war Nadine mit der U-Bahn nach Hause gefahren. Sobald sie allein war, kam es ihr so vor, als wäre das Schicksal, zu dem der Gehirntumor sie verdammte, zu schwer, als dass sie es allein ertragen könnte. Sie fühlte sich, als wäre der Tumor in ihrem Kopf zentnerschwer und würde sie niederdrücken. Gleichzeitig hatte sie das Empfinden, er wäre so groß, dass er sogar die Sonne verdunkelte und ihr Leben überschattete. Aber sie wollte nicht ständig an die Geschwulst denken, die sich wie ein Parasit heimtückisch in ihrem Gehirn eingenistet hatte und von ihr nährte. Und auch nicht an die furchtbaren Konsequenzen, die sich daraus für sie ergaben. Deshalb richtete sie ihre Gedanken stattdessen auf Johannes und fühlte sich augenblicklich besser. Sie vergegenwärtigte sich seinen teilnahmsvollen Blick, seine zärtliche, tröstliche Berührung und seine warmen, einfühlsamen Worte. Und sofort hatte der Tumor weniger Macht über sie und ihr Leben.
Obwohl sie keinen Hunger hatte, machte sie sich am Abend einen Salat. Wie ein wählerischer Vogel pickte sie appetitlos mit der Gabel darin herum, während sie im Fernsehen die Nachrichten verfolgte. Die Meldungen von Krieg, Flüchtlingen und Terrorismus waren ihr vor Kurzem noch furchtbar und weltbewegend erschienen. Nun, im Angesicht ihres eigenen Schicksals, kamen sie ihr viel unbedeutender und nichtssagender vor. Deshalb schaltete sie den Fernseher bald wieder aus und warf den größten Teil des Abendessens in den Biomüll.
Kurze Zeit später rief ihre Mutter an und fragte, wie es Nadine gehe. Sie hatte ihrer Mutter von den Kopfschmerzen und der Übelkeit erzählt. Doch die Besuche beim Neurologen und in der radiologischen Praxis hatte sie für sich behalten. Sie hatte ihre Mutter, die bereits einen leichten Herzinfarkt hinter sich hatte, nicht grundlos beunruhigen wollen. Für einen winzigen Moment verspürte sie jetzt das Bedürfnis, ihr alles zu erzählen. So wie sie sich schon als kleines Mädchen alles Belastende von der Seele geredet und sich hinterher besser gefühlt hatte. Aber dann ließ sie es doch bleiben. Ihre Mutter würde sich nur Sorgen machen und sich aufregen. Und das wäre gar nicht gut für sie und ihr angeschlagenes Herz. Außerdem handelte es sich hierbei nicht um kindliche Sorgen und Ängste, die allein dadurch besser wurden, dass man sich Mami oder Papi anvertraute. Der Tumor würde sich davon nicht beeindrucken lassen und auch keinen Millimeter kleiner werden. Im Übrigen hatte Johannes ihr empfohlen, ihrer Mutter, die seit dem Tod ihres Mannes allein lebte, vorerst nichts von der Diagnose zu erzählen. Auch ihn sollte sie fürs Erste unerwähnt lassen, bis der richtige Zeitpunkt gekommen wäre, dass sie einander kennenlernten. Also sagte Nadine ihrer Mutter, dass es ihr gut gehe und die Tabletten, die der Arzt ihr verschrieben hatte, die größten Beschwerden linderten.
Nach dem Gespräch mit der Mutter hatte Nadine das Bedürfnis, mit ihrer besten Freundin Anne zu sprechen. Seit Anne geheiratet und in kurzer Zeit drei Kinder zur Welt gebracht hatte, trafen sie sich nur noch selten. Sie telefonierten allerdings mehrere Male pro Woche miteinander und erzählten sich wie als Teenager weiterhin alles, was sie erlebt hatten und was sie beschäftigte.
Es tat Nadine gut, die Stimme ihrer Freundin zu hören. Sie hörte sich deren Klagen über die Kinder an und tat, als würde es sie interessieren. Aber als Anne auf die Kopfschmerzen und die Übelkeit zu sprechen kam, von denen ihr Nadine erzählt hatte, wiegelte sie ab und sagte, es gehe ihr schon wieder viel besser. Doch Anne kannte sie zu gut, um sich damit zufriedenzugeben.
»Was ist los, Nadine?«
»Wieso? Was soll los sein?«
»Ich kenne dich inzwischen gut genug. Deshalb weiß ich, dass du mich nicht nur angerufen hast, um dir meine Geschichten über die drei kleinen Monster anzuhören, die sich wie meine Kinder verkleidet haben. Also rück schon raus mit der Sprache! Was hast du auf dem Herzen?«
»Nichts. Ich …«
»Lüg mich bitte nicht an! Du weißt doch, dass ich ein menschlicher Lügendetektor bin. Ich kann es fühlen, wenn du mich anlügst. Dann stellen sich sofort die Härchen auf meinen Armen und in meinem Nacken auf. Also erzähl mir endlich die Wahrheit. Geht es etwa um einen Kerl? Du klingst, als wärst du verliebt.«
Nadine atmete erleichtert auf. Wenigstens ahnte Anne nicht, was wirklich in ihr vorging. Und was schadete es schon, wenn sie ihrer besten Freundin gegenüber ein paar Andeutungen machte, ohne allzu sehr ins Detail zu gehen.
»Verliebt wäre zu viel gesagt.«
»Dann hatte ich also recht? Es geht um einen Mann. Jetzt erzähl schon! Wie heißt der Typ? Wo hast du ihn kennengelernt? Und hat er zufällig einen Zwillingsbruder, der sich gern mit einer dreifachen alleinerziehenden Mutter treffen würde, die allmählich ein bisschen aus dem Leim geht?«
Normalerweise hätte Nadine über Annes scherzhafte Art, mit ihren Problemen umzugehen, gelacht. Sie und ihr Mann hatten sich vor Kurzem getrennt. Außerdem hatte Anne in letzter Zeit tatsächlich zugenommen. Doch der Schmerz in ihrem Kopf, der gegen Abend intensiver wurde, ließ sie stattdessen gequält das Gesicht verziehen. Darüber hinaus kamen ihr Annes Probleme angesichts dessen, was sie heute erfahren hatte, wie Peanuts vor.
Nadine beschloss, unmittelbar nach dem Telefonat mit ihrer Freundin eine der Tabletten zu nehmen, die der Neurologe ihr verschrieben hatte.
»Was soll die Geheimniskrämerei?«, fragte Anne, nachdem ihre Freundin nicht auf ihre Fragen geantwortet hatte, und unterbrach damit Nadines Überlegungen. »Wir sind doch beste Freundinnen und sollten uns daher alles erzählen.«
Nadine seufzte. Vielleicht war es ein Fehler gewesen, Anne anzurufen. Außerdem wurde das Stechen in ihrem Schädel so bohrend, dass sie kaum noch einen klaren Gedanken fassen konnte. Aber nachdem sie Annes Neugier geweckt hatte, musste sie ihr einen Knochen hinwerfen, auf dem sie herumkauen konnte, um sie zufriedenzustellen. Anne war wie ein Pitbull. Wenn sie sich in etwas verbissen hatte, ließ sie nicht mehr los.
»Er heißt Johannes.« Nadine schloss die Augen. Der Kopfschmerz war dann leichter zu ertragen. Ihr wurde ein bisschen schwindelig. Deshalb war sie froh, dass sie auf der Couch saß. So konnte sie wenigstens nicht umfallen und sich einen Knochen brechen. Das hätte ihr zu ihrem sonstigen Pech heute gerade noch gefehlt und das Fass zum Überlaufen gebracht.
»Ist das alles?«, fragte Anne enttäuscht.
»Ich … Ich kenne ihn kaum. Wir haben uns erst zweimal getroffen und uns ein wenig unterhalten. Mehr war da nicht. Aber … er ist sehr nett.«
»Und? Seht ihr euch wieder?«
Nadine zuckte mit den Schultern. »Mal sehen«, sagte sie unbestimmt, weil sie ihrer Freundin nichts von dem bevorstehenden Treffen erzählen wollte. Schließlich hatte Johannes sie um Geheimhaltung gebeten. Indem sie seinen Namen preisgegeben hatte, hatte sie bereits dagegen verstoßen. Aber was schadete es schon, wenn Anne seinen Vornamen kannte? Sie würden sich ohnehin irgendwann kennenlernen, falls sich aus ihrer Bekanntschaft mit der Zeit Freundschaft und unter Umständen sogar mehr entwickelte.
»Ich muss jetzt Schluss machen, Anne. Meine Mutter wollte mich heute Abend noch anrufen, um sich zu erkundigen, wie es mir geht.«
Die stechenden Schmerzen gaben ihr das Gefühl, ihr Kopf würde jeden Moment explodieren. Dennoch gelang es ihr, die Lüge überzeugend genug zu präsentieren, um Anne, den angeblichen menschlichen Lügendetektor, zu täuschen.
»Dann will ich nicht länger die Leitung blockieren.« Anne schien sich damit zufriedenzugeben, dass sie wenigstens den Namen des Mannes in Erfahrung gebracht hatte. »Meine drei Plagen streiten eh schon wieder. Wird Zeit, dass ich dazwischengehe, bevor wir in diesem Irrenhaus das erste Todesopfer zu beklagen haben. Aber bei unserem nächsten Telefonat musst du mir unbedingt mehr über diesen geheimnisvollen Johannes erzählen! Versprochen?«
»Versprochen. Bis dann, Anne.«
Nadine unterbrach die Verbindung, sobald ihre Freundin ihren Abschiedsgruß erwidert hatte. Sie ließ das Telefon neben sich auf die Couch fallen. Dann hob sie beide Hände und presste die Handballen gegen ihre Schläfen, als wollte sie den Schmerz zerquetschen, der dazwischen tobte. Doch selbstverständlich half das nichts. Dafür war die Qual zu groß. Alles, was ihr jetzt noch Linderung verschaffen konnte, war das Schmerzmittel.
Sie kam ächzend auf die Beine und ging ins Badezimmer. Dabei taumelte sie und musste sich mit der Hand an der Wand abstützen, um nicht hinzufallen. Ihr Gleichgewichtssinn war empfindlich gestört. Dennoch schaffte sie es ins Bad. Ohne ihrem darin gespiegelten, zu einer Fratze der Qual verzerrten Gesicht Beachtung zu schenken, öffnete sie den Spiegelschrank und entnahm ihm die Tablettenschachtel. Sie drückte eine Tablette aus der Blisterverpackung, schob sie mit zitternden Fingern in den Mund und trank Wasser direkt aus dem Hahn, um sie hinunterzuspülen.
Jedes Mal, wenn sie eine Tablette schluckte, dachte sie an die ellenlange Liste mit Nebenwirkungen und Wechselwirkungen auf dem Beipackzettel, den sie sich lieber nicht durchgelesen hatte. Im Gegensatz zu sonst wollte sie das alles gar nicht so genau wissen. Schließlich gab es momentan keine Alternative. Die einzig andere Möglichkeit hätte darin bestanden, den Schmerz zu ertragen. Doch daran wollte sie nicht einmal denken.
Sie ließ die offene Schachtel auf der Ablage des Waschbeckens liegen. Darum konnte sie sich später kümmern, sobald es ihr besser ging. Dann tappte sie auf wackligen Beinen und mit weichen Knien ins Schlafzimmer.
Dort ließ sie den Rollladen herunter und legte sich in völliger Dunkelheit aufs Bett. Anschließend hatte sie darauf gewartet, dass das Mittel seine analgetische Wirkung entfaltete und der Schmerz in ihrem Kopf gedämpft wurde.
Inzwischen wirkte das Analgetikum. Der Schmerz war zu einem erträglichen, beständigen Pochen abgeklungen.
Nadine sah auf ihre Armbanduhr. Es war vier Minuten nach der Zeit, die Johannes ihr genannt hatte. Sie kannte ihn zwar kaum, konnte sich aber nicht vorstellen, dass er sich oft verspätete. Schließlich war Zuspätkommen zutiefst rücksichtslos gegenüber dem Wartenden. Und der mitfühlende Mann, den sie heute ein bisschen näher kennengelernt hatte, würde ihrer Meinung nach nie bewusst rücksichtslos gegenüber einem seiner Mitmenschen handeln. Dazu war er zu gutherzig.
Aber wieso war er dann noch nicht hier? War ihm etwas Wichtigeres dazwischengekommen? Oder hatte er am Ende doch kalte Füße bekommen? Nadine könnte es ihm nicht einmal verübeln. Wieso sollte sich jemand, der seine fünf Sinne beisammenhatte, mit jemandem wie ihr belasten? Mit einem Menschen, der soeben erfahren hatte, dass in seinem Kopf ein inoperabler Tumor zur Untermiete wohnte, und dessen Chancen auf Heilung allenfalls im niedrigen zweistelligen Bereich lagen.
Nadine überlegte, ob sie noch länger warten oder nicht doch besser nach Hause gehen sollte. Wieso sollte sie sich hier die Beine in den Bauch stehen? Schließlich hatte sie Johannes ihre Adresse genannt. Wenn er doch noch kam – woran sie allmählich zu zweifeln begann –, wusste er, wo sie zu finden war.
Sie wollte sich gerade in Bewegung setzen, als erneut ein Scheinwerferpaar um die Ecke bog und rasch näherkam. Sie beobachtete es aufmerksam und voller neu erwachter Hoffnung. Und tatsächlich, der Wagen wurde langsamer und hielt nur wenige Meter entfernt am Rand der Straße.
Nadine war sich nicht sicher, ob Johannes sie hinter dem Baum überhaupt schon entdeckt hatte. Sie hatte Angst, er könnte wieder wegfahren, wenn er sie nicht sah. Deshalb trat sie rasch nach vorn und ging eilig auf den Wagen zu. Da sie sich ihm von vorn näherte, blendeten sie die Scheinwerfer, sodass sie nicht sehen konnte, wer im Auto saß. Sobald sie neben dem Wagen angelangt war, beugte sie sich hinunter und warf durch das Beifahrerfenster einen Blick ins Innere. Sie lächelte erleichtert, als sie Johannes hinter dem Steuer entdeckte. Er hob die Hand zum Gruß, erwiderte ihr Lächeln und forderte sie auf, endlich einzusteigen. Sie folgte seiner Einladung, nahm auf dem Beifahrersitz Platz und schlug die Tür zu.
»Du bist also tatsächlich gekommen«, sagte sie, nachdem sie sich begrüßt hatten, und duzte ihn unwillkürlich. Sie freute sich so sehr, ihn zu sehen, dass der stetige dumpfe Schmerz in ihrem Kopf in den Hintergrund trat und sie ihn kaum noch wahrnahm. Die Freude darüber, dass er sie nicht versetzt hatte, war stärker als jedes Schmerzmittel.
»Hast du etwa daran gezweifelt?«, fragte er, als könnte er nicht glauben, dass jemand auch nur auf so einen Gedanken kam.
Sie zuckte mit den Schultern. »Du hast dich ein paar Minuten verspätet. Da kam mir der Gedanke, du könntest es dir anders überlegt haben. Ich könnte es sogar verstehen. Wer will sich schon mit jemandem wie mir belasten? Das bringt doch nur Probleme und Sorgen.«
»Nein!« Er legte ihr die rechte Hand auf den linken Unterarm. »So etwas darfst du nicht einmal denken. Im Gegenteil. Jemand wie du ist wie ein Geschenk des Himmels für mich.«
»Ach, was redest du denn da?« Sie schüttelte den Kopf. Gleichwohl taten ihr seine Worte gut und wärmten ihr Herz.
»Nein, das meine ich völlig ernst.« Er drückte ihren Arm, als wollte er seine Worte bekräftigen. »Ich bin so froh, dass ich dir begegnet bin. Du bist ein Geschenk des Himmels. Und ein Zeichen, dass Gott meine Gebete erhört hat und meine Pläne gutheißt und tatkräftig unterstützt.«
Nadine runzelte verwirrt die Stirn. »Was meinst du damit, Johannes? Welche Pläne?«
Er schüttelte den Kopf. »Das erzähle ich dir später. Es ist alles Teil der Überraschung, die ich für dich vorbereitet habe. Und die will ich dir nicht verderben, indem ich vorher zu viel verrate. Du magst doch Überraschungen, oder?«
»Wer mag die nicht?« In Gedanken setzte sie hinzu: Solange sie positiv sind. Sie sprach es jedoch nicht aus, weil sie ihn nicht verletzen wollte. Außerdem konnte sie sich nicht vorstellen, dass ein Mann wie Johannes jemandem eine böse Überraschung bereiten könnte.
Seine vorherigen Worte fielen ihr wieder ein. Ein Geschenk des Himmels hatte er sie genannt. Damit hatte er natürlich maßlos übertrieben. Aber auf ihn traf das durchaus zu. Für sie war er tatsächlich ein Geschenk des Himmels. Denn er nahm sie so, wie sie war. Schließlich war sie seit heute so etwas wie beschädigte Ware. Dafür sorgte Mr. Tumor, wie sie die Geschwulst getauft hatte. Er hatte sich uneingeladen in ihrem Kopf eingenistet und würde sich immer weiter ausbreiten, wenn man ihm nicht mit Bestrahlung und Chemotherapie zu Leibe rückte und Einhalt gebot. Ob es allerdings letztendlich gelang, ihn zu besiegen, stand momentan noch in den Sternen. Und selbst wenn es gelingen sollte, war es bis dahin ein langer, steiniger und dornenreicher Weg.