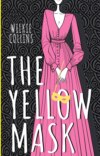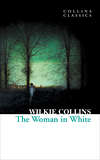Read the book: «Der Wahnsinnige», page 4
Angenommen, er entdeckte wirklich mit meiner Hilfe Stephan Monktons Leichnam, und brachte ihn nach England zurück – war es wohlgetan von mir, die eheliche Verbindung, welche aller Wahrscheinlichkeit nach gleich darauf folgen würde, zu befördern – eine Verbindung, deren möglichste Verhinderung eigentlich die Pflicht eines jeden hätte sein müssen? Diese Betrachtung führte mich auf den Grad seines Wahnsinns, oder, um einen milderen Ausdruck zu gebrauchen, seiner Geistesstörung Es konnte kein Zweifel darüber herrschen, dass er in der Unterhaltung über gewöhnliche Gegenstände jeder Art einen völlig gesunden Verstand zeigte; sogar die ganze Erzählung dieses Abends hatte er in klarer, logischer Verbindung vorgetragen. Was die behauptete Erscheinung betraf, so lässt sich nur sagen, dass es zu allen Zeiten auch viele andere Leute gegeben hat, die geistig ebenso gesund wie ihre Mitmenschen waren, und sich doch von einem Phantome verfolgt glaubten, und sogar lange philosophische Abhandlungen darüber schrieben. Es schien mir klar zu sein, dass der Grund zu dieser eingebildeten Erscheinung in Alfreds Überzeugung von der Wahrheit jener alten Prophezeiung und in dem Glauben liege, dass er einen warnenden Fingerzeig von oben erhalten habe. Sein einsames Leben in der Abtei, in Verbindung mit reizbaren Nerven und einer in der Familie vielleicht erblichen Anlage zu geistigen Krankheiten, machte eine solche Selbsttäuschung sehr erklärlich.
War ein solcher Zustand heilbar? Miss Elmslys Handlungsweise, die ihn viel besser kannte als ich, ließ darauf schließen, dass sie an die Möglichkeit glaubte. War ich berechtigt, sie ohne weiteres eines Irrtums zu bezichtigen? Angenommen, ich weigerte mich, mit ihm an die Grenze zu gehen – war nicht mit Gewissheit anzunehmen, dass er sich allein dahin begeben und vielleicht großen Unfällen aussetzen werde, während ich, ein müßiger Mensch, in Neapel blieb und ihn seinem Schicksale überließ, nachdem ich selbst den Plan zu der Unternehmung entworfen und ihn ermuntert hatte, Vertrauen in mich zu setzen?
Gewisse Vorbereitungen zu unserer Abreise, die ich nach einer zweiten Zusammenkunft mit Alfred für nötig erachtete, verrieten den Plan den meisten unserer Bekannten in Neapel. Ihr Erstaunen war unbeschreiblich, und der Verdacht, dass ich fast ebenso wahnsinnig sei wie Monkton, sprach sich allgemein gegen mich aus. Manche versuchten sogar meinen Entschluss wankend zu machen, indem sie mir erzählten, was für ein verächtlicher Wüstling Stephan Monkton gewesen sei; allein alle Spöttereien machten eben so wenig Eindruck auf mich, als Gründe irgend einer Art. Mein Entschluss war gefasst, und ich beharrte dabei.
In zwei Tagen war alles in Bereitschaft. Ich bestellte den Wagen absichtlich einige Stunden früher als ursprünglich verabredet worden, um, mit Rücksicht auf meinen Freund, den uns bei der Abreise angedrohten Spöttereien zu entgehen; denn Letzterer befand sich in Folge der Vorbereitungen in einer Aufregung, die mir durchaus nicht lieb war. Kurz nach Sonnenaufgang also, als noch keine Seele auf den Straßen sichtbar war, verließen wir in aller Stille Neapel.
Jedermann wird mir glauben, wenn ich sage, dass meine Lage nicht zu beneiden war. Mit Furcht und Scheu blickte ich jedem kommenden Tage entgegen, als ich jetzt in der Gesellschaft des »armen, wahnsinnigen Monkton« die Reise antrat, um längs der römischen Grenze den Leichnam eines im Zweikampfe Gefallenen aufzusuchen.
IV
Ich war nach reiflicher Überlegung zu der Ansicht gekommen, dass es am zweckmäßigsten sei, die dicht an der Grenze gelegene Stadt Fondi zu unserem Hauptquartier zu machen und von dort aus die Nachforschungen zu beginnen, und hatte deshalb die Anordnung getroffen, dass der bleierne Sarg in seiner hölzernen Hülle bis dahin nachgesendet werde. Außer unseren Pässen hatten wir von der Gesandtschaft Empfehlungsbriefe an die Behörden der bedeutenderen Grenzstädte erhalten, und besaßen Geld genug, um alle nötigen Dienste in Anspruch nehmen zu können. Diese verschiedenen Hilfsquellen mussten unsere Bewegungen und die Erreichung des Zweckes – sofern er überhaupt zu erreichen war – bedeutend erleichtern; allein in dem sehr wahrscheinlichen Falle des Fehlschlagens waren die weiteren Aussichten für mich sehr trüber Art. Ich gestehe, ich empfand keine geringe Unruhe und hegte nicht die leiseste Hoffnung, als wir unter der brennenden italienischen Sonne unseren Weg nach Fondi verfolgten.
Mit Rücksicht auf Monktons Zustand drang ich darauf, kurze Tagreisen zu machen. Am ersten Tage war seine Aufregung von der Art, dass sie mich fast ganz außer Fassung brachte. Er ließ so viele verschiedene Zeichen von Geistesstörung erkennen, wie ich noch nie zuvor an ihm bemerkt hatte. Am zweiten Tage wurde er jedoch ruhiger, und schien sich an den ihn so heftig aufregenden Gedanken, dass die Nachforschungen von ihm selbst jetzt wirklich begonnen seien, mehr gewöhnt zu haben. So lange ich einen gewissen Punkt nicht berührte, war er sogar heiter und völlig gelassen; wenn aber das Gespräch auf seinen verstorbenen Oheim fiel, wiederholte er stets mit der größten Leidenschaftlichkeit die Behauptung – natürlich nur auf Grund der alten Prophezeiung und unter dem Einflusse der Erscheinung, welche er zu sehen wähnte, dass der Leichnam, wo er sich auch befinde, bis jetzt noch unbeerdigt sei. In jedem anderen Punkte folgte er mir mit der größten Nachgiebigkeit; in diesem aber beharrte er bei seiner Meinung mit einer Hartnäckigkeit, gegen die alle Vorstellungen vergeblich waren.
Am dritten Tage erreichten wir Fondi und machten daselbst Halt. Die Kiste mit dem Sarge kam an und wurde an einem sicheren Orte untergebracht. Dann mieteten wir mehrere Maultiere und nahmen einen Führer, welcher die Gegend genau kannte. Um den eigentlichen Zweck unserer Reise nicht bekannt werden zu lassen, teilten wir ihn nur solchen Personen mit, in die wir volles Vertrauen setzen konnten, und folgten übrigens dem Beispiele der Duellanten, indem wir früh am Morgen des vierten Tages, mit Skizzenbüchern und Farbenkasten versehen, aufbrachen, als wollten wir einen Ausflug machen, um die malerischen Punkte der Umgegend zu besuchen.
Nachdem wir unseren Weg mehrere Stunden in nördlicher Richtung fortgesetzt hatten, hielten wir, um uns selbst und unseren Tieren einige Ruhe zu gönnen, in einem wild gelegenen Dörfchen an, wohin noch wenige Touristen gekommen sein mochten.
Die einzige gebildete Person im Orte war der Priester. Zu ihm begab ich mich allein, Monkton beim Führer zurücklassend, um die ersten Erkundigungen einzuziehen. Ich war der italienischen Sprache hinreichend mächtig, und beobachtete bei Eröffnung meines Geschäftes die größte Höflichkeit und Vorsicht; aber aller Bemühungen unerachtet hatten meine Worte keine andere Wirkung, als dass sie den armen Priester in den größten Schrecken versetzten. Der Gedanke an einen Zweikampf und einen Erschlagenen machte ihn beben. Er verbeugte sich, krümmte sich, blickte gen Himmel, zuckte die Achseln, und versicherte mit echt italienischer Zungenfertigkeit und Breite, dass er kein Wort von allem verstehe, was ich sage. Das war unsere erste Täuschung, und ich gestehe, dass sie mich nicht wenig entmutigte.
Nachdem die Hitze des Tages vorüber war, setzten wir unsere Reise fort. Ungefähr drei Meilen vom Dorfe teilte sich die Straße in zwei Richtungen. Der Weg zur Rechten führte, wie wir hörten, in die Berge und zu einem etwa sechs Meilen entfernten Kloster, während der andere durch die Ebene weiter in das römische Gebiet hinein lief und uns zu einer kleinen Stadt brachte, wo wir übernachten konnten. Er eröffnete uns das größere und zugleich schwierigere Feld für unsere Forschungen. Blieben diese fruchtlos, so konnten wir nach unserer Rückkehr von Fondi aus leicht den kürzeren, zum Kloster führenden Weg durchsuchen. Diese Rücksicht bestimmte uns, zuerst die linke Richtung einzuschlagen. Die Expedition dauerte volle acht Tage und lieferte nicht das geringste Resultat, so dass wir getäuscht und entmutigt nach Fondi zurückkehren mussten.
Die Wirkung, welche dieses Fehlschlagen unserer Hoffnungen auf Monkton hatte, beunruhigte mich jedoch viel mehr, als das Fehlschlagen selbst. Sobald wir genötigt waren, den Rückweg anzutreten, schien sein Mut völlig zusammen zu brechen. Er wurde erst reizbar und eigensinnig, dann schweigsam und verzagt, und sank endlich in eine Lethargie, die mich nicht wenig ängstigte. Am Morgen nach unserem Wiedereintreffen in Fondi verriet er eine besondere Neigung fortwährend zu schlafen, was mich eine Gehirnkrankheit befürchten ließ. Den ganzen Tag sprach er kaum ein Wort mit mir, und schien nie völlig wach zu sein. Als ich am nächsten Tage in sein Zimmer trat, fand ich ihn in demselben Zustande. Sein Bedienter, welcher uns begleitete, sagte mir jedoch, dass Alfred schon bei Lebzeiten seines Vaters, in Wincot, mehrmals in einen ähnlichen Zustand verfallen sei. Die Mitteilung beruhigte mich etwas, und ließ mich wieder an den Zweck denken, der uns nach Fondi geführt.
Ich beschloss, die Zeit, bis mein Reisegefährte sich wieder wohler fühlte, zu benutzen und die Bemühungen inzwischen allein fortzusetzen. Der Weg zur Rechten, nach dem Kloster führend, war noch nicht erforscht worden. Ich brauchte zu diesem Zwecke nur eine Nacht abwesend zu sein, und konnte Monkton bei meiner Rückkehr mindestens darüber Gewissheit geben, ob auch in dieser Richtung nichts zu finden sei. Schnell entschlossen, ließ ich für meinen Freund schriftlich ein paar Worte zurück, im Falle er nach mir fragen sollte, und machte mich wieder auf den Weg nach dem Dorfe, wo wir angehalten und die Expedition in das römische Gebiet begonnen hatten. Da es meine Absicht war, nach dem Kloster zu Fuß zu gehen, so befahl ich dem Führer, mit den Maultieren im Dorfe zu bleiben und meine Rückkehr abzuwarten.
Während der ersten vier Meilen lief der Pfad durch eine offene, freie Gegend sanft aufwärts, wurde dann aber plötzlich steiler, und führte in dichte, weite Waldungen. Als meine Uhr mir sagte, dass ich die angegebene Entfernung von sechs Meilen zurückgelegt haben müsse, war die Aussicht noch auf allen Seiten beengt, und selbst der Himmel über mir war wegen des dichten Landes kaum sichtbar. Wenige Minuten später jedoch öffnete sich die Waldung, ich trat auf einen freien und ebenen Platz, und vor mir lag das alte Kloster.
Es war ein niedriges, finsteres Gebäude, in dessen Nähe sich nirgends eine Spur von Leben zeigte. Grüne Moderflecken bedeckten die Wände der Kapelle, dickes Moos wucherte an den Mauern der anderen Gebäude, und langes Unkraut hing vom Dache herab, und wehte vor den vergitterten Fenstern hin und her. Das der Pforte gegenüber stehende Kreuz, mit seiner verstümmelten menschlichen Figur, war am Fuße dergestalt mit kriechendem Gewürm bedeckt und sah überhaupt so grün, widrig und verfault aus, dass ich mich mit Ekel davon abwandte.
An der Pforte selbst hing eine Glockenschnur mit einem zerbrochenen Griffe. Ich näherte mich ihr – zögerte, ohne selbst zu wissen weshalb – blickte an dem Kloster hinauf, und schritt dann langsam der hinteren Seite des Gebäudes zu, teils um zu überlegen, was jetzt am zweckmäßigsten zu tun sei, teils aus eitler mir selbst unerklärlichen Neugierde, die ganze Außenseite zu sehen, ehe ich um Einlass bat.
An der Hinterseite des Klosters fand ich einen angebauten Schuppen, dessen Dach größtenteils eingesunken war, und in dessen einer Seitenwand sich ein regelmäßiges Loch befand, das früher vielleicht ein Fenster gewesen war. Hinter diesem Schuppen wuchsen die Bäume so dicht, dass ich kaum erkennen konnte, ob der Boden sich dort hob oder senkte, und ob er mit Gras, Erde oder Steinen bedeckt sei.
Kein Laut unterbrach die drückende Stille; kein Vogel ließ sich im Walde hören, keine Stimme sprach im Klostergarten, keine Uhr im Kirchturme schlug, und selbst kein Hund bellte. Die Totenstille machte die Einsamkeit noch einsamer. Ich fühlte mich gedrückt, umso mehr, als ich nie den Aufenthalt in dichten Wäldern geliebt hatte. Die freie, offene Weite, wo das Auge in den blauen Himmel schauen und ungehindert schweifen kann, war mir stets lieber als das düstere, stille Waldesdunkel. Während ich an jenem Schuppen stand, fühlte ich die größte Neigung umzukehren und das Gehölz so schnell als möglich wieder zu verlassen, und würde dies unzweifelhaft getan haben, wenn mich nicht der Gedanke an meinen armen Freund davon abgehalten hätte. Es war sehr zweifelhaft, ob ich überhaupt Einlass in das Kloster fand, wenn ich auch die Glocke zog, und noch zweifelhafter, ob die Bewohner mir die geringste Auskunft über den Gegenstand meiner Nachforschungen eben konnten. Allein die Pflicht lag mir ob, kein Mittel unversucht zu lassen, und so entschloss ich mich, nach der Pforte zurückzukehren und die Glocke zu ziehen, was auch der Erfolg sein mochte.
Zufällig schaute ich in diesem Augenblicke an der Seitenwand des Schuppens in die Höhe, wobei es mir auffiel, dass das vorher erwähnte Loch ungewöhnlich hoch angebracht war; und während ich still stand, um es näher in Augenschein zu nehmen, wurde mir plötzlich die Schwüle der Luft noch lästiger, als sie bisher gewesen war. Ich wartete einige Augenblicke und nahm die Halsbinde ab, allein es half nichts, und ich glaubte zu entdecken, dass es noch etwas anderes als Schwüle sei, was mir so lästig war. Die Luft schien meiner Nase unangenehmer zu sein als den Lungen, und war mit einem mir bis dahin ganz unbekannten Geruche geschwängert, der desto stärker wurde, je näher ich dem Schuppen trat.
Diese Bemerkung führte mich leicht zu dem Orte seines Ursprungs und erregte meine Neugierde. Ich sammelte von den in großer Menge umher liegenden Mauer- und Ziegelsteinen eine genügende Anzahl, häufte sie unter der erwähnten Öffnung an der Wand übereinander, trat darauf und schaute – nicht ohne ein leises Gefühl von Scham – in das Innere des Schuppens.
Der entsetzliche Anblick, welcher sich meinen Augen darbot, ist mir heute noch so gegenwärtig, als wenn es gestern gewesen wäre, und selbst jetzt, nach so langer Zeit, kann ich nicht daran denken, ohne von einem Schauder überrieselt zu werden.
Das Erste, was ich zu erkennen vermochte, war ein liegender, lang ausgestreckter Gegenstand, auf einer Art von Schragen ruhend, der mit bläulicher Farbe bedeckt war, und die dunkeln Umrisse einer menschlichen Gestalt zu haben schien. Ich blickte wieder hin, und fand meine Vermutung bestätigt. Die Erhöhungen der Stirn, der Nase, des Kinnes waren wie durch einen Schleier gesehen erkennbar, ebenso die Wölbung der Brust, die Knie und die steif aufgerichteten Fußspitzen. Allmälig gewöhnte sich mein Auge an die im Schuppen herrschende Dämmerung – denn das Licht drang durch das eingesunkene Dach nur sehr dürftig ein – und ich überzeugte mich, dass der Gegenstand, den ich sah, nach der großen Länge zu schließen, der mit einem Leichentuche bedeckte Leichnam eines Mannes war. Das Tuch schien jedoch so lange auf dem Körper gelegen zu haben, dass es allmälig die bläuliche Farbe der Verwesung angenommen hatte.
Wie lange meine Augen auf diesen schrecklichen Anblick, diese widerlichen, die Luft verpestenden menschlichen Überreste gerichtet blieben, weiß ich nicht, nur entsinne ich mich, dass ein fernes Sausen unter den Bäumen an mein Ohr schlug, wie wenn der Wind sich erhöbe, und dass ein welkes Blatt langsam und lautlos durch das offene Dach auf den vor mir liegenden Körper fiel, was mich endlich wieder zur Besinnung brachte. Ich stieg von meinem erhöhten Standpunkte herab, setzte mich auf den Steinhaufen, und trocknete den dicken, meine Stirn bedeckenden Schweiß ab, dessen ich erst jetzt gewahr wurde. Meine Nerven waren furchtbar angegriffen und, wie ich deutlich empfand, nicht bloß in Folge jenes widerlichen Anblicks. Monktons Versicherung, dass wir, wenn es uns gelingen sollte, seines Oheims Leichnam zu entdecken, ihn unbeerdigt finden würden, fiel mir augenblicklich ein, sobald ich den Schragen mit seiner grauenhaften Last gewahrte. Ich dachte an die alte Prophezeiung, und eine dunkle Ahnung kommenden Übels stieg in mir auf, eine unerklärliche Bangigkeit bemächtigte sich meiner, und tiefes Mitleid erfüllte mich für den armen jungen Mann, der in der Stadt auf meine Rückkehr wartete. Die abergläubische Furcht hatte auch mich angesteckt und raubte mir fast meine klare Besinnung und Überlegung.
Endlich ermannte ich mich, eilte zur Klosterpforte, zog heftig die Glocke – wartete eine Weile, schellte von neuem, und hörte endlich Fußtritte näher kommen.
In der Mitte der Pforte, gerade meinem Gesichte gegenüber, war ein Schieber angebracht, der jetzt von innen geöffnet wurde. Hinter dem Drahtgitter zeigten sich dann ein Paar graue Augen, die mich neugierig anstarrten, und eine schwache heisere Stimme fragte:
»Worin besteht Ihr Verlangen?«
»Ich bin ein Reisender —«, begann ich.
»Wir leben in einem sehr armen Kloster«, unterbrach er mich, »und haben den Reisenden durchaus keine Merkwürdigkeiten zu zeigen.«
»Ich komme nicht in dieser Absicht, sondern nur um eine Frage von der größten Wichtigkeit zu tun, die, wie ich vermute, irgendjemand im Kloster zu beantworten im Stande sein wird. Wenn Sie mich nicht einlassen wollen, so kommen Sie mindestens heraus, um mit mir zu sprechen.«
»Sind Sie allein?«
»Ganz allein.«
»Befinden sich keine Frauenzimmer bei Ihnen?«
»Nein.«
Die Pforte wurde geöffnet, und ein alter, schwacher, mich argwöhnisch betrachtender und sehr schmutziger Kapuziner stand vor mir. Viel zu aufgeregt und ungeduldig, um lange Zeit mit einer Vorrede zu verlieren, sagte ich ihm kurz, dass ich durch die Öffnung in den Schuppen geblickt und daselbst einen Leichnam wahrgenommen hätte, und fragte ihn, wer der Mann sei, und weshalb er noch nicht beerdigt worden.
Der alte Kapuziner hörte mich misstrauisch an, blinzelte mit seinen triefenden Augen, während er in einer zinnernen Schnupftabaksdose vergeblich nach einigen darin zurückgebliebenen Körnern zu suchen schien, schüttelte dann den Kopf und äußerte , es sei allerdings der abscheulichste Anblick, auf den ein menschliches Auge fallen könne.
»Ich spreche nicht von dem Anblick«, war meine Antwort; »ich wünsche zu wissen, wer der Mann war, wie er starb, und weshalb er noch nicht beerdigt worden ist. Können Sie es mir sagen?«
Die Finger des Mönchs hatten jetzt drei oder vier Körner Tabak erhascht; er sog sie langsam ein, hielt die offene Dose unter die Nase, um jede Verschwendung zu verhüten, schnüffelte ein paarmal behaglich, und sah mich dann mit seinen triefenden Augen noch misstrauischer an als vorher.
»Ja, es ist ein hässlicher Anblick – der dort, im Schuppen«, sagte er, »ein sehr hässlicher Anblick.«
Ich hatte die größte Mühe, meine Gelassenheit zu bewahren. Mit Gewalt unterdrückte ich eine mir auf den Lippen schwebende sehr unehrerbietige Äußerung über Mönche im Allgemeinen, und machte noch einen Versuch, die mich ärgernde Verschlossenheit des alten Mannes zu besiegen. Glücklicherweise war ich selbst ein Schnupfer, und hatte eine mit dem besten Tabak gefüllte Dose in der Tasche. Diese zog ich jetzt als Bestechungsmittel hervor, sie war meine letzte Hilfsquelle.
»Ich glaube, Ihre Dose ist leer«, sagte ich; »wollen Sie nicht von meinem Tobak versuchen?«
Das Anerbieten wurde von ihm mit großer Bereitwilligkeit angenommen. Er holte die größte Prise, die ich jemals zwischen den Fingern eines Mannes gesehen, aus meiner Dose, sog sie langsam ein, ohne ein Körnchen zu verschütten, schloss halb die Augen, und klopfte mir dann mit väterlicher Miene auf die Schulter.
»Ah, mein Sohn«, sagte er, »welcher vortreffliche Tabak? Liebenswürdiger Reisender, geben Sie Ihrem geistlichen Vater noch eine Prise.«
»Erlauben Sie mir Ihre Dose zu füllen, ich habe immer noch genug für mich.«
Diese Worte waren noch nicht ausgesprochen, als sich schon seine Dose in meinen Händen befand. Mir abermals beifällig auf die Schulter klopfend, ergoss sich seine heisere Stimme in Lobsprüchen und Danksagungen. Ich hatte die schwache Seite des Kapuziners entdeckt und machte augenblicklich Gebrauch davon.
»Verzeihen Sie, wenn ich Sie noch einmal mit Fragen über jenen Gegenstand belästige«, begann ich; »allein ich habe besondern Grund zu wünschen, dass Sie mir alles mitteilen,
was zur Aufklärung über jenen entsetzlichen Anblick im Schuppen dienen kann.«'
»Treten Sie ein«, antwortete der Mönch.
Er zog mich in die Pforte, schritt über einen mit Unkraut bewachsenen Hof voran, und führte mich in ein langes, niedriges Gemach, worin sich keine anderen Mobilien befanden, als ein ziemlich schmutziger Esstisch, einige rohe Holzstühle und ein paar von Staub und Rauch geschwärzte Gemälde. Es war die Sakristei.
»Hier ist es hübsch kühl und wir sind allein«, sagte der alte Kapuziner.
Es war in der Tat so kalt und feucht darin, dass mich ein Schauder überlief.
»Möchten Sie vielleicht die Kirche sehen?« fuhr er fort, »ein wahres Juwel von einer Kirche; wenn wir sie nur in baulichem Stand erhalten könnten – aber wir können es nicht. Wir sind zu arm!«
Er schüttelte den Kopf und begann an einem großen Schlüsselbunde zu suchen.
»Bemühen Sie sich nicht!« rief ich. »Sagen Sie nur, ob Sie mir die erbetene Auskunft geben können oder nicht.«
»Alles, alles will ich Ihnen sagen – von Anfang bis zu Ende. Ich war es ja, der die Pforte öffnete, als geschellt wurde, denn es ist mein Geschäft«, versetzte der Mönch.
»Um des Himmels willen! Was hat denn das Schellen mit dem unbeerdigten Leichnam im Schuppen zu tun?«
»Hören Sie, mein Sohn, und Sie werden es erfahren. Vor einiger Zeit – es mögen mehrere Monate sein – ach! Ich bin alt und habe kein Gedächtnis mehr! – ich weiß nicht mehr, wie viele Monate es sind – ich bin ein armer, alter Mönch!«
Nach diesen abgerissenen Worten griff er wieder zu seinem einzigen Troste, der Dose.
»Es kommt auf die Zeit nicht an«, bemerkte ich, »fahren Sie nur fort.«
»Gut – also wir wollen sagen vor einigen Monaten. Die ganze Brüderschaft befand sich beim Frühstück – dem erbärmlichen Frühstück, mein Sohn, wie wir es hier im Kloster genießen – als wir plötzlich ‚piff! paff!' hören. ‚Schüsse,' sagte ich. ‚Was bedeuten diese Schüsse?' fragte Bruder Jeremias. ‚Es werden Jäger sein,' bemerkte Bruder Vincent. ‚Wenn ich es noch öfter höre, so werde ich hinaus schicken, um zu sehen, was die Schüsse bedeuten,' sagte der Pater Superior. Allein wir hörten nichts mehr, und fuhren mit unserem elenden Frühstück fort.«
»Aus welcher Gegend kamen die Schüsse?« fragte ich.
»Von dort, jenseits der dichten Bäume her, die an der Hinterseite unseres Klosters stehen, wo ein hübscher, ebener Rasenplatz ist, wenn sich nur nicht so viele Pfützen darauf befänden! Ach, mein Sohn, es ist hier bei uns sehr feucht und ungesund!«
»Nun, was geschah denn nach den Schüssen?«
»Sie werden es hören. Wir saßen noch alle beim Frühstück – ganz still; denn wovon sollen wir sprechen? Wir haben nur unsere Andachtsübungen zu verrichten, den elenden Küchengarten zu bebauen und unsere Mahlzeiten zu verzehren. Also wir saßen alle still und schweigend, als plötzlich die Glocke an der Pforte auf eine so fürchterliche Weise gezogen wurde, dass wir sämtlich erschraken, und uns die elenden Bissen im Halse stecken blieben. ‚Geh, mein Bruder', sagte der Pater Superior zu mir – ‚geh' und tue Deine Pflicht!' Ich bin mutig wie ein Löwe und gehorchte. Erst schlich ich mich auf den Zehen an die Pforte und wartete – horchte – zog den Schieber zurück, und wartete und horchte wieder, und blickte endlich hinaus; aber nichts, gar nichts war zu sehen. Mutig und furchtlos öffnete ich die Pforte. Ach, himmlische Mutter! was sah ich auf der Schwelle vor mir liegen? – Einen toten, großen Mann, viel größer als Sie und ich und irgendjemand hier im Kloster, mit schwarzen Augen, die stier und gebrochen gen Himmel blickten, und mit Blut bedeckt, das auf der Brust hervorzuquellen schien. Was tat ich? Ich schrie laut, ein – zweimal – und lief zum Pater Superior zurück.«