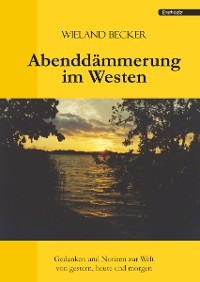Read the book: «Abenddämmerung im Westen»
Wieland Becker
ABENDDÄMMERUNG IM WESTEN
Gedanken und Notizen zur Welt
von gestern, heute und morgen
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2015
Für Chris, Conni, Hannelore, Fraka, Regina, Gisela, Jirka und Rudolf
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2015) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Titelfoto: Wolfgang Buddrus, Altefähr
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
INHALTSÜBERSICHT
Cover
Titel
Impressum
Vorwort
Geschichtslos, ratlos, planlos ... Warum findet die Welt keinen Frieden?
I. Leben zwischen Krieg und Frieden
Exkurs zum Soldatenleben zu DDR-Zeiten
II. Heldengeschichten?
III. Die Toten und die Überlebenden
Zwei „Tauben“ unter den „Falken“
Nachrichten von Kriegsschauplätzen oder: Der Abschied von Clausewitz
Lateinamerika oder: Der wahre Wert westlicher Menschenrechte
Exkurs Naher Osten
Zerfall eines Imperiums und ein neues Zeitalter des Aufbruchs zu den alten Ufern
Ein „Kainsmal“ des XX. Jahrhunderts
Die Unschuldigen mit den blutigen Händen
IV. Man wird nicht als Soldat geboren
V. Wann kommt er, der ewige Frieden?
Der Triumph des Neoliberalismus über die Demokratie
VI. Schluss-Punkt
Vabanquespiel „Zukunft“
Von der Transformation von 1989 zum Stand der Dinge 2014
Über gewollte und tatsächliche Unwissenheit in der Politik
Das Jahr 1989 – Vorgeschichte, Verlauf und Folgen
Die neue internationale Ordnung – Ziele und Strategien
Chronologie I Der afghanische Kriegsschauplatz 1979 bis 2014
Afghanistan nach dem Abzug der sowjetischen Streitkräfte 1989 bis 1994
Die Herrschaft der Taleban 1996 bis 2003
Chronologie II Kriegsschauplatz Irak 2003 - 2014
Die Welt nach dem 11. September
„Operation Iraqi Freedom“
Die mediale „Inszenierung“ der Welt
Wie wir Amerikas Präsidenten lieben
Chronologie III Der „Arabische Frühling“
Zu Ursachen, Beginn und Verlauf des „Arabischen Frühlings“
Ägypten, Kairo, „Tahrir-Platz“
Libyen – ein Machtkampf und das grausame Ende eines schrecklichen Diktators
Chronologie IV Syrien – ein endloser, verheerender Bürgerkrieg im Spannungsfeld Naher Osten
Chronologie V Die „Causa“ Ukraine
Vom Beginn der Proteste im November 2013 bis zur Besetzung des „Maidan“ Anfang 2014
Von der Besetzung des „Maidan“ bis zum Sturz Janukowytschs
Die selbsternannte neue Regierung und die „Krimkrise“
Zur westlichen bzw. deutschen Politik in der Ukraine und gegenüber Russland – ein Fazit
Denkt man an Deutschland
Die Demokratien des Westens und der Islam
Wohin treibt der neoliberale Finanzkapitalismus die Welt?
Exkurs zu Bedrohungen der Zukunft
Syrien, Giftgasangriff und Obamas „Rote Linie“
Im Namen der unvergleichlichen deutschen Demokratie!
Januar 2015 Tage des Todes
Unerwartete Wandlungen und Hoffnungen
Terry Eagleton – Katholik und Marxist
Katholizismus und Marxismus – zwei feindliche Brüder
Unzeitgemäße Erinnerungen und Befindlichkeiten
Zum Tag der deutschen Einheit 2013
25 Jahre nach dem „Mauerfall“ oder: Wofür steht die Bundesrepublik?
POST SCRIPTUM
Literatur- und Materialübersicht
Endnoten
VORWORT
Wird es sie je geben?
„Ich schreibe ein Buch über den Krieg. Ich, die ich keine Kriegsbücher mochte, obwohl sie in meiner Kindheit und Jugend bei all meinen Altersgenossen die gängige Lieblingslektüre waren. Das ist nicht weiter erstaunlich – wir waren Kinder des Sieges. Kinder der Sieger. Was erinnere ich noch vom Krieg? Mein kindliches Unbehagen vor unbekannten und furchteinflößenden Worten. Über den Krieg wurde unentwegt gesprochen: in der Schule, zu Hause, bei Hochzeiten und Taufen, an Feiertagen und auf dem Friedhof. Sogar unter Kindern. Der Krieg blieb auch nach dem Krieg die Heimstatt unserer Seele. Alle lebten dort, alles hatte seinen Ursprung in dieser schrecklichen Zeit, auch in unserer Familie: Mein ukrainischer Großvater, der Vater meiner Mutter, ist an der Front gefallen, meine weißrussische Großmutter, die Mutter meines Vaters, ist bei den Partisanen an Typhus gestorben, zwei ihrer Söhne sind verschollen, von den dreien, die sie an die Front geschickt hatte, kam nur einer zurück – mein Vater. Schon als Kinder kannten wir keine Welt ohne Krieg, die Welt des Krieges war die einzige Welt, und die Menschen des Kriegs die einzigen Menschen, denen wir begegneten. Ich kenne auch heute keine andere Welt und keine anderen Menschen. Hat es sie je gegeben?“
Swetlana Alexijewitsch im Jahre 2003*
Als 1990 die Sonne über dem kommunistischen Osten unterzugehen begann, endete eine Epoche der Konfrontation zwischen kapitalistischen und sozialistisch-kommunistischen Staaten, die sich nach dem Ende des II. Weltkrieges in Blöcken gegeneinander verbunden hatte. Als nach der russischen Oktoberrevolution die Sowjetunion geschaffen wurde, nahm diese Konfrontation ihren Anfang, denn die Staaten Europas, dazu noch Japan, mobilisierten noch während des I. Weltkrieges ihre Kräfte, um der russische Konterrevolution zum Siege zu verhelfen. 1920 war dieser Versuch gescheitert. Mit äußerster Härte wurde dagegen die Ausweitung auf Europa, insbesondere auf Deutschland verhindert.
Sechs Jahre kämpften ab 1939 Frankreich, Großbritannien, die Sowjetunion und schließlich auch die USA in Europa und in Ostasien gegen den faschistischen Verbund von Deutschland, Italien und Japan. Ungeheure Opfer und Anstrengungen waren notwendig, um einen weltbeherrschenden Sieg des Faschismus zu verhindern. Mit den nach dem Krieg geschaffenen Machblöcken brach die Zeit des „Kalten Krieges“ an, die sich auf Europa beschränkte. Denn Kriege gab es außerhalb Europas permanent. Vor allem war es die USA, die mit ihrem antikommunistischen Feldzug, immer wieder zu den Waffen griff.
Die kommunistische Welt hatte gerade 72 Jahre Bestand. Es war ein globales Scheitern eines großen Gesellschaftsentwurfs, der in der Realität kommunistischer Herrschaft sehr schnell und radikal zur Legitimation der Herrschaft Partei-Eliten verkam, die sich auf Karl Marx berufend, weder willens waren, in dessen Sinne eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen, noch bereit waren, ihre Herrschaft durch demokratische Entscheidungen zu legitimieren.
Der „Kalte Krieg“ war nur eine Dominante in der Systemauseinandersetzung. Die andere war der dauerhafte und in gewisser Weise gnadenlose ökonomische und politisch-ideologische Wettbewerb. Auf diesem Feld fiel schließlich die Entscheidung.
Das Lager des Kapitalismus entwickelte nach 1945 eine Art Doppel-Strategie, die zum einen auf der Einsicht aufbaute, dass es im Zeichen dieser Konfrontation notwendig war, sich der Mehrheit der Bevölkerung zu versichern. Dazu diente nicht nur die soziale Marktwirtschaft. Mit außerordentlich suggestiver Wirkung wurden die Inhalte von Demokratie und Freiheit besetzt und zum Argument gegen den Sozialismus, dessen Herrschaftssystem auf der „Diktatur des Proletariats“ basierte. Da es dem sozialistischen Wirtschaftssystem zu keiner Zeit gelang, den Vorsprung an Produktivität und Technologie zu verringern und letztlich durch den „Rüstungswettlauf“ seine Volkswirtschaft zusätzlich überforderte, musste der einzig ernsthafte Reformversuch mit dem Jahr 1985 erfolglos bleiben.
Nach vierzig Jahren kam es zur radikalsten globalen Wandlung nach dem Ende der Kolonialherrschaft und der chinesischen Revolution von 1949. Nun gab es nur noch den einen Machtblock, der militärisch und wirtschaftlich die Welt dominieren konnte.
Auch wenn ein Zusammenhang nicht nachweisbar ist: Mit der Transformation eines regulierten Kapitalismus zu einem Kapitalismus des „freien Marktes“ ohne Regulierungsmöglichkeiten durch die demokratisch legitimierten Parlamente bzw. Regierungen, wurde bereits in den 80er Jahren die Grundlagen für eine Rückkehr zu einem imperialen Kapitalismus geschaffen.
Geht man davon aus, dass die politische, wirtschaftliche und militärische Stärke der westlichen Demokratien sowohl Dominanz als auch eine globale Verantwortung bedeuten – wer sonst hätte 1990 diese Aufgabe übernehmen sollen –, dann ist es an der Zeit zu fragen, wie der westliche Staatenbund in seinem auf Demokratie, Freiheit und Menschenrechte basierenden Selbstverständnis, seinen Möglichkeiten und seiner Verantwortung in den zurückliegenden 25 Jahren gerecht geworden ist.
GESCHICHTSLOS, RATLOS, PLANLOS ... WARUM FINDET DIE WELT KEINEN FRIEDEN?
I. Leben zwischen Krieg und Frieden
Geboren wurde ich am 31. August 1939, also am letzten Friedenstag im „Tausendjährigen Reich“. Meine ersten Erinnerungen bestehen aus fragmentarischen Bildern, die – was mir natürlich nicht bewusst sein konnte – mit dem Zweiten Weltkrieg verbunden waren. Mitten in einer Nacht wachte ich auf und jemand beugte sich über mich. Das Licht einer Wandleuchte war durch Rauch verdunkelt, sodass ich nur eine weiße Haube erkennen konnte, bevor ich wieder einschlief. Das nächste Erinnerungsstück ist eine riesige erleuchtete Halle, in der ich auf dem Fußboden lag. Und später, als ich nochmals die Augen öffnete, wurde ich durch eine Straße getragen und auf der rechten Seite stand ein Haus in Flammen und unzählige Funken flogen in den dunklen Himmel.
Später erfuhr ich dann den Verlauf jener Nacht vom 3. zum 4. Dezember 1943. Ich lag frisch operiert in der Leipziger Kinderklinik, die durch Bomben zerstört wurde. Die Schwestern retteten ihre Patienten und brachten sie in einen nahegelegenen Bunker. Nach der Entwarnung machte sich meine Mutter auf den kilometerlangen Weg zum Krankenhaus. Sie wusste bereits, dass die Kinderklinik schwer getroffen worden war. Sie fand mich und trug mich durch das brennende Leipzig nach Hause. Erst viel später wurde mir klar, dass ich dieser Krankenschwester, deren Haube das einzige ist, woran ich mich erinnere, mein Leben verdanke.
1944 wurde unsere Familie – meine Mutter mit uns fünf Geschwistern – in den damaligen Sudetengau evakuiert. Unser Vater, damals schon Anfang 40 und auf einem Auge fast blind – war zu dieser Zeit doch noch zur Wehrmacht eingezogen worden. Dort – in Teplitz-Schönau – erlebten wir den Einmarsch der Roten Armee, genauer wir hörten unten im Tal das Dröhnen der Panzer. Irgendwann begann der Weg nach Hause quer durch Sachsen und – nach einem längeren Aufenthalt in einem Barackenlager bei Wurzen – durften wir die Mulde auf einem Steindamm überqueren und standen schließlich vor unserem Holzhaus, das ich, wie ich meinte, zum ersten Mal sah. Schließlich kam auch unser Vater nach Hause.
Im Gegensatz zur Innenstadt war unser Leipziger Vorort Probstheida kaum zerstört. Nur das Völkerschlachtdenkmal war durch Granatfeuer auf einen der unteren Bögen beschädigt. Dort, so erfuhr ich später, hatten sich die letzten fanatischen Verteidiger Leipzigs verschanzt.
Die Trümmerlandschaft Leipzigs sahen wir nur dann, wenn wir „in die Stadt“ fuhren. Im Gedächtnis blieben mir die Ruine der Johanniskirche und der zerstörte Hauptbahnhof.
An den Krieg erinnerten die Kriegsversehrten – Männer mit ihren Krücken, das eine Hosenbein am Gürtel befestig, oder jene, die eine dunkle Brille trugen und die gelbe Armbinde mit den schwarzen Punkten, oder der Mann ohne Beine, der sich auf einem aus Brettern und Kugellagern selbstgebauten Gefährt mit Hilfe der Hände vorwärts bewegte.
Als wir drei Jungen 1951 mit unserem Vater in die Sächsische Schweiz nach Bad Schandau fuhren, machten wir in Dresden Station; auf dem Weg zur Dresdener Diakonie, in der eine unserer Tanten tätig war, führte unser Weg durch eine endlose Trümmerlandschaft, mit einem schmalen begehbaren Streifen, den die Trümmer nicht bedeckten. Damals dachte ich dass es unmöglich sei, diese Trümmerberge jemals zu beseitigen. An die Jahre nach dem Krieg habe ich – abgesehen vom Hunger, von der beißenden Kälte im Winter und dem Lebertran – viele gute Erinnerungen. Im November 1945 wurde ich eingeschult – mit Griffel und Schiefertafel. 1947 und 1949 kamen zwei Schwestern hinzu, sodass wir Jungen jetzt von vier Schwestern „eingerahmt“ waren, bis heute.
Der Generation zugehörig, die in früher Kindheit mitbekam, dass Krieg war und mit den Folgen dieses Krieges schon bewusster umging, wurde ich von Sätzen wie „Nie wieder Krieg“ oder „Wer jemals wieder ein Gewehr anfasst, dem soll die Hand abfallen.“ beeinflusst. In den ersten Nachkriegsjahren prägten sie auch uns Kinder – in gewisser Weise bis heute.
Dem Frieden, den sich – nach den bitteren Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges – so viele so sehr erhofft hatten, war keine Dauerhaftigkeit beschieden. Im geteilten Deutschland waren schon wenige Jahre später wieder militante Töne zu hören. Es war der „Kalte Krieg“, der zur Wiederaufrüstung im Osten wie im Westen führte. Der Kommunismus bedrohe den Weltfrieden hieß es auf der einen Seite – die Imperialisten unterdrückten andere Länder und plünderten sie aus – auf der anderen. Selbst die alten NS-Eliten aus Militär, Justiz und Wirtschaft wurden dort rehabilitiert, weil sie im Kampf gegen den schlimmsten Feind der Menschheit, den Bolschewismus, dringend gebraucht würden. Und schon Ende der vierziger Jahre gab es die ersten Nachrichten von neuen Kriegsschauplätzen, fern von Europa und doch sehr nahe.
So war es irgendwie folgerichtig, dass ich mich sowohl mit dem vergangenen Krieg als auch mit NS-Diktatur zu beschäftigen begann. Denn deren „Spuren“ waren täglich gegenwärtig: Trümmerberge, Begegnungen mit Überlebenden der Konzentrationslager im Bekanntenkreis der Eltern oder in der Schule, Klassenkameraden ohne Väter… Und dazu Filme und Bücher.
Das wahrscheinlich erste filmische Dokument zur NS-Zeit, das ich bewusst sah, war der von britischen Kameraleuten gedrehte Film über die Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Noch heute sehe ich diese Bilder vor mir: Eine Planierraupe, die Berge von ausgemergelten Toten, in Häftlingskleidung oder nackt, in ein Massengrab schiebt, wo sie in schrecklichen Verrenkungen auf die bereits im Grab befindlichen Körper fallen.
Es gab Ende der vierziger Jahre die ersten Filme, von denen der polnische Film „Die letzte Etappe“ (Ostatni etap/ 1948) der einprägsamste war, selbst wenn man nicht wusste, dass die Regisseurin Wanda Jakubowska und die Verfasserin des Szenariums, Renate Deutsch, zu den Überlebenden von Auschwitz gehörten und drei Jahre danach wieder in das Todeslager gingen, um dort diesen Film zu drehen. Auch ohne dieses Wissen spürt man die besonders bedrückende Authentizität dieses Films. Es wären noch sehr viele Filme und Bücher aus aller Welt zu nennen, die mir ebenso bis heute wichtig sind, wie auch eine Vielzahl historischer Betrachtungen, Analysen und Dokumentationen zum II. Weltkrieg und den folgenden Kriegsschauplätzen, die seitdem verfasst wurden. Wenn ich hier Konstantin Simonow nenne, dann deshalb, weil zwei der Titel seiner Romantrilogie für mich zu grundsätzlichen Fragen führten: „Man wird nicht als Soldat geboren“ und „Die Lebenden und die Toten“.
Exkurs zum Soldatenleben zu DDR-Zeiten
Wenn ich mich an die 60er Jahre erinnere, dann gehört die Kubakrise zu den Ereignissen, die mir auch deshalb im Gedächtnis blieben, weil sie mit persönlichen Erlebnissen verbunden war. Mein jüngster Bruder diente in dieser Zeit als Unteroffizier in der Nationalen Volksarmee. Mit Ausbruch der Krise wurde seine Einheit in Alarmbereitschaft versetzt. Das hieß 24-Stunden-Dienst in einem Bunker (im Rhythmus von jeweils 8 Stunden Dienst, Bereitschaft und Schlaf, über Wochen). Statt im August wurde er erst im Oktober entlassen. Gesehen haben wir ihn in diesen langen Wochen nicht einmal. Von den bei Erfurt stationierten Einheiten war schon damals „bekannt“, dass sie, gleich ob Abwehr oder Angriff, innerhalb der ersten 24 Stunden völlig aufgerieben sein würden.
Denke ich an die 70er Jahre, so erinnere ich mich – damals 34jährig – an meinen Einberufungsbefehl, der mich für einen halbjährigen Wehrdienst verpflichtete. (Er kam insofern überraschend, da ich mit 24 Jahren ausgemustert worden war.) Die Grundausbildung mit ihren körperlichen Anforderungen und den kleinen und großen Schikanen bewältigte ich recht gut. Was mich besonders interessierte war, wie das System Armee funktionierte. So diente und beobachtete ich …
Unfreiwillig war ich ein sehr guter Schütze. Dieser Umstand forcierte mein Nachdenken über die Frage, ob ich mit der Kalaschnikow auch gezielt auf Menschen schießen würde. Obwohl ich mir das anfangs nicht vorstellen konnte, begriff ich in diesen Monaten, dass auch ich schießen müsste, weil ich sonst am Tod der anderen Soldaten neben mir mitschuldig werden würde. Der einzige Ausweg, der bliebe, wäre, sich vor dem ersten Gefecht selbst zu töten.
Eine weitere Erfahrung war der „Atomino“ genannte Strahlenschutzanzug. Bei der ersten „Anprobe“ dieses monströsen Anzuges (in dem man sogar im November schon beim Anziehen wahnsinnig zu schwitzen begann und unbeholfen lief) galt eine Normzeit von 18 Minuten, die erst nach mehreren Übungen zu schaffen war. Irgendwann wurde diese Norm auf 25 Minuten erhöht, was mich und andere nachdenklich machte, denn Erhöhungen einer Normzeit war eigentlich undenkbar. Welchen Grund es dafür gab, versuchten wir herauszufinden. Bot der Anzug einen wirksamen Schutz vor der unsichtbaren Strahlung, erst wenn 25 Minuten vergangen waren? Oder musste er, um überhaupt Schutz zu bieten, sorgfältiger angelegt werden, als es in 18 Minuten möglich war? Insgeheim dachte ich damals, wenn es je dazu kommen sollte, dann wollte ich lieber ganz nahe am Zentrum der Explosion sein, damit es schnell vorüber wäre.
Jahrzehnte später las ich einige der Gesprächsprotokolle, die Swetlana Alixijewitsch mit Überlebenden von Tschernobyl geführt hatte. Ich habe das Buch nie zu Ende lesen können. Aber das, was ich las, bestätigte mir auf schreckliche Weise, dass mein damaliger „Wunsch“ der einzig sinnvolle war.
Für den Ernst-Fall hatten wir zwei Bereitstellungsräume: Einen nahe der Grenze zur BRD im Falle eines eigenen Angriffs und den zweiten östlich von Leipzig im Falle eines Angriffs der Nato.
Mit dem Tag der Entlassung musste ich wirklich schlagartig erkennen, dass mich dieses eigentlich kurze halbe Jahr bereits verändert hatte, und ich brauchte mehr als nur ein paar Tage, um wieder zu mir zurückzufinden. Anfänglich war ich nahezu fassungslos, wie nachhaltig das Soldat-seinmüssen – trotz aller Reflexionen und Gespräche über diese besondere Lebenssituation – mich zu ändern vermocht hatte.
Die härteste Prüfung war ein Manöver, bei dem ein Panzerangriff auf dem Plan stand. Wir fuhren mit unserem kleinen Funk-Auto zwischen diesen Ungetümen herum und waren heilfroh, unbeschadet – ohne Kollision – davon zu kommen. In diesen Stunden habe ich mich keine Sekunde als heldenhaft erlebt. Der einzige Gedanke war: Hoffentlich kommst du hier heil wieder raus.
Nach diesen Monaten erschienen mir der Mythos um soldatisches Heldentum, die Legenden wie auch die vorgeblichen „Tatsachenberichte“ – je länger ich mich mit diesem Thema auseinandersetzte – immer fragwürdiger und schließlich unannehmbar. Wie kann das Töten anderer Menschen auf Befehl etwas Heldenhaftes sein? Auch Soldaten, die einen Verteidigungskrieg führen, müssen unmenschlich handeln, wenn sie siegen und überleben wollen, zumal ihnen die Befehle ohnehin keine andere Wahl lassen. Sicher gab es todesmutige, tollkühne, den Tod verachtende Soldaten. Aber Helden? Sind wirkliche Helden nicht vielmehr jene, die ihr eigenes Leben riskieren, um das Leben anderer zu retten?
Wann genau es war, dass ich damit begann, Kriege von den Gefallenen, Niedergemetzelten, den Verkrüppelten, den Witwen und Waisen her zu begreifen, weiß nicht mehr genau; aber alle weiteren Studien, Analysen und Wertungen von Dokumenten und Darstellungen haben mich in meiner Überzeugung, dass es nur mit dieser Sicht möglich wird, Krieg wirklich zu begreifen, immer aufs Neue bestärkt.