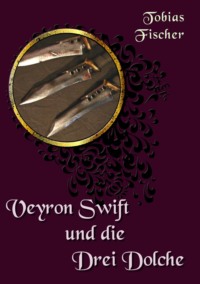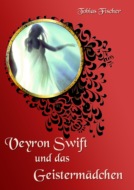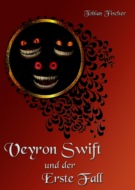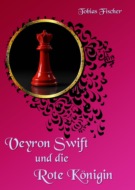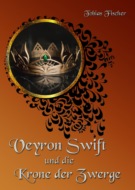Read the book: «Veyron Swift und die drei Dolche»
Tobias Fischer
Veyron Swift und die drei Dolche
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Veyron Swift und die drei Dolche
Mehr von Veyron Swift:
Impressum neobooks
Veyron Swift und die drei Dolche
Bisher war das Londoner Dezemberwetter scheußlich gewesen, nass und kalt, mit wenig Schnee, aber viel Regen. Zum Glück blieb es heute Nacht einigermaßen ruhig. Tom Packard war froh darum, denn in seinem Dachbodenzimmer bekam er den Regen stets als erster zu hören und konnte oft die halbe Nacht nicht schlafen. Zumal der Regen auch jeden Versuch verhinderte sich zu konzentrieren.
Gerade zermarterte er sich das Gehirn an einigen besonders kniffligen Matheaufgaben, als es unten im Erdgeschoss wie verrückt zu läuten begann. Tom schreckte hoch und warf einen hastigen Blick auf seinen kleinen Wecker. Es war ja mitten in der Nacht! Wieder klingelte es. Da sich im ganzen Haus nichts rührte, schwang er sich widerwillig von der Couch und eilte die Stufen nach unten – barfuß. Eigentlich sollte er ja längst im Bett sein. Wo um alles in der Welt war Veyron und warum machte er nicht auf?
Die Räumlichkeiten seines Paten lagen ein ganzes Stockwerk tiefer und er wäre vermutlich viel schneller an der Tür gewesen. Andererseits würde es Tom auch gar nicht wundern, wenn es am Ende Veyron war, der auf die Klingel drückte. Angesichts seiner zahlreichen Aktivitäten in der letzten Zeit, lag die Wahrscheinlichkeit dafür sogar recht hoch.
Ohne einen Blick durch den Türspion zu werfen, riss Tom die Haustür auf.
»Haben wir wiedermal den Schlüssel vergessen, Meister Swift?«, fragte er mit gespieltem Tadel, nur um gleich darauf zurückzufahren. »Oh.«
Vor der Tür standen drei Personen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Zwei hochgewachsene Männer, der eine zaunlattendürr und der andere so dick, dass er sich rollend wohl leichter fortbewegen könnte, als auf seinen kurzen Beinen. Zu seiner Rechten stand eine dünne, junge Frau mit blassem Gesicht, nur halb so alt wie ihre beiden Begleiter; mindestens.
»Mr. Swift, gottseidank sind Sie noch auf«, keuchte der Dicke los, zwängte sich durch die Tür herein ohne um Erlaubnis zu fragen. Der Dünne folgte und zog dabei die junge Frau mit. Verstört und sichtlich verunsichert suchte sie irgendetwas auf dem Boden.
»Ich bin Charles Melvin Pureberry, das ist mein Chauffeur Lucas und meine Frau, Linda«, stellte sich der Dicke und seine beiden Begleiter vor. Er schnaufte schwer, sah sich hastig im engen Flur um, als suchte er nach Anzeichen von Gefahr. Tom wurde sofort klar, dass dieser Mann sich vor etwas fürchtete – oder vor jemanden. Der Chauffeur schloss die Haustür und erst jetzt kam Pureberry etwas zur Ruhe. Der Blick seiner kleinen, grauen Äugelein blieb an Tom kleben. Ungläubig runzelte er die Stirn.
»Ehrlich gesagt, hatte ich Sie mir größer und wesentlich älter vorgestellt. Verzeihen Sie, Sir, aber Sie sind ja noch ein regelrechtes Kind!«, schnappte er aufgebracht. Tom wollte soeben antworten und die Sache richtig stellen, als sich gerade ein böser Streich in seinen Gedanken manifestierte. Der Fettsack wusste wohl nicht, wen er da vor sich hatte. Tom war alles andere als ein Kind, stand kurz vor seinem sechzehnten Geburtstag und hatte sich bereits mit allerhand Dämonen herumgeschlagen. Das konnte man von kaum einem anderen Jugendlichen in London behaupten.
»Ja, das höre ich oft. Meine Ergebnisse sprechen jedoch für sich, wie Sie sehen werden. Also bitte, folgen Sie mir ins Wohnzimmer, Gentlemen«, gab er mit scharfer Stimme zurück, Veyrons Sprechweise so gut nachahmend, wie er konnte. Pureberry schien er sofort überzeugt zu haben, sein Chauffeur hingegen grunzte nur verächtlich. Dennoch folgte er seinem Boss und Tom, Linda im Schlepptau. Das Verhalten der jungen Frau gefiel Tom gar nicht. Irgendetwas stimmte nicht mit ihr. Vielleicht war sie der Grund für Pureberrys späten Besuch?
Im Wohnzimmer angelangt, schaltete Tom das Licht an, nur um gleich darauf fast zu Tode zu erschrecken. Auch Pureberry und seiner Frau entfuhr ein Ausruf des Schreckens.
»Willkommen in der Wisteria Road, Mr. Pureberry!«, rief eine dunkle Stimme.
In seinen weinroten Morgenmantel eingewickelt, thronte Veyron Swift im großen Ohrensessel. Hochgewachsen, das Gesicht hager, die stechenden, eisblauen Augen auf seine Besucher gerichtet, faltete er die Fingerspitzen aneinander.
»Wo zum Teufel kommen Sie denn jetzt her?«, schimpfte Tom seinen Patenonkel.
Veyron lächelte amüsiert ob dieser scheinbar einfältigen Frage. »Ich war die ganze Zeit hier, Tom.«
»Warum zum Teufel machen Sie dann nicht auf? Es ist Ein Uhr nachts, Mann!«
»Ich habe das Klingeln durchaus gehört. Allerdings war ich anderweitig beschäftigt.«
»Mit was?«
»Mit Nachdenken. Nun denn … Kommen Sie herein, Gentlemen und setzen Sie sich. Mr. Pureberry, bitte auf die Couch, und Ihre reizende junge Frau gleich daneben. Und Mr. Lucas – oder wie immer Sie auch heißen, bitte setzen Sie sich auf …«
»Ich bleibe lieber stehen. Das hier ist doch der reinste Circus«, grummelte der Chauffeur verächtlich. Pureberry und seine Frau taten dagegen wie angewiesen. Die Federn der Couch quietschten entsetzlich und Tom befürchtete fast, sie könnte unter dem enormen Gewicht des Fettsacks zusammenbrechen. Zum Glück hielt sie jedoch stand.
»Verzeihen Sie den Auftritt meines jungen Assistenten, Mr. Pureberry. Aber seien Sie versichert, er hätte mich in meiner Abwesenheit sicher hervorragend vertreten. Wenn Sie also soweit sind, erzählen Sie mir, welches Problem Sie beschäftigt, dann will ich sehen, ob und wie ich Ihnen helfen kann«, bat Veyron seinen neuen Klienten.
Für gewöhnlich zögerten die Leute immer, wenn es um mysteriöse Vorkommnisse ging, wenn sie von Kobolden oder Geistern heimgesucht wurden. Tom kannte das inzwischen.
Pureberry zeigte jedoch keinerlei Zurückhaltung. »Sie sind genau der Mann, den ich brauche, Mr. Swift. Ich fürchte um mein Leben – und um das meiner geliebten Frau. Wir werden bedroht, Sir. Von Kobolden oder noch schrecklicheren Monstern.«
Lucas Wieauchimmer gluckste leise und schüttelte kaum merklich den Kopf. Doch sein Dienstherr bekam es dennoch mit. Pureberrys feiste Backen liefen knallrot an.
»Du wartest draußen beim Wagen, Lucas«, knurrte er, sichtlich darum beherrscht, nicht laut loszubrüllen. Die geballten Fäuste des Dicken verrieten Tom, dass Pureberry kein Mann von Gemütlichkeit schien, wohl eher ein tyrannischer Choleriker.
Mit einem letzten abfälligen Blick in Tom und Veyrons Richtung, verschwand er wieder durch die Haustür – ohne sich zu verabschieden. Tom gefiel dieses Benehmen gar nicht. Veyron schien sich dagegen nicht daran zu stören.
»Kobolde, sagten Sie? Sind Sie da auch ganz sicher?«, fragte er, ohne sich mit weiteren Floskeln aufzuhalten.
Pureberry wirkte noch immer zornig, seine Stimme klang gereizt laut. Seine arme Frau schaute die ganze Zeit in eine andere Richtung.
»Natürlich, Sir! Ich habe diese kleinen Monster selbst gesehen. Scheußliche Gesichter, eine grauenhafte Sprache und Mordinstrumente in jeder Hand. Sie stellen mir schon seit Wochen nach, seit Wochen! Sie lauern nachts im Garten, einmal sind Sie sich sogar ins Haus eingedrungen und haben meine Frau erschreckt. Meine arme Linda, sie ist seitdem total verstört. Verstehen Sie das? Wir glaubten bislang nicht an solchen Unfug, aber seit dieser einen Nacht, seit dieser einen Nacht, nun, seitdem ist alles anders. Es waren wahrhaftig Kobolde, Mr. Swift, mordgierige, glotzäugige Kobolde!«
Veyron studierte die beiden Pureberrys für einen kurzen Moment.
»Wie ich sehe, sind Sie vor kurzer Zeit zu großem Wohlstand gekommen. Davor waren Sie harte Arbeit gewohnt, Schweißer, wenn ich mich nicht irre. Jetzt verlassen Sie Ihr Anwesen jedoch nur noch selten. Ob das an den Problemen liegt, die Ihnen Ihr rechtes Bein bereitet? Eine alte Verletzung, die Sie sich im Ausland zugezogen haben, vielleicht in der Dritten Welt« sagte er, die Fingerspitzen konzentriert aneinandergelegt.
Pureberrys Augen weiteten sich überrascht. Eine neue Röte stieg in seine Pausbacken. »Woher wissen Sie das? Wer hat ihnen das gesagt?« Sein Ton klang giftig.
»Das schockierende Erlebnis, von dem Sie berichteten, hat sich erst heute Abend ereignet und Sie sind sehr hastig aufgebrochen, mitten unter dem Abendessen. Also gut, Mr. Pureberry, ich werde mir Ihren Fall anhören. Bitte erzählen Sie mir alles, vergessen Sie nicht das kleinste Detail. Auch über die Aussagen von Mrs. Pureberry wäre ich sehr dankbar«, fuhr Veyron ungehindert fort.
Pureberry schnappte erst einmal nach Luft, dann nestelte er nervös an seinem Kragen. »Ich habe Ihnen doch schon erzählt, dass mir Kobolde auflauern. Sie müssen gegen diese Monster etwas unternehmen! Sie sind doch versiert darin, Kobolde zu jagen, so steht es auf Ihrer Internetseite. Ich habe außerdem von dieser Geschichte mit dem Troll aus Woking gehört und auch von den Vampiren aus Surrey, die Sie im Alleingang ausgeschaltet haben«, schnaubte er, einen neuen Zornesanfall niederkämpfend.
Veyron blieb ganz gelassen, wie es seine Art war. Ihn konnte scheinbar wirklich nichts erschüttern.
»Sie erwähnten den Fall im Groben, aber um Ihnen helfen zu können, brauche ich Details. Die Anzahl der Kobolde, genauere Beschreibungen der Kreaturen, um die Hierarchie ihrer Bande festzulegen und noch mehr«, erklärte er geduldig.
»Ich habe diese Kreaturen im Dunkeln doch kaum gesehen!«, protestierte Pureberry.
Veyron wandte sich an die junge Frau, wartete, bis sie es wagte, seinen Blick zu erwidern. Den zornesroten Pureberry ignorierte er vollkommen.
»Nun, Mrs. Pureberry. Wie steht es mit Ihnen? Konnten wenigstens Sie einen genaueren Blick auf diese Kobolde werfen?«
Sie zuckte zusammen, sah ihnen Mann hilfesuchend an. Dann schüttelte sie den Kopf.
»Nein«, sagte sie. »Es … es war einfach zu dunkel, genau wie Charles es sagte.« Ihre Stimme war mehr ein Flüstern, voller Unsicherheit und Angst.
Tom hegte sofort den Verdacht, dass Pureberry bestimmt kein besonders netter und umgänglicher Gatte war. Es wunderte ihn sehr, was diese junge Frau, vielleicht gerade mal fünf Jahre älter als er selbst, an diesem alten, fetten Choleriker finden konnte. Wahrscheinlich sein Geld, dachte er finster. Ob das den Preis einer Ehe mit diesem Tyrannen wert ist?
Veyrons lautes Seufzen, riss ihn aus den Gedanken. Mit einem Satz sprang sein Pate aus dem Sessel, trat vor das große Wohnzimmerfenster und schaute hinaus in die Finsternis.
»Tut mir leid, Mr. Pureberry. Aber unter diesen Umständen kann ich Ihnen nicht helfen. Ich muss Ihren Fall ablehnen«, sagte Veyron, so kalt und geschäftsmäßig wie ein Roboter. Pureberrys gewaltige Körpermaße schoss ruckartig in die Höhe. Seine Frau zuckte ängstlich zusammen.
»Was?«, entfuhr es ihm brüllend. »Ich werde bedroht, verflucht noch mal! Ich brauche Ihre Hilfe!«
»Dann sollten Sie ehrlich zu mir sein, Pureberry, vollkommen ehrlich. Und genau das sind Sie nicht. Sie belügen mich.«
»Ich bezahle Ihnen das Dreifache!«
»Ich habe meine festen Sätze, Pureberry. Tom kann Ihnen eine Tabelle mitgeben, wenn Sie wollen. Ich nehme weder weniger noch mehr. Und Ihr trauriger Versuch, mich zu bestechen, wird meine Entscheidung nicht ändern. Seien Sie ehrlich, oder gehen Sie. Goodbye!«
Veyron klang so streng und Ehrfurcht gebietend, wie ein Oberlehrer. Zumindest wagte Pureberry es nicht, noch einmal zu protestieren. Grob nahm er seine Frau an der Hand und riss sie mit sich, als er nach draußen stürmte. An der Haustür blieb er noch einmal stehen, schwang drohend die Faust.
»Sie werden mich noch kennenlernen! Niemand weist mich einfach so ungestraft ab! Ich bin schon mit ganz anderen Kalibern fertig geworden! Ich werde Sie wissen lassen, was das Dreifache von Nichts ist, Swift! Wir hören wieder voneinander, ich mache Sie fertig!« brüllte er, seinen Zorn nicht mehr länger beherrschend. Das ganze Haus schien zu beben, Tom stand kurz davor, sich die Ohren zuzuhalten. Ob er hinaufgehen und das Zauberschwert aus Veyrons Arbeitszimmer holen sollte? Dieser dicke Wahnsinnige würde sicher Augen machen und merklich zahmer werden, wenn er erst einmal eine Schwertklinge an der Kehle hatte. Doch das brauchte er nicht. Im nächsten Moment hörte er die Haustür ins Schloss fliegen, ein furchtbarer Knall, der lange nachhallte. Veyron blieb ungerührt vor dem Wohnzimmerfenster stehen, die Hände hinter dem Rücken ineinandergelegt.
»Das Dreifache von Nichts, bleibt Nichts, Mr. Pureberry«, sagte er zu dem nicht mehr anwesenden Klienten.
Tom wartete einen Moment, ehe er sich an seinen Paten wandte.
»Woher wissen Sie, das Pureberry ein Lügner ist? Und auch die ganzen anderen Dinge. Ich meine, das Einzige, was ich sehen konnte, war, dass er ein ziemlicher Tyrann ist und seine Frau Angst vor ihm hat. Der Chauffeur mag ihn wohl auch nicht.« sagte er.
Veyron drehte sich um, setzte sich wieder in seinen alten Ohrensessel. »Es gibt nicht viele Menschen, die Pureberry mögen, das dürfte feststehen. Deine Beobachtungen waren allesamt richtig. Schade ist nur, dass dir die ganzen anderen ebenso offensichtlichen Details vollkommen entgangen sind. Die Schwielen und die dicke Hornhaut an den Fingern zum Beispiel. Sie zeigten mir, dass er früher harte Arbeit verrichtete, dazu die kleinen Brandnarben auf Fingern und Handrücken, die auf Tätigkeiten in großer Hitze schließen lassen. Vermutlich also Schweißarbeit, selten mit ausreichender Schutzkleidung. Da diese Wunden noch nicht gänzlich verheilt sind, und sich die Hornhäute kaum zurückbildeten, verrät uns das, dass er erst vor kurzem zu seinem Reichtum gelangt sein muss, maximal vor einem Jahr, wahrscheinlich eher weniger. Das er reich ist, verraten uns der Stoff seines Anzugs und natürlich der Anzug des Chauffeurs. Nicht zu vergessen der Wagen draußen auf der Wisteria Road. Hast du ihn gesehen? Nein? Es ist ein Bentley, neuestes Modell. Ich frage mich, wie ein Schweißer zu so viel plötzlichem Reichtum kommt …«
»Vielleicht ein Lottogewinn?«, warf Tom ein, doch hätte er nie etwas gesagt, fuhr sein Patenonkel mit den Ausführungen fort.
»Nun zum Fakt, dass er sein Haus nicht oft verlässt: Seine Schuhe, Tom. Achte immer auf die Schuhe der Menschen, die geben über viele Dinge Aufschluss. Da waren keine Schmutzspuren rund um die Sohlen, darum weiß ich, dass er nicht besonders häufig draußen unterwegs ist. Da er auf das Kaschieren seiner Brandnarben und der Hornhäute wenig Wert legt, können wir also ausschließen, dass er ein besonders reinlicher, oder zumindest auf die Details achtender Mensch ist. Er putzt seine Schuhe nicht gründlich und sie erscheinen gerade deshalb fast wie neu, weil er selten draußen unterwegs ist.«
Tom lachte, als er diese Schlussfolgerungen hörte. Ein innerer Zwang brachte ihn dazu, Veyron zu widersprechen. Sein Pate konnte doch nicht immer mit allem recht haben. Und Tom glaubte, den Fehler in der Theorie Veyrons entdeckt zu haben.
»Es könnten aber auch tatsächlich neue Schuhe gewesen sein«, meinte er. Veyron schüttelte mit einem bemitleidenden Lächeln den Kopf. Tom kam sich jedes Mal aufs Neue wie ein Idiot vor, wenn sein Pate diese furchtbare Geste machte.
The free sample has ended.