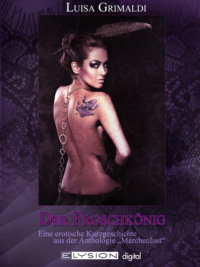Read the book: «Der Froschkönig»
ORIGINALAUSGABE
© 2012 BY ELYSION BOOKS GMBH, GELSENKIRCHEN
ALL RIGHTS RESERVED
UMSCHLAGGESTALTUNG: Ulrike Kleinert
FOTO: © Fotolia/ Maksim Toome
FRONTISPIZ: Hanspeter Ludwig
eISBN 978-3-945163-46-7
Inhalt
Der Froschkönig
Lesen Sie weiter
Der Froschkönig
Solitaire hopste die von der Veranda in den Garten führenden Stufen hinab und kicherte über einen Streich, den sie ihrer ältesten Schwester gespielt hatte. Diese und die mittlere Schwester waren verliebt, würden demnächst heiraten und waren vor lauter Aufregung ganz empfänglich für Solitaires Streiche. Böswillig waren diese natürlich nicht, bloß Neckereien – schließlich sollte es bald niemanden mehr zum Necken geben, und dann würde es im kleinen Schlösschen sehr langweilig werden. Solitaires Vater war nämlich alles andere als humorvoll, ganz ähnlich verhielt es sich mit der Köchin, dem Stallburschen und den wenigen anderen Bediensteten, denen er als König eines nur winzigen Reiches Anstellung gab.
Da ihre Schwestern wieder einmal damit beschäftigt waren, vor dem Spiegel zu sitzen, das Haar zu frisieren und Kleider anzuprobieren, musste sich Solitaire die Zeit bis zum Abendessen allein vertreiben, also hatte sie ihr liebstes Spielzeug mitgenommen: Eine goldene Kugel, die sie nun hochwarf und auffing, sich dabei drehte und über Blumenrabatten sprang, was der Gärtner nicht sehen durfte. Am Ende des Gartens befand sich ein Brunnen, auf dessen Rand sie gern saß, um ihrem Spiegelbild im Wasser Grimassen zu schneiden und es dann auszulachen. Heute hopste sie um den Brunnen herum, summte eine Melodie und kicherte mitunter noch, weil sie an die verträumten Mienen ihrer Schwestern denken musste. Wie albern die beiden manchmal aussahen, wenn sie von ihren Liebsten sprachen. Sogar geküsst hatten sie schon, und erzählten sie davon, wirkten sie glatt noch alberner.
Solitaire setzte sich auf den Brunnenrand, beugte sich ein Stück zur Seite, sodass sie ihr Spiegelbild sehen konnte und machte einen Knutschmund. Sie versuchte, ihrem Blick den dazu passenden treuseligen Ausdruck zu verleihen, doch musste erneut lachen und war schon wieder ganz sie selbst. Ihre brünetten Locken kringelten sich bis auf Kinnlänge und in ihren honigfarbenen Augen stand der alte Schalk. Sie rümpfte ihre kleine Nase und verzog die Lippen zu einem schiefen Grinsen. Niemals würde sie sich verlieben und so dümmlich aussehen. Und sie würde nie vorm Spiegel sitzen, um sich stundenlang für einen Mann aufzuhübschen und Gewänder tragen, in denen sie wie ein Blümchen aussah. Ihre Lieblingsfarbe war rot, und so waren ihre meisten Kleider rot. Der Oberrock des heutigen Kleides hatte graue Punkte und teilte sich in der Mitte über dem gleichermaßen dunkelgrauen Unterrock. Da sie keine Korsagen mochte – sie raubten ihr die Atemluft und hinderten sie in ihren Bewegungen – ließ sie die Oberteile ihrer Kleider stets etwas lockerer, wie eine Bluse anfertigen. Ein rotes, um den Kragen der grauen Bluse geschlungenes Band, dessen Enden bis zur Taille hingen, rundete ihre Erscheinung ab.
Solitaire warf ihre goldene Kugel hoch und fing sie, stand vom Brunnenrand auf, warf das Spielzeug nochmals in die Luft und wollte es fangen, doch es schlug einen eigenwilligen Bogen und plumpste – platsch – in den Brunnen. Fassungslos reckte sich Solitaire über den Rand, versuchte die Kugel zu erhaschen, doch musste zuschauen, wie sie tiefer und tiefer sank und ihr goldenes Leuchten mit gewonnener Tiefe erlosch. Von Traurigkeit erfasst, setzte sie sich vor den Brunnen und wischte eine Träne fort, aber der Gedanke an das verlorene Lieblingsspielzeug ließ mehr Tränen aufquellen, und so weinte sie wenig später bitterlich.
»Königstochter, jüngste, du schreist ja, dass sich ein Stein erbarmen möchte«, rief ihr mit einem Mal jemand zu.
Wie sie sich umblickte, entdeckte sie einen Frosch auf dem Brunnenrand. »Ach, du bist es, alter Wasserplatscher«, schniefte sie. »Ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen gefallen ist.«
»Dann weine nicht länger, denn ich kann sie heraufholen.«
Solitaire sprang auf und klatschte in die Hände. »Oh, das würdest du tun?«
Der Frosch hüpfte ein kleines Stück zu ihr hin. »Das will ich gern tun. Versprich mir jedoch fünf Dinge.«
»Was willst du haben, Wasserpatscher? Perlen, Edelsteine …«
»Nichts davon mag ich«, unterbrach sie der Frosch. »Versprich mir, dass du mich mit in das Schlösschen deines Vaters nimmst, dass ich von deinem Teller essen und von deinem Becher trinken darf. Lass mich in deinem Bett schlafen und gib mir bevor du einschläfst einen Kuss.«
So ein einfältiger Kerl!, schoss es Solitaire durch den Kopf und sie wollte schon zustimmen, denn was sollte er ausrichten, fragte aber doch weiter: »Was geschieht, wenn ich diese Versprechen nicht einhalte?«
Die Antwort abwartend, kroch ein Frösteln über ihre Haut, denn ihr war, als würden sich die Augen des Frosches verdunkeln, sodass er gar nicht mehr drollig aussah.
»Unheil wird über dich kommen«, sagte er und auch seine Stimme schien eine andere zu sein. »Für jedes gebrochene Versprechen, wirst du bestraft und meine Schmerzen als deine akzeptieren.«
Ein gemeiner Frosch war er also! Ein Erpresserfrosch! Aber doch nur ein Frosch. Und sie würde ihn schon lehren, ihr zu drohen.
»Ich verspreche es«, erwiderte sie also und beobachtete, wie er ins Wasser hüpfte, hinabsank und über ein Weilchen wieder heraufgerudert kam. Ihre goldene Kugel hatte er im Maul und ließ sie, nachdem er auf den Brunnenrand gehopst war, ins Gras plumpsen.
Voller Freude hob Solitaire ihr Spielzeug auf und lief zum Schloss. Sie ignorierte die Rufe des Frosches, der sie zum Warten aufforderte, da er schließlich nicht so schnell war. Nur einmal blickte sie über die Schulter zurück, lachte über seine kläglichen Versuche, mit ihr Schritt zu halten, und hatte ihn bald vergessen.
Am Abend, als sie mit ihrem Vater und ihren Schwestern beim Essen saß, hörte sie, wie etwas – plitsch platsch – die Marmortreppe hinaufgepatscht kam. Wenig später rief eine Stimme vor der Tür: »Königstochter, jüngste, mach mir auf!«
Solitaire, der die Stimme durchaus bekannt vorkam, stand vom Tisch auf, lief sie zur Tür und riss sie auf. Tatsächlich saß da der garstige Frosch und glotzte sie an.
»Ein Versprechen hast du bereits gebrochen. Hüte dich, auch die weiteren nicht einzuhalten!«, quakte er.
Solitaire schnaubte, schlug die Tür zu und ging zurück zu ihrem Platz, um lustlos im Gemüse zu stochern. Als ihr Vater sich erkundigte, wer da gewesen sei und was sie so erzürnte, erzählte sie ihm, was sich am Nachmittag zugetragen hatte. Natürlich erhoffte sie sich sein Verständnis und wurde nur verärgerter, da er sie aufforderte, den Frosch hereinzulassen, um zu halten, was sie versprochen hatte.
Wenig später hockte das ekelerregende Grüntier neben ihrem Stuhl auf dem Boden und stellte weitere Forderungen: »Königstochter, jüngste, heb mich auf deinen Schoß, damit ich von deinem Teller essen kann!«
Solitaires Schwestern begannen zu kichern und hörten damit nicht einmal auf, als sie ihnen böse Blicke zuwarf. Ganz und gar furchtbar fand sie das alles! Sie wollte diesen Frosch weder auf ihrem Schoß, noch auf dem Tisch, noch an ihrem Teller sitzen haben, also warf sie ihm ein paar Stücken Kartoffeln hinab.
Er ignorierte ihre Gaben und quakte: »Zwei Versprechen hast du bereits gebrochen. Hüte dich, auch die weiteren nicht einzuhalten und lass mich nun von deinem Becher trinken!«
Das Kichern ihrer Schwestern wurde lauter, und ihr Vater räusperte sich mahnend, doch Solitaire war so aufgebracht, dass sie ihren Kelch nahm und den darin befindlichen Wein über dem Frosch ausgoss.
Ihr Vater war darüber sehr erbost und forderte sie auf, sofort von der Tafel und auf ihr Zimmer zu verschwinden. Solitaire schob den Stuhl zurück, sodass dessen Beine über den Boden schabten und wollte aus dem Raum eilen – verletzt von so viel Unverständnis, da ertönte die Stimme des Frosches: »Königstochter, jüngste, drei Versprechen hast du bereits gebrochen. Hüte dich, auch die weiteren nicht einzuhalten und nimm mich mit in dein Bett!«
Dem schallenden Gelächter ihrer Schwestern gebot der König Einhalt, doch er wies Solitaire auch an, den Frosch mitzunehmen. Also stapfte sie zurück, hob das kalte, glitschige Tier mit spitzen Fingern an und trug es in ihr Zimmer. Dort ließ sie es auf den Nachttisch platschen, setzte sich aufs Bett und starrte es düster an. Der Frosch starrte düster zurück.
»Auf keine Fall wirst du in meinem Bett schlafen«, stellte sie zur Bekräftigung klar.
Die Augen des Tieres glommen abermals dunkel. »Nun denn, Königstochter, jüngste, brichst du das vierte Versprechen. Hüte dich, auch das letzte nicht einzuhalten und gib mir einen Kuss!«
Solitaire war außer sich vor Wut. Einen Fluch ausstoßend, stand sie vom Bett auf, packte den Frosch und warf ihn gegen die Wand. Es tat einen Laut, als würde etwas verpuffen – und da war er.
Solitaire blinzelte einmal und blinzelte ein zweites Mal, doch alles blieb, wie es war. In ihrem Zimmer befand sich ein Mann. Einer, dessen Anblick sie noch mehr irritierte als seine Anwesenheit. Seine Züge besaßen nichts als Härte, die allerdings wie eine Maske schien. So wirkte er aus einer Perspektive wie ein Gauner, aus der anderen wie ein Edelmann. Sein Haar war so kurz, dass sie seine Farbe nicht benennen konnte. Seine eisgrauen Augen blickten so kalt wie es ihre Farbe war. Sein Kinn und die Wangen gaben Aufschluss über einen stolzen Charakter, doch sie waren von dunklen Stoppeln übersät. Seine Wangen waren kantig, seine Nase schmal, seine Lippen spröde und ein schmaler Strich. Er war schlank und groß, überragte sie um gut einen Kopf. In Schwarz war er gekleidet, Stiefel trug er, die über eng anliegenden Beinkleidern geschnürt waren. Ein lederner, schmal geschnittener Wams war durch Riemen geschlossen und besaß keine Ärmel. Die Haut seiner kräftigen Arme war von schwarzen Mustern gezeichnet, die bis hin zu seinem Hals liefen. Gleichermaßen lederne Riemen waren um seine Handgelenke geschlungen.
Als er zu ihr kam, dachte Solitaire daran, um Hilfe zu schreien, doch, noch immer verwirrt, brachte sie kein Wort heraus. Ohne Zweifel ängstigte er sie, doch da war auch etwas an ihm, das ihr seltsam vertraut erschien. So wich sie nur zurück, bis sie mit dem Rücken gegen die Tür stieß, streckte die Hände beschwichtigend aus und flüsterte: »Bitte! Es tut mir leid!«
»Das wird es erst noch«, knurrte er, legte eine Hand über ihren Mund, wirbelte sie herum und presste ihre Kehrseite an sich. Dann drängte er sie aus dem Zimmer, dirigierte sie über den leeren Korridor und aus dem Schloss. Kaum einen Laut verursachten seine Schritte und er gab Acht, dass es ihre ebenso wenig taten, als sie zum eisernen Tor eilten, vor dem in diesem Moment eine schwarze Kutsche hielt, deren Bock jedoch leer war. Solitaires Angst nahm für einen Moment überhand, allerdings scheiterten sämtliche Versuche, sich aus seiner Umarmung zu winden. An der Kutsche angelangt, öffnete er die Tür, stieß sie hinein und stieg hinter ihr ein.
Los ging eine Fahrt, die so rasant und wild war, dass Solitaire befürchtete, sie würde geradewegs in die Hölle führen. Ihr Entführer schien keineswegs beeindruckt und starrte in die mondhelle Nacht.
»Wohin fahren wir?«, fragte sie und klammerte sich mit einem kleinen Schrei an einem Griff fest, weil die Kutsche einen Satz über eine Unebenheit machte. »Und wann bringt Ihr mich zurück?«
The free sample has ended.