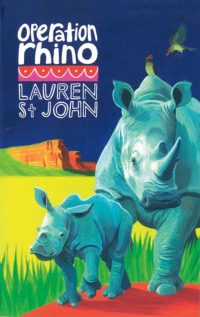Read the book: «Operation Rhino»

Mit Illustrationen von David Dean
Aus dem Englischen von
Martina M Oepping

Der tapferen Carrie (17.10.1999 – 15.9.2012) gewidmet, die sich ganz mit Martine identifizierte und voller Leidenschaft eine bessere Welt für Nashörner und andere Tiere schaffen wollte.

Inhalt
• Kapitel 1 •
• Kapitel 2 •
• Kapitel 3 •
• Kapitel 4 •
• Kapitel 5 •
• Kapitel 6 •
• Kapitel 7 •
• Kapitel 8 •
• Kapitel 9 •
• Kapitel 10 •
• Kapitel 11 •
• Kapitel 12 •
• Kapitel 13 •
• Kapitel 14 •
• Kapitel 15 •
• Kapitel 16 •
• Kapitel 17 •
• Kapitel 18 •
• Kapitel 19 •
• Kapitel 20 •
• Kapitel 21 •
• Kapitel 22 •
• Kapitel 23 •
• Kapitel 24 •
• 1 •

«Wer zuerst unten im Tal ist», sagte Ben und zügelte Shiloh, sein neues Pony. «Der Verlierer muss nach dem Frühstück spülen.»
Martine brachte ihre weiße Giraffe zum Stehen, indem sie leicht an ihrer silberglänzenden Mähne zupfte. Manchmal fragte sie sich, was wohl passieren würde, wenn Jemmy sich jemals in den Kopf setzen sollte, nicht auf ihre kleinen Signale zu achten, sondern einfach weiter und weiter in die Wildnis von Afrika zu galoppieren – so lange, bis niemand je wieder von ihr hören würde.
Schließlich trug Jemmy weder Zaumzeug noch Sattel, er war auch nicht eine einzige Stunde lang abgerichtet worden, wie ein Pferd auf bestimmte Kommandos zu reagieren. Obwohl das Tier noch jung war, maß es schon fast fünf Meter, und das hieß, dass Martine, die auf seinem vorderen Rücken hockte, halsbrecherische drei Meter tief stürzen würde, wenn irgendetwas schiefging. Trotzdem war es ihre liebste Beschäftigung, auf der weißen Giraffe zu reiten, und Jemmys Rücken war der Ort, an dem sie sich am sichersten fühlte. Von dem Moment an, in dem sie Jemmy vor ungefähr einem Jahr zum ersten Mal sah, als er aus der Dunkelheit herangestürzt war, um sie vor einer angriffswütigen Kobra zu retten, hatte er sie behandelt, als sei sie so zerbrechlich wie ein frisch geschlüpftes Küken. Was Martine anging, war die Verbindung zwischen ihnen und die Liebe, die sie füreinander empfanden, die beste Versicherung, die sich ein Reiter nur wünschen konnte.
«Na, wie wär’s?» Ben blickte mit einem unschuldigen Ausdruck zu ihr hoch. «Ich meine, Jemmys Beine sind mindestens dreimal so lang wie die meines Ponys, also stehen die Chancen gut für dich. Aber ich wage es trotzdem.»
Martine schüttelte den Kopf über den frechen Vorschlag ihres besten Freundes. «Du glaubst wohl, ich bin auf der Brennsuppe dahergeschwommen! Ich kenn mich zwar mit Pferden nicht so aus, aber immerhin weiß selbst ich, dass du mit Shiloh die Böschung hinunterfliegst und die Straße erreichst, bevor Jemmy und ich auch nur zwei Schritte gemacht haben. Also, wie wär’s damit: Das Rennen geht den ganzen Weg bis zu der gelben Steineibe am Wasserloch? Das wäre schon eher fair. Bergab bist du bestimmt schneller, aber so habe ich wenigstens auf der Ebene eine Chance, dich einzuholen.»
Ben lachte. «Okay, aber unter einer Bedingung: Wenn du verlierst, machst du die ganzen nächsten zwei Wochen den Abwasch.»
Er nahm die Zügel auf und drückte seinem Pony die Schenkel in die Flanken. «Achtung! Fertig? Bis gleich an der Wasserstelle.»
Und damit war er weg, galoppierte mit Shiloh die kurze Strecke bis zum Beginn des steilen Wegs und verschwand pfeilschnell über den Rand der Böschung.
«Ben, warte!», rief Martine. «Denk dran, den Weg durch die Bäume zu nehmen, wenn du am Haus vorbeikommst. Wenn meine Großmutter uns dabei erwischt, wie wir durch das Wildreservat preschen, bringt sie uns um.»
Aber ihre Worte verloren sich in der afrikanischen Brise. Ben wurde von seinem hübschen Pony bereits wie im Flug den steilen Pfad hinuntergetragen. Seine Eltern hatten es ihm in der vergangenen Woche zu Weihnachten geschenkt. Seine indische Mutter hatte eine Girlande aus Blumen und Seidenbändern gebastelt, die sie Shiloh um den Hals hängte. Und sein Vater, ein großer, gut aussehender Zulu, der Kapitän eines Transportschiffs, hatte seinen Sohn damit überrascht, dass er das Pony geradewegs in die Küche der Wildtierfarm Sawubona führte, wo Martine mit ihrer Großmutter lebte. Die Stute war ein Basotho-Pferd, eine robuste Gebirgsrasse, die ursprünglich aus dem Königreich Lesotho stammte. Ben war gerade dabei, Martine und ihrer Großmutter Gwyn Thomas beim Zubereiten eines üppigen Mittagessens zu helfen. Er hatte von einer Pfanne mit Bratkartoffeln aufgeblickt und das Pony gesehen, wie es sich zur Tür hereinbeugte. Und auch jetzt noch streichelte Ben Shilohs kastanienbraunes Fell immer wieder voller Staunen. Er konnte es immer noch nicht glauben, dass dass das Pferd wirklich ihm gehörte.
Martine wurde in der Weihnachtszeit immer doppelt beschenkt, weil ihr Geburtstag auf Silvester fiel. Sie hatte sich über all ihre Geschenke gefreut. Von ihrer Großmutter hatte sie hellbraune Lederstiefel zum Buschwandern bekommen, zwei Pferdebücher und eine knöchellange Reithose, die am Po ein zusätzliches Polster hatte, damit sie bequemer auf Jemmy reiten konnte. Und gestern, bei ihrem Geburtstagsbrunch, hatten ihr Ben und seine Eltern noch eine neue Jeans geschenkt, die sie dringend brauchte.
Aber für Martine ging wirklich nichts über den Anblick von Bens Gesicht, als Shiloh am Weihnachtsmorgen die Auffahrt hochgetänzelt kam. Obwohl er gerade erst vor wenigen Monaten das Reiten gelernt hatte, war er der geborene Reiter. Pferde reagierten auf ihn wie Wildtiere auf Martine – als ob sie beide dieselbe Sprache sprächen.
Shiloh sollte auf der Koppel hinter ihrem Haus leben, und das bedeutete, dass Ben, der bei Tendai, dem Wildhüter von Sawubona, das Fährtenlesen erlernte, noch mehr Zeit im Reservat verbringen würde, als er das ohnehin schon tat. Martine konnte es kaum erwarten, bis es so weit war. Er könnte ihr dann immer Gesellschaft leisten, wenn sie ihre weiße Giraffe Jemmy ritt. Anstatt sich wie bisher mühsam zu zweit auf Jemmy zu halten – Ben sagte immer im Spaß, er bekomme dabei Höhenangst –, wäre es ihnen möglich, Sawubona zu erkunden, wann immer sie Lust dazu hatten.
«Das hättet ihr wohl gerne», hatte ihre Großmutter erwidert, als Martine den Fehler machte, ihre Gedanken laut auszusprechen. «Nur weil ihr in ein paar Wochen auf der Highschool anfangt, heißt das nicht, dass ihr über Nacht erwachsen geworden seid und überall frei im Reservat umherlaufen dürft. Keine Nachtritte, außer bei ganz besonderen Gelegenheiten! Und keine Ritte, die ihr nicht mit Tendai oder mir vorher abgesprochen habt! Nein, seht mich nicht so an. Du und Ben, ihr wisst es besser als alle anderen, dass das Wildreservat ein äußerst gefährliches Gelände sein kann.»
Es ist auch das schönste Gelände der Welt, dachte Martine und blickte über die rosafarbenen Umrisse von Sawubona. Bei Sonnenaufgang lag ein geheimnisvoller Nebelschleier über dem fernen Wasserloch und über den Wäldern und Tälern des Reservats. Wenn die heiße zartrote Sonne am Horizont aufging, zogen die Büffel, Zebras und Kudus langsam in die Ebene. Ihnen folgten die Elefanten mit noch tropfendem Rüssel von einem frühmorgendlichen Bad.
Zurückgezogen in den noch dunklen Höhlen des Geheimen Tals dösten die Leoparden in den Tag hinein, bis sie in der Nacht wieder auf Jagd gingen. Draußen in der Ebene ließ sich ein Rudel Löwen schwerfällig auf einer Anhöhe nieder, und mit vollen Bäuchen warteten die Tiere darauf, dass die Sonne ihnen die gelbbraunen Flanken wärmte. Martine war auf Jemmy, weil sie so hoch oben saß, vollkommen sicher – vorausgesetzt, sie fiel nicht hinunter –, aber für Ben, der auf seinem Pony ritt, sah die Sache ganz anders aus. Sie hielten sich bewusst von jener Region des Reservats fern, die Gwyn Thomas die «Fleischfresserecke» nannte, damit sie nicht versehentlich zum Frühstück verspeist wurden.
Das Beste an der morgendlichen Wildtierparade waren die Vogelgesänge. Mehr als dreißig Vogelarten begrüßten den neuen Tag mit einem Morgenständchen. Tendai hatte Martine beigebracht, wie sie einige von ihnen erkennen konnte. Am leichtesten war das beim Weißbrauenrötel, von dem die ersten erlesenen Melodien des Morgens gegen Viertel vor fünf ertönten, aber ihre Lieblinge waren die gurrenden Tauben und die Drossel mit ihrem hohen, reinen Lied. Der Fliegenschnäpper, die Grasmücken, die Bülbüls und die Brillenvögel waren die Hintergrundsänger eines Chors, in dem die Tenöre – die Turakos und Trogons, die melodischen Würger und die pfeifenden Kuckucke – die Stars waren.
Während Martine ihnen zuhörte, stellte sie sich vor, sie alle lieferten die Begleitmusik für ihr Rennen gegen Ben, besonders weil Jemmy begann, mit den Hufen zu scharren, voller Begierde, dem Pony hinterherzulaufen. Das ungleiche Paar hatte sich schon bei der ersten Begegnung angefreundet.
«Jemmy, ich zähle auf dich, dass du alles gibst», rief Martine ihrer Giraffe zu. «Ich hasse nichts so sehr wie Spülen. Auf gar keinen Fall will ich da feststecken und die nächsten beiden Wochen den Abwasch machen.»
Die Giraffe reagierte mit derartigem Eifer, dass Martine ihr die Arme um den Hals schlingen musste, um nicht hinunterzufallen.
Als Jemmy den felsigen Abhang erreichte, wurde er langsamer und bewegte sich ungelenk. Seine langen, schlaksigen Beine tasteten zaghaft nach dem nächsten festen Stand. Martine lehnte sich zurück, um ihr Gewicht von seinen Schultern zu nehmen, und klammerte sich mit den Beinen fest. Genau wie sie vorhergesagt hatte, hatte Ben längst die tiefer gelegene Ebene erreicht. Shiloh wurde rasch schneller, und eine blasse Staubwolke stieg hinter den fliegenden Hufen der Stute auf.
Martine konnte es kaum erwarten, ihr hinterherzujagen, aber sie wagte es nicht, Jemmy anzutreiben. Ein einziger Fehltritt hätte katastrophale Folgen haben können. Als sie die Ebene erreicht hatten, waren Ben und das Pony nur noch ein unscharfer Fleck in der Ferne.
Jemmy war genauso scharf darauf, sie einzuholen, wie Martine. Sie brauchte kaum seine Flanken zu berühren, da schoss er los und beschleunigte von null auf fünfzig Stundenkilometer, so schnell, dass es Martine den Atem verschlug. Sie kauerte sich nach vorn wie ein Jockey und versuchte, nicht an die harte Erde zu denken, die sehr tief unter ihr nur so vorbeiflog.
Giraffen haben lediglich zwei Gangarten – Schritt und Galopp –, und Jemmys Galopp kam Martine jedenfalls so schnell vor, als säße sie auf einem Rennpferd. Seine Riesenschritte verschlangen die Entfernung zwischen ihr und Ben. Es wurde immer schneller. Der Wind pfiff Martine um die Ohren. Es war, als ritte sie Pegasus, das geflügelte Pferd aus der griechischen Sage. Sie rauschte an einer Büffelherde vorbei. Zebras stoben auseinander. Springböcke veranstalteten gewaltige Sprünge wie in Zeitlupe.
Ein so intensives Freiheitsgefühl durchströmte Martine, dass sie sich ganz schwindelig fühlte. Es war noch gar nicht so lange her, da hatte sie sich nicht vorstellen können, jemals wieder glücklich zu sein. Am Silvesterabend vor genau einem Jahr und einem Tag – an einem Tag, der grausamerweise zugleich ihr Geburtstag war – waren ihre Mutter und ihr Vater beim Brand ihres Hauses ums Leben gekommen. In den darauffolgenden Monaten war der Schmerz in Martines Herz so qualvoll gewesen, dass sie sich oft wünschte, sie wäre ebenfalls gestorben. Es hatte auch nicht wirklich geholfen, an das Östliche Kap von Südafrika zu einer Großmutter ziehen zu müssen, von der sie noch nie gehört hatte.
Anfangs war Martine so einsam gewesen, dass sie sich jeden Abend in den Schlaf geweint hatte. Alles, was ihr Halt bot, waren ihre Erinnerungen gewesen.
Jemmy zu finden und auf ihm reiten zu lernen hatte ihr das Leben gerettet. Eigentlich hatten sie sich gegenseitig gerettet, denn später hatte Martine die weiße Giraffe den Händen von Wilderern entrissen.
Aber nicht bloß Jemmy und die Freundschaft mit Ben hatten Martine geholfen. Auch die Zeit und die Sonne hatten dazu beigetragen, dass die Wunden heilten, ebenso eine Reihe von kleinen Wundern, wie zum Beispiel die Musik von Take Flight, ihrer Lieblingsband. Leadsänger Jayden Lucas hatte seinen Vater verloren, als er ein kleiner Junge war, und wann immer Martine ihn Song for Dad singen hörte, fühlte sie sich von ihm verstanden.
Ebenso wichtig war ihr Verhältnis zu der Mutter ihrer Mutter. Zuerst war sie kalt und streng gewesen – hauptsächlich, weil sie selbst so trauerte –, doch letztendlich hatte sich Gwyn Thomas zu der liebevollsten Großmutter entwickelt, die man sich nur wünschen konnte.
Noch solch ein Lebensretter war Grace, Tendais Tante, eine traditionelle Zulu-Heilerin, die man als Sangoma bezeichnete. Kurz nach Martines Ankunft in Afrika hatte Grace sie darüber aufgeklärt, dass sie, Martine, eine besondere Gabe besitze. Diese Gabe hatte bereits in Martines Schicksal eingegriffen, und sie würde es in naher Zukunft weiter tun. Es war eine wunderbare Gabe, aber sie verlangte auch einen hohen Preis. Im Laufe des vergangenen Jahres hatte sie Martine und Ben, der sie bei jedem Abenteuer begleitete, Freude und Schrecken gleichermaßen gebracht.
Als Martine jetzt über die prächtige Ebene Sawubonas raste, war sie so glücklich wie noch nie zuvor. Es würde immer eine leere Stelle in ihrem Herzen geben, dort, wo ihre Eltern gewesen waren, aber der Schmerz wurde mit jedem Tag weniger. Und mit jedem Tag wurde Martine stärker.
«Los, Jemmy», drängte sie und griff fester in seine Mähne, «du kannst doch noch schneller.»
Die Giraffe donnerte über die Ebene, und ihr weiß glänzendes Fell mit den Zimtflecken leuchtete in der Landschaft auf. Allmählich holten sie Ben und Shiloh ein. Bald waren sie so nah, dass sie die knatternden Hufschläge des Ponys hören konnten. Das Wasserloch kam in Sicht. Vor ihnen gabelte sich der Weg.
Zu spät fiel es Martine ein, Ben daran zu erinnern, dass er links durch die Bäume reiten musste. Ein hoher Zaun direkt hinter dem Wasserloch war alles, was sie vom tadellos gepflegten Vorgarten ihrer Großmutter trennte.
«Ben, nein …!»
Es war zu spät. Er war rechts abgebogen.
Martine musste sich im Bruchteil einer Sekunde entscheiden: das Rennen abzubrechen und wochenlang den Abwasch zu machen oder sich den Zorn ihrer Großmutter einzuhandeln. Sie entschloss sich, es darauf ankommen zu lassen.
Mit einem leichten Druck ihres linken Beins sorgte sie dafür, dass die Giraffe dem Basotho-Pony hinterherstürzte. Mit ein paar wenigen Sprüngen hatte Jemmy Shiloh überholt.
Martine grinste Ben über die Schulter an. Als sie wieder nach vorn sah, war die gelbe Steineibe so nah, dass sie schon die Furchen in ihrer Rinde sehen konnte. Der Sieg war ihr nicht mehr zu nehmen.
Sie blickte in die Richtung des Hauses und hätte beinahe einen Herzanfall erlitten. War das Tendai da im Schatten des Mangobaums? Was, wenn er es ihrer Großmutter sagte? Die nächsten zehn Jahre würde sie Jemmy nicht mehr reiten dürfen. Aber als sie noch einmal hinsah, war niemand da.
Shiloh hingegen war keineswegs in der Stimmung, den Kampf aufzugeben. Obwohl die Stute vor Schweiß glänzte, genoss sie jede Sekunde. Die Ohren flach am Kopf, flitzte sie weiter, bis ihre bebenden roten Nüstern gleichauf mit Jemmys silbernen waren. Das Pony und die Giraffe passten sich Schritt für Schritt einander an. Der Stamm der Steineibe rauschte vorbei.
«Fotofinish», sagte Ben grinsend, als sein Pony schnaubend zum Stehen kam. Er bückte sich nach unten, um den Sattelgurt zu lockern. «Zu knapp, um es zu entscheiden. Obwohl ich ziemlich sicher bin, dass ich mit Shiloh um Haaresbreite gewonnen habe.»
«Das hättest du wohl gerne», gab Martine zurück. «Jemmy war mindestens eine Nasenlänge voraus.»
Sie lachten und neckten sich gegenseitig, während sie am Wasserloch vorbei in Richtung Gartentor ritten. Normalerweise machte Ben nicht viele Worte, doch jetzt schäumte er geradezu über.
«Hast du gesehen, wie Shiloh abgezischt ist? War sie nicht ganz toll? Ich meine, ich habe sie jetzt gerade mal ein paar Tage, aber ich bin sicher, es gibt kein besseres Pony in ganz Südafrika. Sie ist so bemüht und zugänglich und, natürlich, schnell wie der Blitz …»
Martine lächelte über Bens Begeisterung. Genauso waren ihre Gefühle Jemmy gegenüber, daher konnte sie ihn vollkommen verstehen. Mit jedem Tag liebte sie die weiße Giraffe mehr.
Ben unterbrach sich mitten im Satz. «Martine, sieh mal! Frische Nashornspuren, höchstens ein oder zwei Stunden alt. Wir müssen sie knapp verpasst haben.»
Die beiden Weißen Nashörner waren Neuankömmlinge auf Sawubona, nachdem sie aus einem Reservat an der Grenze zu Mosambik geborgen worden waren, wo rettungslos gewildert wurde. Martine war an dem Tag bei Ben zu Besuch gewesen und hatte sie erst einmal gesehen – aus der Ferne und halb von Bäumen verborgen. Da war etwas an ihrer prähistorischen Gestalt, das es einem schwer machte zu glauben, dass sie echt waren.
Martine war sich nicht so sicher, was sie von Nashörnern halten sollte. Sie war mit Leib und Seele dafür, alle Wildtiere zu retten und zu beschützen, aber Nashörner waren nicht gerade knuddelig. Schwarze Nashörner waren für ihre Misslaunigkeit bekannt, und Weiße Nashörner waren nicht nur kurzsichtig, sondern auch noch tollpatschig. Beide Arten sahen aus, als trügen sie Rüstungen, und Martine hatte insgeheim das Empfinden, dass sich die Persönlichkeit dieser Tiere sehr gut darunter verbergen konnte. Giraffen hingegen waren einfach nur wunderbar.
Als sie das Tor erreichten, ließ sich Jemmy nieder, damit Martine abspringen konnte. Wenn nicht, hätte sie eine Leiter gebraucht. Sie öffnete das Tor und nahm den Sack Karotten, Äpfel und Zwiebeln, den sie vorher dort abgelegt hatte. Während Shiloh zwei Äpfel und ein paar Polo-Pfefferminzbonbons aus Bens Hosentasche futterte, zerkaute Jemmy nacheinander fünf Karotten und vier Zwiebeln. Der Saft lief ihm über das Kinn, und aus lauter Begeisterung hatte er die Augen geschlossen.
Martine atmete zufrieden auf. «Und wieder ein Tag im Paradies!»
Sie bemerkten Tendai nicht, bis er direkt vor ihnen stand. Seine mächtigen Arme hatte er vor der Brust verschränkt, und sein dunkles Gesicht glich einer Gewitterwolke, die Narbe in seinem Gesicht einem zuckenden Blitz.
Noch bevor er anfing zu sprechen, wusste Martine, was er sagen wollte. Sie unterdrückte ein Stöhnen. Von wegen Abwasch! Sie und Ben würden Sawubonas schrecklichste häusliche Pflichten aufgebrummt bekommen! Die nächsten zehn Jahre. Mindestens.
Das war das Problem, wenn man im Paradies lebte: Ärger war nie weit davon entfernt.
• 2 •

«Tendai, wir haben doch nur Spaß gehabt. Ich verspreche, wir tun es nie wieder. Nur, bitte, sag meiner Großmutter nichts davon. Bitte bitte bitte!», bettelte Martine zum soundsovielten Mal.
«Wovon nichts?», fragte ihre Großmutter, die gerade in einer geblümten Schürze mit Warzenschweinen darauf aus der Küche trat. Der Duft von Armen Rittern und karamellisierten Bananen, vermischt mit gebratenen Champignons und Tomaten, umwehte sie.
«Gibt es etwas Interessantes aus dem Wildreservat heute Morgen? Wie kommen Jemmy und Shiloh miteinander aus? Glaubt ihr, sie werden Freunde? Kommt rein und erzählt mir alles beim Frühstück. Ich will nicht, dass das Essen kalt wird. Bis später, Tendai. Vergiss nicht, beim Tierarzt vorbeizufahren und eine Salbe für die Impala mit den wunden Augen mitzubringen.»
Mit einem Blick, der bedeuten sollte ‹Darüber sprechen wir noch›, sprang Tendai in seinen Land Rover. Er ließ den Motor übermäßig aufheulen und schoss die Auffahrt hinab.
Martine und Ben seufzten erleichtert auf. Sie zogen nur schnell ihre Stiefel aus und wuschen sich die Hände im Küchenspülbecken, dann spurteten sie ins Esszimmer. Die bodentiefen Fenster zum Garten standen offen. Das Sonnenlicht ergoss sich über die weiße Tischdecke wie flüssiger Honig.
Warrior und Shelby, die beiden Katzen, umrundeten den Tisch in der Hoffnung auf einen Leckerbissen. Hinter ihrem strengen Äußeren hatte Gwyn Thomas insgeheim ein weiches Herz. Es dauerte nicht lang, und die Katzen hatten sie so weit, dass sie ihnen eine Untertasse mit dicker Sahne hinstellte. Martine lachte über ihren glückseligen Ausdruck.
Anstatt sich weiter Gedanken zu machen, was Tendai ihrer Großmutter verraten würde und was nicht, konzentrierte sie sich lieber darauf, was wohl köstlicher war: der erste Gang, der aus frischen Eiern mit goldgelbem Eigelb, gebraten mit Champignons und Tomaten, bestand, oder die Nachspeise aus Armen Rittern mit karamellisierten Bananen und einem Klecks Sahne. Paw Paw (Papaya)-Saft rundete das Mahl ab. Nachdem sie erst am Tag davor, nach dem Festschmaus zu ihrem Geburtstag, geschworen hatte, nie wieder etwas zu essen, war Martine erstaunt, wie mühelos das Neujahrsfrühstück in ihren Magen passte.
Entschlossen, ihre Großmutter bei Laune zu halten, sorgte sie für einen heiteren Gesprächsfluss. Zwischen zwei Bissen beschrieb sie den Sonnenaufgang über dem Steilhang und die Nashornspuren, die Ben neben dem Wasserloch entdeckt hatte.
«Schön zu hören, dass die Nashörner am Leben sind und dass es ihnen gut geht», sagte Gwyn Thomas. «Jeder Besucher, der telefonisch ein Ticket für die Safari ‹Stars and Stripes› heute Abend bestellt hat, schien versessen darauf, die Großen Fünf zu sehen. Unsere neuen Nashörner stehen offenbar ganz oben auf der Liste. Ich habe mein Bestes gegeben, um zu erklären, dass es Hunderte von afrikanischen Tieren gibt, die genauso besonders und exotisch sind wie Elefanten, Löwen, Leoparden, Büffel und Nashörner – zum Beispiel eine weiße Giraffe. Aber vergeblich.»
«Vielleicht solltest du ihnen den tatsächlichen Grund nennen, warum ausgerechnet diese Tiere die Großen Fünf genannt werden», schlug Martine vor.
«Weil sie bei Jägern als die gerissensten und gefährlichsten Tiere gelten, die sie jagen können? Ja, ich war kurz davor, das zu sagen, aber dann habe ich mich daran erinnert, dass vermutlich alle, die ein Wildreservat besuchen, ein Interesse an wild lebenden Tieren haben. Es ist unsere Aufgabe, sie zu begeistern und zu lehren, alle Kreaturen zu lieben und wertzuschätzen, ob groß oder klein, so wie wir es tun.»
Ben lächelte. «Wenn Sie wollen, kann ich Ihren Besuchern ja alles über die Kleinen Fünf erzählen: die Ameisenlöwen, die Elefantenspitzmäuse, die Büffelweber, die Leopardenschildkröte und die Nashornkäfer.»
«Oh, ich liebe Elefantenspitzmäuse», sagte Martine. «Sie haben diese langen gekrümmten Nasen, die wie ein Elefantenrüssel aussehen, und sind mit das Niedlichste, was ich je gesehen habe.»
Ihre Großmutter füllte ihre Gläser mit Papayasaft auf. «Also, heute Abend habt ihr reichlich Gelegenheit, von den afrikanischen Wildtieren zu schwärmen. Wir haben achtzehn Tickets für die Safari und das Barbecue verkauft. Ich verlasse mich darauf, dass ihr beide helft, wo ihr könnt. Es soll ein lustiger Abend werden. Es kommen ein paar faszinierende Gäste. Ein oder zwei von ihnen sind weltberühmt.»
«Weltberühmt!» Martine sprang vor Aufregung beinahe von ihrem Stuhl. «Wer ist es? Wer kommt?»
Ihre Großmutter tat so, als schließe sie die Lippen mit einem Reißverschluss. «Ich sage kein Wort. Das würde die Überraschung verderben.»
«Doch, bitte! Es dauert ja noch Stunden, und ich kann die Spannung nicht aushalten.»
«Vorfreude ist die schönste Freude.»
«Kannst du uns wenigstens einen Tipp geben?»
Das Gespräch wurde unterbrochen, als ein Fahrzeug die Auffahrt heraufkam. Eine Tür wurde zugeschlagen, und sie hörten die Stimme des Wildaufsehers, tief und drängend.
Gwyn Thomas runzelte die Stirn. «Das ist merkwürdig. Ich dachte, Tendai wollte so schnell wie möglich nach Storm Crossing fahren. Er muss etwas vergessen haben.»
In Martines Mund wurde der Bissen zu Stein. Natürlich, das war es: Tendai hatte seine Meinung geändert und sich entschlossen, ihrer Großmutter lieber früher als später alles über ihr Rennen zu verraten! Durch die Glastüren konnte sie sehen, wie Jemmy am Wasserloch trank und dabei die Beine spreizte und seine silberne Nase in Falten legte. Wenn sie ihn nicht mehr reiten dürfte, wäre sie am Boden zerstört. Sie blickte Ben an. Er sah genauso beunruhigt aus wie sie.
Tendai kam ins Zimmer gehastet, seinen Hut behielt er in der Hand. «Mrs Thomas, es tut mir leid zu stören, aber die Nachrichten fangen gerade an, und Sie sollten sich das ansehen.»
Martine war so mit der Strafe beschäftigt, die auf Ben und sie zukommen würde, dass sie einen Moment lang glaubte, sie wären tatsächlich in den Morgennachrichten gelandet. Als der Bildschirm aufleuchtete, rechnete sie fast mit einem Filmbericht, der zeigte, wie die weiße Giraffe und das Basotho-Pony durch das Reservat rasten. Stattdessen setzte die Nachrichtensprecherin an: «Drei Schwarze Nashörner sind heute in den frühen Morgenstunden im Leopard Rock-Wildreservat am Östlichen Kap von Wilderern abgeschlachtet worden.»
Gwyn Thomas war fassungslos. «Unsere Nachbarn!»
«Es war ein heftiger Angriff, bei dem ein Wärter schwer verletzt wurde. Die Zahl der getöteten Nashörner in Südafrika stieg damit auf 1215. Tierschutzgruppen zeigten sich besorgt angesichts der jüngsten Gräueltat gegen diese gefährdete Tierart. Dr. Marius Goss, der Leiter der Hilfsorganisation FAW, Fight for African Wildlife, bezeichnet den Höhepunkt der Wilderei an Nashörnern als eine Epidemie.»
Die Kamera schwenkte zu Dr. Goss, der in seiner abgetragenen Khaki-Kleidung wie ein Fremdkörper in dem Studio wirkte, das ganz aus Glas und Chrom bestand. In seinem sonnengebräunten Gesicht sah man den Zorn. Er hielt ein Fläschchen in die Kamera. «Diese Flasche enthält pulverisiertes Rhinozeroshorn, das aus einer Substanz namens Keratin besteht. Es unterscheidet sich kein bisschen von einem menschlichen Fingernagel. Und doch ist es mehr wert als Gold. Verbrecherbanden verkaufen es für 65.000 Dollar pro Kilogramm, um die Nachfrage aus Asien zu bedienen, wo viele Leute es für ein magisches Heilmittel gegen alles Mögliche halten – von Krebs und Fieber bis zu Bluterkrankungen. Das Stichwort hier ist magisch. Es ist eine Illusion. Dieses Zeug» – er schüttelte die Flasche – «ist nicht mehr wert als Ihre Zehennägel-Abschnitte. Es ist nur für eine einzige Kreatur auf der Erde von Wert: für das Nashorn, dem es gehört.»
Er lehnte sich vor und blickte direkt in die Kamera. Martine kam es so vor, als würde er sie persönlich ansprechen. «Lassen Sie es mich klar ausdrücken: Wenn wir nicht zusammenarbeiten, um diesen schrecklichen Handel zum Erliegen zu bringen, könnten diese sanften, klugen und völlig einzigartigen Tiere, die 50 Millionen Jahre der Evolution überdauert haben, innerhalb der nächsten fünf Jahre aussterben.»
Tendai schaltete den Fernseher aus, und eine trostlose Stille folgte. Draußen hatte ein Wolkenband den Tag getrübt.
Gwyn Thomas erhob sich langsam. «Das Leopard Rock-Reservat ist höchstens zwei Kilometer von hier entfernt. Die Wilderer könnten noch in der Gegend sein. Was sollte sie daran hindern, als nächstes Ziel Sawubona anzuvisieren? Egal, was es kostet, Tendai, wir müssen so bald wie möglich Nashorn-Patrouillen aufstellen.»
«Ich kümmere mich sofort darum, Mrs Thomas. Ich kenne einen guten Mann. Wenn er verfügbar ist, könnte er nächste Woche anfangen.»
«Dann könnte es schon zu spät sein. Ich will die Nashorn-Patrouillen rund um die Uhr, von heute Abend an. Fragen Sie Samson, ob er die erste Schicht übernehmen kann. Er wird langsam alt, aber er hat Erfahrung, und er hat eine Waffe. Und, Tendai …?»
«Ja, Mrs Thomas?»
«Die Nashörner sind nicht die Einzigen, die in Gefahr sind. Denken Sie daran, dass wir es mit Kriminellen zu tun haben, die vor nichts zurückschrecken, um an das zu kommen, was sie wollen. Selbst wenn sie dabei Menschen verletzen, die sich ihnen in den Weg stellen. Wir müssen alle besonders wachsam sein. Martine und Ben, das gilt auch für euch.»
Martine hörte sie kaum. Der Magen verknotete sich ihr. Sie wünschte fast, Tendai wäre zurückgekommen, um ihrer Großmutter von dem Rennen mit Ben zu erzählen. Jede Strafe, die ihre Großmutter ihr aufgebrummt hätte, wäre besser gewesen als das hier – die Nachricht, dass die Tiere, die sie so sehr liebte, wieder einmal in Gefahr waren.
Sie dachte an die uralten Höhlenmalereien der San-Menschen in Sawubonas Geheimem Tal, ein Ort, den nur sie und Ben und Grace, die Sangoma, kannten. Es war Grace gewesen, die Martine als Erste gezeigt hatte, dass ihre Zukunft an die Höhlenwände geschrieben stand. Und kürzlich hatten die Wände noch etwas anderes enthüllt: dass ihr Leben untrennbar mit Bens verbunden war. Sie teilten sich ein Schicksal und eine Mission: die Wildtiere zu retten und zu heilen.
Aber vor einer Woche hatte ein Steinschlag die Höhle für immer versiegelt. Die Wände würden ihr Geheimnis nie mehr preisgeben. Wenn die Jäger jetzt Sawubona ins Visier nahmen, würden Martine und Ben ihnen blind ausgeliefert sein.