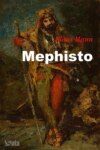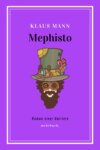Read the book: «Klaus Mann - Das literarische Werk», page 58
Der Schauspieler Höfgen durfte Anteil nehmen am Privatleben der Götter. Wenn er abends, nach der Vorstellung, bei Lotte in ihrem schönen Heim am Tiergarten saß und Schach oder Karten mit ihr spielte, geschah es zuweilen, daß der Ministerpräsident unangemeldet, laut und polternd das Zimmer betrat. Wirkte er da nicht wie der Gutmütigste? War ihm anzusehen, was für greuliche Geschäfte hinter ihm lagen und welche er für den nächsten Tag plante? Er scherzte mit Lotte, er trank sein Glas Rotwein, streckte die enormen Beine von sich, und mit Höfgen sprach er über ernste Dinge, am liebsten über den Mephistopheles.
»Sie haben mich diesen Kerl erst so richtig verstehen lassen, mein Lieber«, sagte der General. »Das ist ja ein toller Bursche! Und haben wir nicht alle was von ihm? Ich meine: steckt nicht in jedem rechten Deutschen ein Stück Mephistopheles, ein Stück Schalk und Bösewicht? Wenn wir nichts hätten als die faustische Seele – wo kämen wir denn da hin? Das könnte unseren vielen Feinden so passen! Nein, nein – der Mephisto, das ist auch ein deutscher Nationalheld. Man darf es nur den Leuten nicht sagen«, schloß der Minister des Flugwesens und grunzte behaglich.
Die trauten Abendstunden im Hause der Lindenthal benutzte Hendrik dazu, um bei seinem Gönner, dem Freund der schönen Künste und der Bombengeschwader, allerlei, was ihm am Herzen lag, durchzusetzen. Er hatte es sich zum Beispiel in den Kopf gesetzt, auf der Bühne des Staatstheaters als Friedrich der Große von Preußen zu erscheinen – das war so eine Laune von ihm. »Ich will nicht immer nur Dandys und Verbrecher spielen«, erklärte er schmollend dem Dicken. »Das Publikum fängt ja schon an, mich mit diesen Typen zu identifizieren, wenn ich sie immer wieder darstelle. Nun brauche ich einmal eine große patriotische Rolle. Dieses schlechte Stück über den Alten Fritz, das unser Freund Muck da angenommen hat, kommt mir gerade recht. Das wäre eine Sache für mich!« Der General mochte einwenden, daß Höfgen dem berühmten Hohenzollern überhaupt nicht ähnlich sehe, doch Hendrik bestand auf seiner vaterländischen Caprice, in der er übrigens von Lotte Lindenthal unterstützt wurde. »Aber ich kann doch Maske machen!« rief er aus. »Ich habe in meinem Leben schon ganz andere Dinge fertiggebracht, als mal ein bißchen auszusehen wie der Alte Fritz!« – Der Dicke hatte volles Zutrauen zu den Maskierungskünsten seines Schützlings. Er befahl, daß Höfgen den Alten Fritz spiele. Cäsar von Muck, der schon eine andere Besetzung angeordnet hatte, biß sich zuerst die Lippen, schüttelte dann Hendrik beide Hände und sprach sächsisch vor Herzlichkeit. Hendrik bekam seinen Preußenkönig, klebte sich eine falsche Nase, ging am Krückstock und sprach mit krächzender Stimme. Doktor Erding schrieb, er entwickle sich mehr und mehr zum repräsentativen Schauspieler des neuen Reiches. Pierre Larue berichtete an eine faschistische Revue in Paris, das Berliner Theater habe jetzt eine Vollkommenheit erreicht, die es in den vierzehn Jahren der Schmach und der Versöhnungspolitik niemals besessen.
Bei seinem gewaltigen Protektor setzte Hendrik noch ganz anderes durch als derlei Harmlosigkeiten. An einem besonders gemütlichen Abend – Lotte hatte eine Bowle gebraut, und der Dicke hatte Kriegserinnerungen erzählt – entschloß sich Höfgen dazu, völlig offen zu werden und von seiner schlimmen Vergangenheit zu sprechen. Es war eine große Beichte, und der Gewaltige nahm sie gnädig auf. »Ich bin ein Künstler!« rief Hendrik mit glimmenden Augen, und er eilte wie ein nervöser Sturmwind durchs Zimmer. »Und wie jeder Künstler habe ich manche Torheit begangen.« Er blieb stehen, ließ den Kopf in den Nacken sinken, breitete ein wenig die Arme und erklärte pathetisch: »Sie können mich vernichten, Herr Ministerpräsident. Nun gestehe ich alles.«
Er gestand, daß er von den zersetzenden bolschewistischen Strömungen nicht unberührt geblieben sei und mit der »Linken« kokettiert habe. »Das war Künstlerlaune!« erklärte er mit leidendem Stolz. »Oder Künstlertorheit – wenn Sie es so nennen wollen!«
Natürlich hatte der Dicke all dies, und noch viel mehr, schon seit langem gewußt und sich nie darüber aufgeregt. Im Lande mußte eiserne Zucht herrschen, und möglichst viele sollten hingerichtet werden. Was seine engere Umgebung betraf, war der große Mann liberal. »Na ja«, sagte er nur. »Jeder kann sich mal in was Blödes verrennen. Es waren eben schlechte, unordentliche Zeiten.«
Hendrik aber war noch keineswegs fertig. Nun ging er dazu über, dem General auseinanderzusetzen, daß andere verdienstvolle Künstler die gleichen Torheiten begangen hätten wie er selbst. »Diese aber büßen noch für Sünden, die man mir so großmütig vergeben hat. Sehen Sie, Herr Ministerpräsident, und das quält mich. Ich bitte für einen bestimmten Menschen. Für einen Kameraden. Ich kann versprechen, daß er sich gebessert hat. Herr Ministerpräsident – ich bitte für Otto Ulrichs. Man hat schon gesagt, er sei tot. Aber er lebt. Und er verdient es, in der Freiheit zu leben.« Dabei hatte er, mit unwiderstehlich schöner Gebärde, seine beiden ausgestreckten Hände, die wirkten, als wären sie spitz und gotisch, etwa in die Höhe der Nase gehoben.
Lotte Lindenthal war zusammengezuckt. Der Ministerpräsident knurrte: »Otto Ulrichs … wer ist das?« Dann fiel ihm ein, daß es der Leiter des kommunistischen Kabaretts »Der Sturmvogel« war. »Aber das ist doch wohl wirklich ein ziemlich übler Kerl«, sagte er verdrossen.
Ach nein, doch kein übler Kerl! Hendrik beschwor den General, dies bitte ja nicht zu glauben. Ein wenig leichtsinnig – das wollte er zugeben – ein bißchen unbedacht war sein Freund Otto. Aber doch kein übler Kerl. Und übrigens hatte er sich ja geändert. »Er ist ein ganz neuer Mensch geworden«, behauptete Hendrik, der seit Monaten ohne jeden Kontakt mit Ulrichs war.
Da Lotte Lindenthal selbst in dieser heiklen Sache Hendrik ihren Beistand lieh, gelang es schließlich, das Unglaubliche beim Dicken durchzusetzen: Ulrichs wurde freigelassen, und man offerierte ihm sogar ein kleines Engagement am Staatstheater – selbst dies Äußerste und Unwahrscheinlichste hatten Hendrik und Lotte mit vereinten Kräften erreicht. Ulrichs aber sagte: »Ich weiß nicht, ob ich mich darauf einlassen kann. Ich ekle mich davor, von diesen Mördern eine Gnade zu empfangen und den reuigen Sünder zu spielen – und ich ekle mich überhaupt.«
Mußte Hendrik seinem alten Freund einen Vortrag über revolutionäre Taktik halten? »Aber Otto«, rief er aus, »dein Verstand scheint gelitten zu haben! Wie willst du denn heute durchkommen, ohne List und Verstellung? Nimm dir ein Beispiel an mir!«
»Ich weiß es schon«, sagte Ulrichs, gutmütig und bekümmert. »Du bist schlauer. Aber mir fallen diese Dinge so verdammt schwer …«
Mit Emphase versetzte Hendrik: »Du wirst dich zwingen müssen. Ich habe mich auch gezwungen.« Und er belehrte den Freund darüber, wieviel Selbstüberwindung es ihn gekostet habe, so mit den Wölfen zu heulen, wie er es nun leider tue. »Aber wir müssen uns einschleichen in die Höhle des Löwen«, erklärte er. »Wenn wir draußen bleiben, können wir nur schimpfen, aber nichts erreichen. Ich bin mittendrin. Ich erreiche was.« Dies war eine Anspielung darauf, daß Hendrik die Freilassung Ulrichs’ durchgesetzt hatte. »Wenn du engagiert am Staatstheater bist, kannst du deine alten Verbindungen wieder aufnehmen und politisch ganz anders arbeiten als aus irgendeinem obskuren Versteck.« Dieses Argument leuchtete Ulrichs ein. Er nickte. »Und überhaupt«, gab Hendrik noch zu bedenken, »wovon willst du leben, wenn du kein Engagement hast? Gedenkst du den ›Sturmvogel‹ wieder aufzumachen?« fragte er höhnisch. »Oder willst du verhungern?«
Sie befanden sich in Höfgens Wohnung am Reichskanzlerplatz. Hendrik hatte dem Freunde, der erst seit einigen Tagen wieder in Freiheit war, ein kleines Zimmer in der Nachbarschaft gemietet. »Es wäre unvorsichtig, dich bei mir wohnen zu lassen«, sagte er. »Das könnte uns beiden schaden.« Ulrichs war mit allem einverstanden. »Du wirst es schon so machen, wie es am richtigsten ist.«
Sein Blick war traurig und zerstreut, sein Gesicht war viel magerer geworden. Übrigens klagte er oft über Schmerzen. »Es sind die Nieren. Man hat mich eben doch arg hergenommen.« Wenn Hendrik aber dann, mit einer etwas lüsternen Neugierde, Genaueres wissen wollte, winkte Otto ab und verstummte. Er sprach nicht gerne von dem, was ihm im Konzentrationslager widerfahren war. Wenn er irgendeine Einzelheit erwähnte, schien er sich gleich zu schämen und zu bereuen, daß er sie ausgesprochen hatte. Als er mit Hendrik im Grunewald spazierenging, deutete er auf einen Baum und sagte: »So sah der Baum aus, auf den ich mal klettern mußte. Es war ziemlich schwer raufzukommen. Als ich oben saß, warfen sie mit Steinen nach mir. Einer hat mich an der Stirn getroffen – da ist noch die Narbe. Von oben mußte ich hundertmal rufen: Ich bin ein dreckiges Kommunistenschwein. Als ich endlich wieder runterklettern durfte, warteten sie schon auf mich mit den Peitschen …«
Otto Ulrichs – sei es aus Müdigkeit und Apathie, sei es, weil Hendriks Argumente ihn überzeugt hatten – ließ sich an das Staatstheater engagieren. Höfgen war sehr zufrieden. ›Ich habe einen Menschen gerettet‹, dachte er stolz. ›Das ist eine gute Tat.‹ Mit solchen Betrachtungen beruhigte er sein Gewissen, das immer noch nicht völlig abgestorben war, trotz allem, was ihm zugemutet wurde. Übrigens war es nicht nur das Gewissen, welches ihm zuweilen zu schaffen machte, sondern auch ein anderes Gefühl: die Angst. Würde dieses ganze Treiben, an dem er sich jetzt so emsig beteiligte, ewig dauern? Konnte nicht ein Tag der großen Veränderung und der großen Rache kommen? Für solchen Fall war es günstig und sogar notwendig, Rückversicherungen zu haben. Die gute Tat an Ulrichs bedeutete eine besonders kostbare Rückversicherung. Hendrik freute sich ihrer.
Alles stand glänzend, Hendrik hatte Anlaß zur Zufriedenheit. Leider gab es eine Sache, die ihm Sorge machte. Er wußte nicht, wie er seine Juliette loswerden sollte.
Im Grunde wollte er sie gar nicht loswerden, und wenn es nach seinen Wünschen gegangen wäre, hätte er sie ewig behalten; denn er liebte sie noch. Vielleicht hatte er sich noch niemals so heftig nach ihr gesehnt wie eben jetzt. Er begriff, daß keine andere Frau sie ihm je würde ganz ersetzen können. Aber er wagte es nicht mehr, sie zu besuchen. Das Risiko war zu groß. Er hatte damit zu rechnen, daß Herr von Muck und der Propagandaminister ihn durch Spione bewachen ließen – dergleichen war sehr wohl möglich, obwohl der Intendant meistens sächsisch vor lauter Herzlichkeit mit ihm sprach und der Minister sich mit ihm photographieren ließ. Wenn sie herausbekamen, daß er mit der Negerin ein Verhältnis hatte und sich obendrein von ihr hauen ließ, dann war er verloren. Eine Schwarze: das war mindestens ebenso arg wie eine Jüdin. Es war ganz genau das, was man jetzt allgemein »Rassenschande« nannte und äußerst verwerflich fand. Ein deutscher Mann hatte mit einem blonden Weibe Kinder zu machen; denn der Führer brauchte Soldaten. Keinesfalls durfte er bei einer Prinzessin Tebab Tanzstunden nehmen, die eigentlich makabre Lustbarkeiten waren. Kein Volksgenosse, der auf sich hielt, tat so was. Auch Hendrik konnte es sich nicht mehr leisten.
Eine Zeitlang nährte er die törichte Hoffnung, Juliette würde nicht herausbekommen, daß er in Berlin war. Aber natürlich hatte sie es noch am Tag seiner Ankunft erfahren. Geduldig wartete sie auf seinen Besuch. Da er stumm blieb, ging sie ihrerseits zum Angriff über. Sie rief ihn an. Hendrik ließ durch Böck erklären, er sei nicht zu Hause. Juliette tobte, rief wieder an und drohte, sie werde kommen. Was, um des Himmels willen, sollte Hendrik tun? Ihr einen Brief zu schreiben schien ihm nicht ratsam: sie könnte das Papier zur Erpressung benutzen. Er entschloß sich endlich dazu, sie in jenes stille Café zu bestellen, in dem er sein diskretes Rendezvous mit dem Kritiker Erding gehabt hatte.
Juliette trug keine grünen Stiefel und kein kurzes Jäckchen, vielmehr ein sehr einfaches graues Kleid, als sie zur ausgemachten Stunde im Lokal erschien. Ihre Augen waren rot und verschwollen. Sie hatte geweint. Prinzessin Tebab, die Königstochter vom Kongo, hatte Tränen vergossen um ihren ungetreuen weißen Freund. Auf ihrer niedrigen Stirne, die zu zwei kleinen Buckeln gewölbt war, lag ein drohender Ernst. – ›Sie hat vor Zorn geweint‹, dachte Hendrik, denn er glaubte kaum, daß Juliette andere Gefühle kannte als Zorn, Habgier, Naschsucht oder Sinnlichkeit.
»Du schickst mich also weg«, sagte das dunkle Mädchen und hielt die Lider gesenkt über ihren beweglichen und gescheiten Augen.
Hendrik versuchte, ihr die Situation auf vorsichtige, aber eindringliche Weise klarzumachen. Er zeigte sich väterlich besorgt um ihre Zukunft und gab ihr mit sanfter Stimme den Rat, möglichst bald nach Paris zu fahren. Dort werde sie Arbeit als Tänzerin finden. Übrigens versprach er, ihr monatlich etwas Geld zukommen zu lassen. Verführerisch lächelnd legte er einen großen Geldschein vor sie hin auf den Tisch.
»Ich will aber nicht nach Paris«, sagte eigensinnig Prinzessin Tebab. »Mein Vater war ein Deutscher. Ich fühle mich ganz als Deutsche. Ich habe auch blonde Haare – wirklich, sie sind nicht gefärbt. Und überhaupt, ich kann kein Wort Französisch. Was soll ich denn in Paris?«
Hendrik mußte über ihren Patriotismus lachen, worüber sie zornig wurde. Nun schlug sie ihre wilden Augen auf und ließ sie rollen. »Dir wird das Lachen schon noch vergehen«, schrie sie ihn an. Sie hob die dunklen und rauhen Hände, sie streckte sie gegen ihn, als wollte sie ihm ihre hellen Innenflächen zeigen. Hendrik blickte sich entsetzt nach der Kellnerin um; denn Juliette ließ mit lauter, jammernder, fast heulender Stimme Vorwürfe und Anklagen hören. »Du hast niemals irgend etwas ernst genommen«, behauptete sie in ihrem schmerzvollen Zorn. »Nichts, nichts, gar nichts auf dieser Welt, außer deiner dreckigen Karriere! Mich hast du nicht ernst genommen, und deine Politik auch nicht, von der du mir immer vorerzählt hast! Wenn du wirklich zu den Kommunisten gehalten hättest, könntest du dich dann jetzt so gut mit den Leuten vertragen, die alle Kommunisten totschießen lassen?«
Hendrik war bleich wie das Tischtuch geworden. Er stand auf. »Genug!« sagte er leise. Sie aber hatte ein höhnisches Lachen, das durchs Lokal gellte, in dem, zu Hendriks Glück, niemand saß. »Genug!« äffte sie ihn nach, wobei sie die Zähne bleckte. »Genug – ja, das könnte dir so passen: genug! Jahrelang habe ich die wilde Frau spielen müssen, obwohl ich gar keine Lust dazu hatte, und nun willst du plötzlich der starke Mann sein! Genug, genug: ja, jetzt brauchst du mich nicht mehr – vielleicht weil jetzt im ganzen Land soviel geprügelt wird? Da kommst du wohl auch ohne mich auf deine Kosten?! – Ach, ein Schuft bist du! Ein ganz gemeiner Schuft!« Sie hatte das Gesicht in die Hände geworfen, ihr Körper wurde vom Schluchzen geschüttelt. »Ich kann es schon verstehen, daß deine Frau, daß diese Barbara es bei dir nicht ausgehalten hat«, brachte sie noch zwischen den nassen Fingern hervor. »Ich habe sie mir ja angeschaut. Die war viel zu schade für dich …«
Hendrik hatte die Tür erreicht. Der Geldschein war auf dem Tisch, vor Juliette, liegengeblieben.
Ach nein, so leicht ließ sich die Prinzessin Tebab nicht wegschicken, freiwillig wich sie nicht. Wenn sie dieses Mal nachgab – das begriff sie sehr wohl – dann hatte sie ihn ganz verloren, ihren Hendrik, ihren weißen Sklaven, ihren Herrn, ihren Heinz – und sie besaß ja niemanden außer ihm. Damals, als er diese Barbara geheiratet hatte, das Bürgermädchen, da war Juliette zuversichtlich und furchtlos geblieben: sie hatte gewußt, daß er zu ihr, zu seiner Schwarzen Venus, zurückkehren würde. Jetzt stand es anders. Jetzt ging es um seine Karriere. Er schickte sie nach Paris. Sie hieß aber doch Martens, und ihr Vater wäre heute ein sehr angesehener Nationalsozialist, wenn er sich nicht am Kongo die Malaria geholt hätte …
Juliette wollte nicht weichen. Aber Hendrik war stärker als sie. Er war mit der Macht im Bunde.
Das arme Mädchen belästigte und beunruhigte ihn noch eine Zeitlang durch Briefe und telefonische Anrufe. Dann lauerte sie ihm vorm Theater auf. Als er nach der Vorstellung das Haus verließ – durch einen guten Zufall war er allein – stand sie da, mit grünen Stiefeln, kurzem Röckchen, vorgerecktem Busen und gräßlich blitzenden Zähnen. Hendrik machte panische Armbewegungen, als gäbe es ein Gespenst zu verscheuchen. Mit großen Sprüngen erreichte er seinen Mercedes. Juliette lachte gellend hinter ihm drein. »Ich komme wieder!« schrie sie, während er schon im Wagen saß. »Von jetzt ab komme ich jeden Abend«, verhieß sie ihm mit grauenhafter Munterkeit. Vielleicht war sie wahnsinnig geworden aus Schmerz und Enttäuschung über seinen Verrat. Vielleicht war sie auch nur betrunken. Sie hatte die rote Peitsche bei sich, das Wahrzeichen ihres Bundes mit Hendrik Höfgen.
Ein so furchtbarer Auftritt durfte sich keinesfalls wiederholen. Es blieb Hendrik nichts anderes übrig: er mußte sich auch in dieser peinlichen Angelegenheit seinem dicken Gönner, dem Ministerpräsidenten, anvertrauen. Der allein konnte helfen. Freilich, es war ein riskantes Spiel: der Gewaltige konnte die Geduld verlieren und ihm seine ganze Gnade entziehen. Etwas Einschneidendes aber hatte zu geschehen, sonst wurde der öffentliche Skandal unvermeidlich.
Höfgen bat um Audienz und legte, wieder einmal, eine umfassende Beichte ab. Übrigens zeigte der General ein überraschend großes und fast amüsiertes Verständnis für die erotischen Extravaganzen, die seinen Günstling jetzt in so bedrohliche Unannehmlichkeiten brachten.
»Wir sind ja alle keine Unschuldsengel«, sprach der Dicke, von dessen Güte Hendrik dieses Mal aufrichtig ergriffen war. »Ein Negerweib fuchtelt mit der Peitsche vor dem Staatstheater herum!« Der Ministerpräsident lachte herzlich. »Das ist ja eine schöne Geschichte! – Ja, was machen wir da? Das Mädel muß weg, soviel ist sicher …«
Hendrik, der doch nicht geradezu wollte, daß Prinzessin Tebab umgebracht würde, bat leise: »Aber daß ihr nichts zuleid geschieht!« Hieraufhin wurde der Staatsmann neckisch. »Na, na«, machte er fingerdrohend. »Sie scheinen der schönen Dame immer noch etwas hörig zu sein! – Lassen Sie mich nur machen!« fügte er väterlich beruhigend hinzu.
Noch am selben Tag erschienen bei der unglücklichen Königstochter zwei diskret, aber unerbittlich auftretende Herren, die ihr mitteilten, daß sie verhaftet sei. Prinzessin Tebab kreischte: »Wieso?« Aber die beiden Herren sagten gleichzeitig, mit leisen und harten Stimmen, die keinen Widerspruch duldeten: »Folgen Sie uns!« Da schluchzte sie nur noch: »Ich habe nichts Böses getan …«
Vor dem Hause stand ein geschlossener Wagen, mit schauerlicher Höflichkeit forderten die Herren Juliette auf, einzusteigen. Während der Fahrt, die ziemlich lange dauerte, schluchzte und plapperte sie; sie stellte Fragen, sie verlangte zu wissen, wohin sie entführt werde. Da man ihr nicht antwortete, begann sie zu schreien. Aber sie verstummte, als sie den entsetzlich harten Griff eines ihrer Begleiter am Arme spürte. Sie verstand: alles Reden, alles Klagen war sinnlos, und das Schreien konnte vielleicht ihr Leben gefährden. Oder war ihr Leben ohnedies verloren? Hendrik hatte die Macht gegen sie aufgerufen. Hendrik bediente sich der unbarmherzigen Macht, um sie, ein schutzloses Mädchen, aus dem Wege zu räumen … Mit Augen, die sich vor Entsetzen weiteten und blind zu werden schienen, starrte sie vor sich hin.
Nun folgten für sie lange Tage des Schweigens – waren es zehn Tage, oder vierzehn, oder nur sechs? Man hatte sie in einer halbdunklen Zelle untergebracht; sie wußte nicht, in welchem Hause sich die Zelle befand. Niemand gab ihr Auskunft darüber, wo sie war, und warum, und wie lange sie würde bleiben müssen. Sie fragte schon gar nicht mehr. Dreimal am Tage stellte ihr eine stumme Frau in einer blauen Schürze etwas zu essen hin. Manchmal weinte Juliette. Meistens aber saß sie regungslos und starrte die Wand an. Sie wartete darauf, daß die Tür sich öffnen und jemand erscheinen würde, der sie zu ihrem letzten Gang – zu einem unbegreiflichen, bitteren, aber doch erlösenden Tode führte.
Als sie eines Nachts aus ihrem schweren, traumlosen Schlafe geweckt wurde, empfand sie sofort und beinah mit Erleichterung: Nun ist es soweit. Vor ihr aber stand nicht der Uniformierte, der beauftragt war, sie zu töten, sondern Hendrik. Sein Gesicht war sehr bleich und hatte den gespannten Leidenszug an den Schläfen. Juliette schaute ihn an, als wäre er ein Gespenst.
»Freust du dich, mich zu sehen?« fragte er leise.
Prinzessin Tebab antwortete nicht. Sie schaute ihn an.
»Du schweigst«, konstatierte er bekümmert. Und mit der wehleidig singenden Stimme fügte er hinzu – wobei er sie mit einem zauberhaften Edelsteinblick beschenkte: »Ich, meine Liebe, ich habe mich auf diesen Augenblick gefreut. – Du bist frei«, sagte er und machte eine schöne Armbewegung.
Während Prinzessin Tebab regungslos blieb und ihn immer nur anschaute, setzte er ihr auseinander, daß sie sofort nach Paris abreisen dürfe … Es sei alles geregelt: in ihrem Paß befinde sich schon das französische Visum, ihr Gepäck erwarte sie auf der Bahn, in Paris könne sie sich an jedem Monatsersten eine bestimmte Summe an einer bestimmten Adresse abholen. »Nur eine Bedingung ist an diese große Gnade geknüpft«, sprach Höfgen, der Freiheitsbringer, und dabei wurden seine süßen Augen plötzlich streng. »Du mußt schweigen! Wenn du den Mund nicht halten kannst«, sagte er, nun in einem veränderten, recht groben Ton, »dann ist es aus mit dir. Du würdest deinem Schicksal auch in Paris nicht entgehen. – Versprichst du mir, meine Liebe, daß du schweigen wirst?« Hier wurde seine Stimme beschwörend, und er neigte sich zärtlich zu seinem Opfer. Juliette widersprach nicht. Ihr Trotz war zerbrochen während der langen Tage in halbdunkler Zelle. Sie nickte stumm. »Du bist vernünftig geworden«, stellte Hendrik fest und lächelte erleichtert. Dabei dachte er: ›Mein hartes Verfahren hat sie gefügig gemacht. Von ihr habe ich nichts mehr zu fürchten. Aber wie schade, wie unendlich schade, daß ich sie verlieren muß …‹
Prinzessin Tebab war abgereist: Hendrik durfte aufatmen, die Verfinsterung war vom Himmel seines Glückes gewichen. Keine schrecklichen Telefonanrufe störten ihn mehr aus dem Schlaf. War es aber nur Erleichterung, was er spürte?
Juliette war aus seinem Leben verschwunden. Barbara war aus seinem Leben verschwunden. Beiden hatte er geschworen, er werde sie immer lieben. Hatte er Barbara nicht seinen guten Engel genannt? »Sie ist viel zu schade für dich gewesen« – das waren die Worte der Prinzessin Tebab. ›Was weiß das rohe Negermädchen von mir und den komplizierten Vorgängen in meiner Seele?‹ versuchte Hendrik zu denken. Aber nicht immer gestattete sein Herz ihm so billige Ausreden. Manchmal schämte er sich: vielleicht vor sich selber; vielleicht vor Juliette, deren Blick in der halbdunklen Zelle so jammervoll, so vorwurfsvoll, so drohend auf ihn gerichtet gewesen war. Nun, da er sie verloren, weggeschickt und verraten hatte, gab es Augenblicke, da Hendrik wirklich nachdenken mußte über seine Schwarze Venus. Er hatte sie genossen als die ruchlose, unbeseelte Kraft, an der seine Energien sich erfrischten und erneuerten. Er hatte das Götzenbild aus ihr gemacht, vor dem er schwärmte: »Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l’abîme, o Beauté?« Und er hatte ihr in seiner egoistischen Ekstase zugerufen: »Tu marches sur des morts, dont tu te moques …« Aber vielleicht war sie gar kein Dämon. Am Ende lag es gar nicht in ihrer Art, über Leichen zu spazieren. Nun war sie, ganz allein und bitterlich weinend, in eine fremde Stadt abgereist. – Warum denn? Weil ein anderer dazu imstande gewesen wäre, über Tote zu gehen …?
»Der geht über Leichen« – auf so despektierliche Art pflegte der junge Hans Miklas sich über seinen berühmten Kollegen, den Staatsschauspieler Hendrik Höfgen zu äußern. Der renitente Knabe nahm keinerlei Rücksicht darauf, daß sein alter Todfeind unter dem besonderen Protektorat des Ministerpräsidenten und der großen Lindenthal stand. Miklas ließ sich auf das unvorsichtigste gehen: er schimpfte nicht nur über den Kollegen Höfgen, sondern auch über Herren, die noch höher gestellt waren als dieser. Wußte er denn nicht, was er riskierte mit seinen frechen, unbedachten Redereien? Oder wußte er es, scherte sich aber nicht darum? War er denn gesonnen, alles aufs Spiel zu setzen? War ihm alles egal?
Seinem Gesicht waren solche Gefühle und innere Entschlüsse dieser Art zuzutrauen. Niemals, auch nicht in der Hamburger Zeit, hatte er so böse und so schrecklich trotzig dreingeschaut wie eben jetzt. Damals waren doch noch Hoffnungen und ein großer Glaube in ihm gewesen. Jetzt hatte er gar nichts mehr. Er ging herum und sagte: »Es ist alles Scheiße. – Wir sind betrogen worden«, sagte er. »Der Führer wollte die Macht, sonst gar nichts. Was hat sich denn in Deutschland gebessert, seitdem er sie hat? Die reichen Leute sind nur noch ärger geworden. Jetzt reden sie patriotischen Quatsch, während sie ihre Geschäfte machen – das ist der einzige Unterschied. Die Intriganten sind immer noch obenauf.« Miklas dachte an Höfgen. »Ein anständiger Deutscher kann verrecken, ohne daß sich jemand drum kümmert«, behauptete er in seinem großen und leidvollen Zorn. »Den Bonzen aber – denen geht es besser als je. Schaut euch doch den Dicken an, wie der herumfährt in seinen goldenen Uniformen und in seiner Luxuslimousine! Und der Führer selber ist auch nicht besser – das haben wir jetzt erfahren! Könnte er denn sonst all das dulden? Die furchtbar vielen Ungerechtigkeiten? – Unsereiner hat für die Bewegung gekämpft, als sie noch gar nichts war, und jetzt will man uns links liegen lassen. Ein alter Kulturbolschewist aber, wie der Höfgen, der ist wieder die große Nummer …«
So zügellose und verwerfliche Reden führte der junge Miklas, jeder konnte sie hören. Kein Wunder, daß die Mitglieder des Staatstheaters anfingen, ihn zu meiden. Der Intendant ließ ihn einmal zu sich kommen und verwarnte ihn. »Ich weiß es, Sie sind seit Jahren in der Partei«, sprach Cäsar von Muck. »Gerade deshalb sollten Sie Disziplin gelernt haben, und wir müssen besonders hohe Anforderungen an Ihre politische Vernunft stellen.« Miklas machte sein bockiges Gesicht. Er senkte die trotzige Stirn, schob die Lippen vor, die ein ungesundes, viel zu rotes Leuchten hatten, und sagte mit leiser, heiserer Stimme: »Ich werde aus der Partei austreten.« – Wollte er es bis aufs Äußerste treiben?
Während Muck dem jungen Schauspieler empört den Rücken drehte, bekam Miklas einen Hustenanfall. Der Husten schüttelte seinen mageren Körper, dem er seit Jahren zuviel zugemutet hatte. Hustend verließ er das Büro des Intendanten. Sein Gesicht war grau, mit schwarzen Löchern unterhalb der Backenknochen. Zwischen grauschwarzen Schatten hatten die Augen ein helles und böses Licht. – Zornig, aber nicht ohne Erstaunen, auch nicht ganz ohne Mitleid, schaute der Intendant dem jungen Menschen nach. ›Der ist verloren!‹ dachte Cäsar von Muck.
Du bist verloren, armer junger Hans Miklas! Nach soviel Anstrengungen, soviel verschwendetem Glauben: Was bleibt dir nun? Nur noch Haß, nur noch Traurigkeit, und die wilde Lust, den eigenen Untergang zu beschleunigen. Ach, er kommt von allein schnell genug, er wenigstens ist dir sicher, du wirst nicht mehr lange hassen, nicht mehr lange trauern müssen. Du wagst es, dich gegen Mächte und Personen aufzulehnen, von denen du immer sehnlich gewünscht hast, sie möchten herrschen. Aber du bist schwach, junger Miklas, und du hast keinen Beschützer.
Die Macht, die du geliebt hast, ist grausam. Sie duldet keine Kritik, und wer sich auflehnt, der wird zerschmettert. – Du wirst zerschmettert, Knabe, von den Göttern, zu denen du so innig gebetet hast. Du stürzest hin, aus einer kleinen Wunde sickert ein wenig Blut in das Gras, und nun sind deine Lippen ebenso weiß wie deine leuchtende Stirn.
Weint denn niemand über deinen Sturz, über dies Ende einer so großen, so glühenden und so bitter betrogenen Hoffnung? Wer sollte denn weinen? Du warst beinah immer allein. An deine Mutter hast du schon seit Jahren nicht mehr geschrieben, sie hat einen fremden Mann geheiratet, dein Vater ist ja tot, er ist im Weltkrieg gefallen. Wer sollte denn weinen? Wer sollte denn das Antlitz verhüllen über deine jammervoll vergeudete Jugend, über deinen jammervollen, jammervollen Tod? So drücken wir dir denn die Augen zu, auf daß sie nicht länger offenstehen und mit dieser stummen Klage, diesem unsäglichen Vorwurf zum Himmel starren. Bist du nachsichtiger, armes Kind, jetzt im Tode, als dich ein hartes Leben es sein ließ? Dann wirst du es uns vielleicht verzeihen können, daß wir es sind – deine Feinde – die sich als die einzigen über deine Leiche neigen.
Denn dein Schicksal hat sich erfüllt, es ging schnell. Du hast das Ende provoziert, du hast es herbeigerufen. Hättest du sonst andere Knaben – noch unwissendere, noch jüngere, als du selbst einer gewesen bist – um dich versammelt und Verschwörung mit ihnen gespielt? Wem wolltet ihr denn ans Leben? Eurem »Führer« selbst, oder nur einem seiner Satrapen? Ihr meintet, alles müsse »ganz anders« werden – dies war ja von jeher euer großer Wunsch. Die nationale Revolution – so meintet ihr – die wirkliche, echte, kompromißlose Revolution, um die man euch so schmählich betrogen hatte: nun sei sie fällig und überfällig. Ging nicht sogar ein Brief von euch ab an einen Mann in der Emigration, der ehemals ein Freund eures Führers gewesen war und sich von ihm enttäuscht gefunden hatte wie ihr?
Alles wurde verraten, natürlich wurde alles verraten, und eines Morgens erschienen uniformierte Burschen in deinem Zimmer, du hattest früher schon mit ihnen zu tun gehabt, es waren alte Bekannte – und sie forderten dich auf, in einen Wagen zu steigen, der unten wartete. Du sträubtest dich auch nicht lange. Man fuhr dich ein paar Kilometer vor die Stadt, in ein Wäldchen. Der Morgen war frisch, du frorst, aber keiner von den alten Kameraden gab dir eine Decke oder einen Mantel. Der Wagen hielt, und man befahl dir, ein paar Schritte spazierenzugehen. Du gingst die paar Schritte. Du spürtest noch einmal den Geruch des Grases, und ein morgendlicher Wind berührte deine Stirn. Du hieltest dich aufrecht. Vielleicht wären die im Wagen erschrocken über den unsagbar hochmütigen Ausdruck deines Gesichtes; aber sie sahen dein Gesicht nicht, sie sahen nur deinen Rücken. Dann krachte der Schuß.