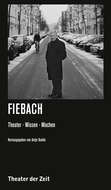Read the book: «Die falsche Frage»
Kathrin Röggla – Die falsche Frage
Gedruckt mit finanzieller Unterstützung der Universität des Saarlandes.
Kathrin Röggla
Die falsche Frage
Theater, Politik und die Kunst, das Fürchten nicht zu verlernen
Saarbrücker Poetikdozentur für Dramatik
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Johannes Birgfeld
Recherchen 116
© 2015 by Theater der Zeit
Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich im Urheberrechts-Gesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Medien.
Verlag Theater der Zeit
Verlagsleiter Harald Müller
Winsstraße 72 | 10405 Berlin | Germany
Lektorat: Nicole Gronemeyer
Coverbild: Kathrin Röggla, Foto: Heribert Corn
Fotostrecke: Kathrin Röggla
Covergestaltung: Bild1Druck, Berlin
Gestaltung: Sibyll Wahrig
Printed in Germany
ISBN 978-3-95749-012-4
Kathrin Röggla
DIE FALSCHE FRAGE
Theater, Politik und die Kunst,
das Fürchten nicht zu verlernen
Saarbrücker Poetikdozentur für Dramatik
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Johannes Birgfeld

ERSTE VORLESUNG
Eine Deklination des Zukünftigen
Text und Rahmen und eine kleine Liste des Ungeschriebenen
ZWEITE VORLESUNG
Karten und ihr Gegenteil
Kollektive und Revolten
DRITTE VORLESUNG
Blinde Flecken
Kritik und Realismus
Anmerkungen zu den Vorlesungen
Nachwort
von Johannes Birgfeld
Anhang
ERSTE VORLESUNG





EINE DEKLINATION DES ZUKÜNFTIGEN
Text und Rahmen und eine kleine Liste des Ungeschriebenen
Am Anfang werde ich über Märkte sprechen, überlege ich mir, Finanzmärkte, Kunstmärkte, Rohstoffmärkte, den Goldmarkt. Am Anfang steht heute doch immer eine Geschichte über Märkte. Was der Markt kann, was er nicht kann, wo man ihn aufgeben sollte. Doch ich muss zugeben, ich weiß wenig über Märkte, das heißt gerade so viel, wie ich brauche, doch das ist ganz und gar nicht richtig, man muss heute immer mehr wissen, eine Überinformation herstellen, was Märkte betrifft, vor allem, wenn man in der Kreativindustrie steckt, so von außen betrachtet, das heißt, wenn man mit dem Theater zu tun hat, so von innen betrachtet, muss man ein Überengagement im ökonomischen Diskurs beweisen, einen Überhang diesbezüglich hervorbringen, man muss sogar mehr über Märkte wissen, als Banker oder Vorstandsvorsitzende von Pharmakonzernen dies tun, will man zeigen, dass man dabei ist, dass man die Welt versteht, dass man sich in ihr zurechtfindet, denn der ökonomische Diskurs ist der Leitdiskurs, er wird verstanden, er hilft uns, uns zu orientieren und miteinander zu kommunizieren, und das weist am meisten auf seine Mächtigkeit hin. Gerade Branchen, die als wirtschaftsfern gelten, müssen erst einmal beweisen, dass sie drin sind, deswegen vielleicht habe ich auf den diversen Panels den Begriff „Alleinstellungsmerkmal“ so oft gehört, deswegen vielleicht habe ich die EU-Kommissarin für Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit und Jugend, Androulla Vassiliou, während der Vorstellung der neuen Kulturförderrichtlinien im April diesen Jahres andauernd über Marktanteile und Marktförderung reden hören, als sie eigentlich über Kunstförderung reden wollte.1 Vielleicht bestücken wir Theatermenschen deswegen (wenn wir nicht aufpassen) unsere Rede gerne mit ökonomischen Fachvokabeln, mit bench marks, Qualitätsmanagement, Entrepreneurship, und hören sogar manchmal das Gemurmel über den Arbeitskraftnehmer auf den Fluren der Theaterhäuser, nehmen das Huschen des Theaterprekariats mit seiner Flexibilisierung und Mobilisierung vorbei an uns jetzt endlich wahr, nachdem wir es eine ganze Zeit lang geflissentlich übersehen haben und finden es cool, naja, wir identifizieren uns damit irgendwie im Pollesch-Sound.
Während ich mich also überinformiere, frage ich mich so nebenbei, welchen Wert das hat, was ich mache. Denn das gehört heute auch immer dazu, den Wert zu ermessen, und direkt neben dieser Wertmessung beginne ich schon den Zeitdruck zu fühlen, unter dem ich gerade schon wieder stehe. Auf Seite 1 frage ich mich, warum ich noch nicht auf Seite 9 bin und auf Seite 27 verzweifle ich über die fehlenden anderen 27 Seiten. Es ist der reinste Text-Killer! In meinem E-Mail-Account stauen sich die Deadlines und in meinem Handy die Drängel-SMS, von fehlender Zeit erzählen mir die Intendanten, Dramaturgen, Lektoren, Verleger, Galeriemitarbeiter, Ausstellungsmacher, Kuratoren, die Sprache der Zeitlosigkeit und Hast ist ihnen allen zu eigen. Neben all der Betriebsamkeit und dem künstlerischen Aufbruch häuft sich überall das Unverfasste, das auf der Strecke Gebliebene, Unfinanzierbare, Unermöglichbare – schon alleine aus Zeitgründen. Es ist ein Wunder, dass überhaupt noch was geschrieben wird! Auch mein Schreibtisch bleibt davon nicht unberührt, das Ungeschriebene nimmt immer größere Räume ein, die Phantasie, was man nicht alles schreiben könnte, hätte man die Zeit dazu, wird immer blühender.
Insofern, überlege ich mir, sollte man am Anfang doch lieber nicht über Märkte sprechen. Nein, nein, nein! Am Anfang sollen die ungeschriebenen Stücke stehen. Frei nach der langen und erstaunlichen Liste des Unverfilmten von Claudia Lenssen in Alexander Kluges Band Bestandsaufnahme: Utopie Film von 19832 gilt es, eine Liste der ungeschriebenen Stücke zu erstellen, allerdings, da bin ich strikt zeitgemäß, als Selbstaufforderung. Niemals würde ich heute einem dramatischen Produktionssystem etwas abverlangen, wo käme man da hin? Das wäre ja fast so, als würde ich von anderen etwas fordern, als würde ich da einen Protest nach außen tragen, einen Einspruch, Widerspruch, und eben eine Aufforderung, etwas zu tun, sozusagen anders, nein, ich bleibe da hübsch im Selbstmanagement, immer brav bei mir, die ich für alles hier verantwortlich bin in Zeiten der Ich-AG und des „unternehmerischen Selbst“, das der Soziologe Ulrich Bröckling so genau beschrieben hat3 – wissen wir ja!
Gleich zu Beginn kommen sie also zu Wort, meine ungeschriebenen Texte, die ich ewig vorhatte und mir nicht zugetraut habe, die, die ich vergessen habe, abgeschrieben, aus irgendwelchen Gründen fallen gelassen. Die, die mir unmöglich erschienen, bei denen die Recherche nicht zu bewerkstelligen war, für die ich zu wenig Gesprächspartner bekommen habe. Oder zu wenig Schweigen zusammenkratzen konnte wie etwa für das Stück, das nur aus Regieanweisungen besteht. Natürlich anders als Handkes Die Stunde da wir nichts voneinander wußten,4 nicht so verblasen, abgehoben. Es wird zu erwähnen sein, das Stück, das immer schweigsamer wird, oder das Stück, in dem so schnell miteinander geredet wird, dass fast nichts zu verstehen ist, dieser kleine Philippe-Quesne-Ableger,5 der ein wenig mehr Stofflichkeit aufnimmt. Ich werde es vorstellen, das Stück, in dem die Leute sich niemals zu Wort kommen lassen. Oder: Das Stück, geschrieben im Futur, wie es Forced Entertainment in Tomorrow’s Parties gemacht hat, nur beweglicher, architektonischer.6 Und dann: die gesungene Telefonerzählung, aber nicht so privatistisch wie die des Nature Theater of Oklahoma,7 mit radikaler Mündlichkeit, in die ich aber mit absolut schriftlicher Stilisierung hineingrätschen wollte.
Solche Ideen ergeben noch kein Stück, werden Sie sagen, sicher, aber diese Ideen schwirren wie die Fliegen um einen Stückanfang, sie sind erstmal da. Beinahe unabhängig vom Stofflichen, aber eben nur beinahe. Sie haben eine notwendige Verbindung, genauso wie jene Idee, über das imaginäre Ereignis eines Börsencrashs einen Roman zu schreiben, und zwar als „plötzliche Auflösung von erzählbaren Ereigniszusammenhängen“, wie es Joseph Vogl in Soll und Haben ausgedrückt hat,8 das eine bedingt eben das andere.
Ja, die ungeschriebenen Texte zuerst, danach werde ich mit den vagen Plänen weitermachen, die schon konkreteren Vorhaben, aus denen nichts wurde. Die Neuschreibung des Eingebildeten Kranken von Molière, ein Stück über das Gesundheitssystem, das ich aus Susan-Sontag-Lektüren wie aus Interviews mit Ärzten, Krankenpflegern und chronisch kranken Patienten gleichermaßen hervortreibe, nicht ohne mich vorher intensiv in die feinsten Verästelungen der Hypochonderforen im Internet begeben zu haben. Ich wollte noch einmal den französischen Philosophen Gilles Deleuze in seinem berühmten Interviewfilm L’Abécédaire über „Maladie“ – Krankheit – reden hören9 und über die „kleine Gesundheit“ der Philosophen reflektieren: Nietzsche, Spinoza. Ich wollte mir noch einmal die drei Gespräche mit Ärzten ansehen, die ich schon gemacht hatte, den Kontakt zu dem SPD-Gesundheitsexperten wieder aufnehmen, den ich bereits aufgenommen hatte – warum bin ich stecken geblieben? Gab es da eine Verzettelung, eine Angst vor zu viel Stoff, ein Stoffwirrwarr? War das Thema mir erstmal zu groß, erschlug es mich? Ach ja, ich wollte nicht mehr so anfangen – es erschien mir wie ein Klischee vom Dokumentartheater, ein Stück zum Gesundheitssystem machen zu wollen, zu den üblichen Missständen des neoliberalen Systems, zu Pharmalobbys und quälenden Zivilisationsschäden. Ich warte noch auf andere Eingänge oder andere Verbindungsgänge im Stoff, weil ich Eingänge schon viele besitze, zu viele. Nein, ich weiß, was mein Problem war: Die unterschiedlichen Eingänge haben sich nicht vernetzt, es fehlte das gemeinsame Kraftfeld, das einen zwingt, weiterzumachen. Halte ich etwa noch lose Fäden in der Hand? Irgendwann, so weiß ich, werden die sich verbinden, zusammenfinden zu einem Knoten, den ich literarisch lösen muss und den ich nur lösen kann, wenn ich mich traue.
Ein anderer Recherchefaden, der übrig geblieben ist, betrifft den Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Er hat sich aus meinem ersten Recherchegespräch zu Die Unvermeidlichen ergeben,10 meinem Stück über die Simultandolmetscher und die politische Klasse. Kurz nach dem sehr intensiven Gespräch mit der Dolmetscherin eines serbischen Kriegsverbrechers war mir klar, dass es sich nicht in jene Gespräche über G7-Konferenzen einfügen würde, die ich sonst vorhatte. Auch die Aussagen der Dolmetscherin, meiner zweiten Gesprächspartnerin, die für eine Wiener Hilfsorganisation tschetschenische Folteropfer in Psychotherapien dolmetscht, würde ich nicht unterbringen. Beide Gespräche hatten das Potential, Grundlage eines eigenen Stücks zu werden. Aber ich wollte kein Stück über den Jugoslawien-Krieg der 1990er Jahre und keines über Tschetschenien machen, insofern blieben sie liegen.
Oder: Was war das mit der Idee, ein Stück über zwei Anwälte des öffentlichen Rechts zu schreiben, die sich gegenseitig in einem Flughafenprojekt, z. B. in Frankfurt am Main, bekämpfen? Sie haben ihre Kanzleien am Münchner Prinzregentenplatz Tür an Tür, das ist tatsächlich so, denn ich bin dort gewesen und habe einen von ihnen getroffen. Ich habe die Leitzordner gesehen und weiß: Ihre Leitzordner hören sich gegenseitig durch die Wände zu, ihre Sekretärinnen treffen sich beim selben Mittagstisch – ja, wirklich! Sie selbst spüren die Erschütterungen des jeweiligen Kontrahenten, wenn dieser durch seinen Kanzleiflur geht oder gar einmal heftiger die Tür zuschlägt. Und es gibt mich, die ich dann ständig danebenstehen und ausrufen müsste: „Das ist so, ich habe es persönlich gesehen! Glaubt mir doch.“ Nein, wenn ich schon danebenstehen müsste, dann schon lieber in dem Stück über vier bärtige Fuzzis aus Karlsruhe, die Flughäfen berechnen können, also, wie viel die kosten, denn auch die gibt es wirklich. Fuzzis, die berechnen, ob das lukrativ ist. Ob es sich rechnet, einen Flughafen zu bauen, denn es ist nicht mehr so wie früher, als Flughäfen, Krankenhäuser, Schulen keinen Profit abwerfen mussten, weil sie Teil der öffentlichen Infrastruktur waren. Ein befreundeter Computernerd hat mir von ihnen erzählt. Nur was hilft mir all ihre Wirklichkeit? Skurrile Fundstücke aus der Wirklichkeit können oft erfundener aussehen als jegliche fiktiven Behauptungen, das ist jene merkwürdige Erfahrung, die jeder Schriftsteller und jede Schriftstellerin wohl immer wieder aufs Neue machen muss. Nein, dann schon lieber ein Stück über den Risikomanager, der in seinem großen Pianozimmer in einem der begüterten Vororte von Frankfurt – nennen wir ihn Königstein im Taunus – sitzt und über die Misswirtschaft in den Managementetagen, z. B. in Flughafenmanagementetagen, flucht. Also anders, als wir über die Misswirtschaft fluchen, macht er das konkreter, kennt die Umstände, Interessenlagen, insbesondere die der Vorstandsetage. Er weiß, wie Vorstände an Sesseln kleben, man kriegt sie ja gar nicht runter!
Sie werden es erraten haben: Auch den Risikomanager gibt es wirklich, der ist nicht einfach dahererfunden, aber er wirkt eben einen Tick weniger konstruiert. Zum Beispiel hat mir der Risikomanager einmal erzählt, wie 120 Programmierer jeder für sich in irgendeiner Bank saßen und jeder einzelne von ihnen auf eigene Faust ein bisschen an SAP herumgeprokelt hätte; das ist eine Vorstellung, die Betriebswirte in Angst und Schrecken versetzen kann, glauben Sie mir! Doch dann hat er plötzlich aufgehört zu reden.
Das heißt, einmal hätte er es mir beinahe mit schreckgeweiteten Augen in eine ZDF-Kamera erzählt, aber dann hat er plötzlich begonnen, schnell an der Kamera vorbeizureden: Er dürfe die Namen nicht nennen, die Firmennamen, er möchte offen reden, aber es sei kompliziert. Ich bräuchte keine Namen? Egal: Rückschlüsse wären möglich! Ähnlich wie bei Lobbyisten, Unternehmensberatern und Parlamentsmitarbeitern ist es auch mit Risikomanagern: Namensnennungen sind bei ihnen unbeliebt und immer sind Rückschlüsse möglich. Ich sei keine Journalistin? Egal: Kunst ist möglicherweise gefährlicher beziehungsweise unberechenbarer.
Immerhin hat er mich darauf aufmerksam gemacht, dass nicht mehr geredet wird. Sie reden nicht mehr, erzählen mir kurz darauf befreundete Dokumentarfilmemacher, die Menschen aus der Wirtschaft. Ob Google oder McKinsey, ob Nestlé oder Air Berlin, alles schweigt. Und immer größere Bereiche der gesellschaftlichen Organisation fallen unter die Schweigeklauseln, unter die Stillschweigeabkommen, die Verschwiegenheitsverpflichtungen. Das verhindert nicht nur Romane und Theaterstücke oder verändert sie. Das greift tief ein in den Journalismus, macht ganze gesellschaftliche Bereiche unsichtbar. Ja, neben all dem Gerede, der Selbstaussage, dem Drang zum Quatschen und Quasseln, Sichdarstellen, gibt es jede Menge Schweigen. Dort, wo es um was geht, wo gegenwärtige gesellschaftliche Konflikte, Widersprüche sichtbar werden könnten, wo man in einen Schuldzusammenhang verwickelt ist oder man sich schlicht und einfach in der Nähe der Mächtigen befindet, die es nicht nur nach wie vor, sondern heute umso mehr gibt. Wie erstaunlich ist da schon eine Produktion, die dieses Schweigegebot umgehen kann, z. B. Das Himbeerreich von Andres Veiel.11 Doch Abkommen mit Juristen, wie er sie bei der Fertigstellung des Stückes getroffen hat, für das er mit Ex-Bankern sprach, möchte ich nicht treffen. Deren Juristen hätten, so erzählte der Produktionsdramaturg Jörg Bochow beim vom Bayerischen Rundfunk und der Bayerischen Theaterakademie zusammengetrommelten Akademietag im Frühjahr 2013 im Münchner Prinzregententheater,12 den fertigen Text durchforstet, um ihre Klienten zu schützen. Was rausgefallen sei? Das Konkrete, sprechende Details, nicht unbedingt Identifizierungsdaten, nein, spezifische Angewohnheiten der Banker, die den Irrsinn des Ganzen zeigen könnten. Die stummen Allgemeinheiten sind immer erlaubt. Doch die stummen Allgemeinheiten interessieren nur, wenn man Samuel Beckett heißt, und das tut man nicht immer.
Nach den konkreten Vorhaben, überlege ich nun weiter, kommen dann die angefangenen und wieder fallen gelassenen Stücke. Das Stück über das Dienstleistungsprekariat in Hamburg, vom Thalia Theater in Auftrag gegeben, die mit Heinz Bude und seinem Institut zusammen ausgeklügelte Stück- und Symposiumsidee. Denn wer sieht sie noch, die Putzkolonnen oder die Mitarbeiter von Discountern? Unsichtbar sind sie, die Postdienstleister, die Briefzusteller, das Krankenhauspflegepersonal. Ist unsere Sicht auf private Pflegedienste, die Lebensmittelfachkräfte, Fleischindustrie vernebelt? Aufgegangen in RTL-Nebel und Sat1-Actuality-Dämpfen? Dann platzte das Vorhaben. Ein Dramaturgenwechsel am Thalia Theater fand statt, Carl Hegemann fand das Dienstleistungsprekariat, die Soziologen und die Autorin nicht prickelnd genug oder wollte lieber das Publikum entscheiden lassen,13 was gespielt wird. Schade, aber am Ende wäre es womöglich doch nur ein Stück über zwei Soziologen geworden, Mitarbeiter des Hamburger Instituts für Sozialforschung, die fröhlich versuchen, das Ganze nicht in der Bourdieu’schen Opferrhetorik darzustellen. Was ist das für eine Arroganz, hätten sie gerufen, die Leute andauernd nur als Opfer zu präsentieren, was ist das für eine verquere wehleidige Optik! In einem Affenzahn hätten sie sich gegenseitig versichert, wie Deutschland unter einem Bourdieuzwang stehe und man diesen Bourdieuzwang einmal abbauen müsse mit seinen Projektionen, seinen Vorverurteilungen der Menschen. Michel de Certeau, würden sie dann weiterreden, das wäre es viel eher, sie seien nämlich hinter ihnen her, den Finten, den Tricks und den Taktiken der Prekarisierten, wobei: Die dürfe man nicht verraten, denn dann hätten sich die Tricks, Finten und Taktiken schon wieder erledigt.14 In einem Affenzahn würde es weitergehen über Elend und Freude der Nähe zum Forschungsgegenstand, der sich nach und nach abgekoppelt habe vom gesellschaftlichen Rest. In einem Affenzahn: wie Freundschaften zu den Forschungsobjekten entstehen, wie sie Empathie entwickeln und doch weiterziehen müssen zum nächsten Forschungsgegenstand. Egal. Es gab diesen Dramaturgenwechsel, es gab im Winter 2012 meine Indienreise, auf der es mir absurd schien, die Nähe und Distanz zum Forschungsgegenstand in diesem Affenzahn mitzumachen. Es gab diese Geschwindigkeit, die das Ganze annehmen sollte, die Rasanz, die von diesem Theaterdruck, diesem Theaterproduktionsdruck herrührte, wie er nicht nur von vielen Kollegen wie Rimini Protokoll, Hans-Werner Kroesinger, aber auch René Pollesch oder Elfriede Jelinek vorgegeben wird, sondern auch von den großen Stadttheatern selbst, der mit dem Schreibprozess nicht gut zusammengeht. Und dann gab es noch das Tempo, das ich meinerseits rausnehmen wollte, denn bei all der Materialflut, die mich umspült, braucht es doch die literarische Durchdringung, die ästhetische Position, die ich einerseits entwickeln will und von der aus ich andererseits einsteige in die Arbeit.
Bin ich jetzt eben dabei, ein absurdes Alleinstellungsmerkmal aufzumachen? So in der Art: Ich kann nur langsamer! Dann sollte ich hier vielleicht wirklich ausschließlich über Märkte sprechen. Anscheinend komme ich ja aus dem Marktdenken nicht raus, es hält mich fest, das Messen und Vergleichen, der Druck, der mich zur ständigen Sichtbarkeit zwingt.
Freilich, dies ist nicht nur mein Problem: Andere Kollegen haben das erkannt und haben sich formiert: DramaTisch hieß ein Versuch, ein Zusammenschluss, der eine Zeit lang Manifeste und Erklärungen abgab und gegen die schlechten Arbeitsbedingungen und geringen Honorare protestierte.15 Doch was ist aus ihm geworden? War es nur der in diesem Fall abwegige Versuch einer Kartellbildung? Mist, schon wieder im Marktdenken gelandet! Sie sehen, aus dieser Marktumschlingung komme ich nicht raus. Dabei funktioniert Literatur ganz gewiss nicht nach dem Konkurrenz- und Effizienzprinzip, zumindest nicht alleine, sie folgt genauso gut der Logik der Gabe, des Potlatches und des Überflusses, sie ist ein Versuch der commons, des Gemeinschaftsbesitzes, der von der in dieser gesellschaftlichen Ordnung notwendigen, da verstehen Sie mich bitte nicht falsch, Urheberrechtsidee sowie von dem Geniegedanken oder dem bürgerlichen Subjektkonzept durchkreuzt wird. Mit dem radikalen Marktdenken kommt man da nicht weiter.
Aber auch mit der wirklichen Wirklichkeit komme ich nicht weiter. Das heißt, ich bin eine ganze Weile mit ihr weitergekommen, doch derzeit herrscht Wirklichkeitsstopp auf meinem Schreibtisch, eine Auszeit, da ist die Pausentaste gedrückt, bis ich wieder loslegen möchte, denn da war zu viel wirkliche Wirklichkeit in den letzten drei Jahren und zu wenig Zeit für ästhetische Gedanken, obwohl ich weiß, dass das nicht aufgeht. Nach über zehn Jahren intensivster Recherchetätigkeit fürs Theater ist doch längst klar: Ich brauche die Verzettelung in der Recherche, da komme ich nicht drumherum (warum wirken die Recherchen der anderen so viel unverzettelter?), ich brauche die Distanz zum Material, ich brauche Theorie und systemische Überlegungen sowie ästhetische Impulse, ich brauche mein Interesse, meine ästhetische Herkunft. Das bläst ein Vorhaben zeitlich unheimlich auf. Für den derzeitigen Theaterbetrieb ungeeignet, und so wurde es gerade bei der letzten Produktion, Der Lärmkrieg,16 verführerisch, gewisse Abkürzungen zu nehmen. Die Abkürzungen führten zu dem, was dann eben schnell Dokumentartheater genannt wird – wobei ich absolut kein Dokumentartheater machen möchte, nein, ganz und gar nicht, denn das erzeugt nur Missverständnisse – kurz: Es entstand ein Theaterabend, an dem das durchaus brisante Recherchematerial hörbar wurde, während die ästhetische Setzung eher im Hintergrund blieb.
Ich muss mich also wieder entkoppeln, muss einen Schritt raustreten aus diesem Theaterbetrieb, aus den Erwartungen, den plötzlich entstandenen. An mich selbst. Insofern Stopptaste, Pausenzeichen. Raustreten und mich vielleicht fragen, warum meine interessantesten Stücke auch Prosavorhaben sind oder an anderen Arbeiten dranhängen? Doch diese Frage, unterbreche ich mich selbst, ist strategisch zu Beginn einer Dramatikerpoetikvorlesung schlecht, man verabschiedet sich doch nicht gleich zu Beginn aus dem Theaterbetrieb, man zieht doch nicht gleich auf Seite 18 sich selbst in Zweifel, da ist es doch besser, mit der Liste des Ungeschriebenen weiterzumachen.
Insofern werde ich, überlege ich jetzt, schon vor dieser Ausführung innehalten, vor der Selbstreflexion meiner Indienreise, und vom Thalia Theater und dem ungeschriebenen Hamburgstück in eine andere gedankliche Richtung gehen, vielleicht weitermachen mit der Liste des Ungeschriebenen, die ja durchaus noch eine Fortsetzung verträgt. Vielleicht gehe ich sogar zwei Schritte zurück zu Claudia Lenssens Liste des Unverfilmten. Denn die sah 1983, das werden Sie sich schon gedacht haben, freilich ganz anders aus. Zunächst einmal war sie ein Forderungskatalog. Dieser roch zwar schon nicht mehr so ganz nach dem Utopischen, wie das ein paar Jahre zuvor der Fall gewesen wäre, doch selbst die Postpunk-, No-Future-Wirklichkeit hatte noch viel stärker den Wunsch nach Öffnung, nach Klärung der Widersprüche, nach Bewegung, nach Sichtbarmachung des Marginalisierten. Claudia Lenssen trug das, was fehlte, zusammen, verfasste diesen Forderungs- oder Bedürfniskatalog des Ästhetischen, erstellte einen Lückenapparat, der nicht sozialwissenschaftlichen Parametern folgte, sondern radikal subjektiv war und doch absolut nachvollziehbar, und sie richtete diesen Katalog an die deutsche Filmproduktion. Er ist sicherlich provokativ, ‚nicht ernst gemeint‘, könnte man sagen, wenn sie z. B. über das filmische Fehlen von „herzkranke[n] Polizeipräsidenten mit Söhnen in der Hausbesetzerszene, brotzeitfassende[n] Landwirtschaftsminister[n] auf der Alm, handstandgeübte[n] Grüne[n] in Sondierungsgesprächen mit SPD-Linken in Maßanzügen“ schreibt,17 sie scheint heute umgesetzt in vielem, doch meist nur als Zerrbild.
Man wollte sich damals um den Randkram kümmern, das Ambivalente, und obwohl man heute sich auf eine Weise immer noch um den Randkram und das Ambivalente kümmern muss, denn es ist heute nur in harmlosester Weise präsent, scheint mir in meiner eigenen Liste, als müsste ich mich hauptsächlich um die Sprache selbst kümmern, um Textformen, um die Organisation der literarischen Sprache für die Bühne, um die „Neuverteilung“ der Sprache im Text, wie Roland Barthes das einmal ausgedrückt hat.18 Denn Theatertexte zu schreiben ist nicht gerade das Avancierteste, was man derzeit machen kann, es sei denn, man inszeniert die Texte auch gleich selbst. Man schafft heute Spielanordnungen, lässt Menschen aus der „Realität“, sozusagen aus „Fleisch und Blut“ direkt zu Wort kommen, wie Rimini Protokoll das tun. Man improvisiert und performt, befragt und protokolliert oder nimmt sich, wenn schon Literatur, Dostojewski, Balzac, Houellebecq vor, am liebsten 700-Seiten-Wälzer, die man dann auf achtzig Seiten zusammenkürzt, als müsste man dem Text zu Leibe rücken, als wäre die Textvernichtung noch das Literarischste, das erlaubt ist. Es ist wie die Umkehrung des Heiner-Müller-Satzes „Literatur muss dem Theater Widerstand leisten.“19 Heute leistet das Theater der Literatur Widerstand oder es ignoriert diese. Das kann man alleine an den Inszenierungen des diesjährigen Theatertreffens sehen. Nicht nur am Erfolg von Herbert Fritschs Inszenierung Ohne Titel Nr. 1, die ganz ohne Sprache auskommt.20 Auch an gewisse Schweigeanwendungen, wie sie beispielsweise in der Onkel-Wanja-Inszenierung aus Stuttgart von Robert Borgmann vorkamen, in der immerhin ein beinahe zehnminütiger Schweigevorlauf vor den Text gesetzt wurde.21 Diese Schweigevorläufe und -umläufe gibt es derzeit viele, aber vielleicht sind diese auch gar nicht als gegen den Text gerichtet zu verstehen, sondern vielmehr als kleine Gesten, in denen Theater gegen das Redegebot antritt, das in unserer Gesellschaft genauso wie die Schweigeklauseln herrscht. Von diesem Redegebot haben mir die Simultandolmetscher in meiner Arbeit zu Die Unvermeidlichen erzählt. Es brachte sie in den Pausen ihrer Arbeit auf Konferenzen, in denen sie am liebsten schweigen wollten, aber nicht konnten, weil wir keine Konventionen des Schweigens zur Verfügung haben, dazu, oftmals Telefongespräche zu simulieren. „Ich geh mal kurz telefonieren!“, sagten sie und verschwanden in einem ruhigen Raum. Hat das Theater eine ähnliche Funktion? Immerhin zeigt es heute immer wieder Idyllen des Schweigens, spielt mit der Faszination und Sinnlichkeit der Stille miteinander.
Nein, das Theater simuliert heute keine Telefongespräche, es ruft vielmehr bei der Gegenwartsliteratur an und sagt: „Rufen Sie nicht uns an, wir rufen Sie an!“ Und legt dann auf. Oder redet von Projekten, die man gemeinsam machen könnte, so dokumentarisch. Projekte, die sich Dramaturgen zusammen mit einem Regisseur ausgedacht haben oder noch schlimmer: mit der Intendanz, und man castet einen Regisseur und danach einen Autor oder eine Autorin dazu. Wenn dafür noch ein Autor gebraucht wird, dann ist klar, er ist nicht mehr der Autor im eigentlichen Sinn. Das heißt, die Autorenfunktion übernehmen andere. Er oder sie sind bloß Dienstleister, die eher wie ein Dramaturg dem Team zuarbeiten und der Dramaturgie, den Schauspielern und dem Regisseur als Kontrollinstanzen unterworfen sind – „wir machen das mit permanenten Feedbackschleifen“, drückte das ein Regisseur kürzlich am Telefon aus. Der Text muss sich andauernd den Bedürfnissen des Teams anpassen, er muss der Kontrolle standhalten. Er muss flüssig bleiben, den permanenten Zugriff erlauben. Er muss schnell wachsen, darf sich keine Zeit nehmen. Das mag im Rahmen eines René-Pollesch-Kollektivs funktionieren, wenn Autor und Regisseur zusammenfallen und man in einem Team seit Langem gemeinsam arbeitet, aber nicht für Ad-hoc-Zusammenstellungen aus den Häusern heraus. Bei meinem kleinen Casting-Gespräch mit jenem Regisseur wurde mir klar, wie weit weg ich davon bin: Hier geht es nur darum, ein kleines Theaterereignis zu produzieren zu einem immerhin das Regieteam interessierenden Thema, das man mit einer Autorenfunktion an-ästhetisieren möchte – nein, ich spreche nicht von Anästhesie, aber bewege mich knapp daran vorbei …
Mir ist es nur recht, dass sich langsam die Gegenstimmen mehren. So stellte Frank M. Raddatz kürzlich in einem Essay zur Situation des Theaters, Erobert euer Grab!, fest, dass im derzeit so präsenten Performancetheater totale Gegenwart herrscht.22 Es kann und will nur zeitgleich mit sich selbst sein, ist reine Immanenz, da ragt nichts über es hinaus. Doch nicht nur der Utopieraum sei „implodiert“,23 auch die Totenbeschwörung ginge verloren. Weit weg sei Heiner Müllers Aussage, „Eine Funktion von Drama ist Totenbeschwörung – der Dialog mit den Toten darf nicht abreißen, bis sie herausgeben, was an Zukunft mit ihnen begraben worden ist.“24 Frank M. Raddatz beschreibt den Paradigmenwechsel, der nach einer Zeitenwende die „Negation von Zukunft als Zielkorridor gesellschaftlicher Praxis“ nach sich zog.25 Er verknüpft die Frage nach der Theatersprache, nach dem Text, mit der geschichtlichen Einspannung der Texte. Die literarische Sprache ist auch ein Speicher, sie kann erinnern, sie verweist auf Zukünftiges und Vergangenes. Die Negation der Sprache als ästhetische Gestaltungsmöglichkeit bedeutet, diese Funktion zu verlieren.
Das alltagssprachliche Downsizing ganzer Abende, die Inszenierung von ‚Authentizität‘, die Herstellung von Präsenzeffekten erzeuge dagegen vor allem das Gefühl, dabeizusein, man darf sich beim Wahrnehmen erleben, meint auch Bernd Stegemann in seiner kürzlich erschienenen Kritik des Theaters,26 die sich gegen die Vorherrschaft des zum Klischee geronnenen postdramatischen Paradigmas wendet, das Hans-Thies Lehmann vor fünfzehn Jahren ausgerufen hatte. Die damit einhergehende Vorherrschaft eines Präsenzstils nennt Thomas Oberender in der Zeit von Ende letzten Jahres fürchterlicherweise „die Kultur der Kreation“, was an eine Mischung aus Werbesprache und faschistoider Rhetorik anmutet.27 Er beschreibt sie folgendermaßen: