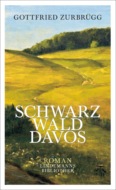Read the book: «tod.com»

Alle hier beschriebenen Personen und Ereignisse sind
erfunden. Eine Übereinstimmung mit der Wirklichkeit
wäre rein zufällig und unbeabsichtigt.
Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt,
dann reiß es aus und wirf es weg.
Matthäus 5,29
 Herbert Wetterauer, geb. 1957 in Karlsruhe, studierte Bildende Kunst und Germanistik. Lange Zeit lebte er als freischaffender Künstler und freier Journalist. Seit 1994 unterrichtet er im Lehramt Deutsch und Bildende Kunst. Weitere Veröffentlichungen: „Stromness“, „Du sollst nicht vertrauen“ und „Daneben – Geschichten aus der Nachbarschaft“.
Herbert Wetterauer, geb. 1957 in Karlsruhe, studierte Bildende Kunst und Germanistik. Lange Zeit lebte er als freischaffender Künstler und freier Journalist. Seit 1994 unterrichtet er im Lehramt Deutsch und Bildende Kunst. Weitere Veröffentlichungen: „Stromness“, „Du sollst nicht vertrauen“ und „Daneben – Geschichten aus der Nachbarschaft“.
Herbert Wetterauer
tod.com
Thriller

Prolog
Michelle sieht den Mann mit einer Plastiktüte in der einen und einer Kunststoffplane in der anderen Hand im dichten Gebüsch neben dem Wagen verschwinden. Sie ahnt, was er vorhat: Er wird die Plane auf dem Waldboden ausbreiten und irgendetwas aus der Plastiktüte nehmen und bereit legen. Er hat gesagt: Ich will den Wagen nicht schmutzig machen. Dann wird er zu ihr zurückkommen und die Handschellen aufschließen, mit der er sie an das Lenkrad gekettet hat. Er wird sie zu der Stelle bringen, die er im Gebüsch vorbereitet hat. Dann wird er sie töten, dort, an einem schönen, warmen und sonnigen Tag.
Sie hat geglaubt, den Mann zu kennen und zu lieben, soweit man einen Menschen kennen und lieben kann. Aber alles war nur eine Täuschung, eine Illusion, das erkennt sie jetzt. Er hat sie nie belogen, hat immer die Wahrheit gesagt. Sie selbst war es, die sich betrogen hat, die nicht glauben wollte.
Michelle erinnert sich: Irgendwo in einer Lagerhalle in Los Angeles kniet ein nacktes, gefesseltes Mädchen, angekettet an ein rostiges Wasserohr, auf dem schmutzigen Betonboden. Die sich hier im Halbdunkel der Halle im Licht einer einsam und schwach leuchtenden Glühbirne versammelt haben, wollen es sterben sehen, langsam und qualvoll. Sie haben sich verschworen unter dem Motto der Freiheit, der Lust, der Macht und der Erkenntnis. Sie werden den Vorgang des Tötens filmen, aber nicht um diesen Film zu verkaufen, sondern als ein Dokument der Macht. Jedes Mal, wenn sie sich diesen Film später ansehen werden, wird er sie an ihre Macht erinnern und an das Gefühl der Lust, sie auszuüben.
Aber nach und nach wird der Film seine Strahlkraft verlieren, werden sich seine Bilder als Wiederholung verbrauchen und wird das Bewusstsein der Macht verblassen.
Dann entsteht ein neuer Film ...
Omega
Max kam an diesem Mittag sichtlich begeistert von der Schule nach Hause. Das war eher selten der Fall und im Grunde gab es nur zwei Zustände, in denen er zum Mittagessen am Tisch erschien: entweder mürrisch und wortkarg oder gesprächig und aufgeregt. Mürrisch bedeutete in der Regel einen langweiligen Schultag oder das Schimpfen eines Lehrers, weil er seine Hausaufgaben wieder einmal nicht gemacht hatte. Vielleicht hatte er auch Streit mit einem Kumpel gehabt. Aufgeregt war er dann, wenn sich etwas Dramatisches ereignet hatte: Ein Lehrer war beleidigt worden und hatte dann das Ganze noch dadurch gekrönt, dass er die Beherrschung verloren hatte. Oder es hatte eine Schlägerei gegeben, bei der am besten auch noch ein Overhead-Projektor zu Bruch gegangen war. Sehr selten leitete sich seine Begeisterung vom Unterricht selbst ab, aber auch das konnte vorkommen, und so war es heute.
Während Michelle das Essen auf den Tisch stellte, Bratwürste mit Instant-Kartoffelbrei und Erbsen aus der Dose, berichtete Max aus seinem Deutschunterricht. Michelle kannte den Lehrer vom Elternabend her, als Max vor einem Jahr in die fünfte Klasse ans Gymnasium gewechselt war. Es war ein Herr in den späten Fünfzigern, graumeliert und schlank, der gerne redete und dabei wellenförmige Bewegungen mit seinen Händen machte, als ob er sich selbst dirigieren müsste. Häufig erzählte er den Schülern Geschichten aus seinem Leben oder ließ sie an seinem reichen Wissensschatz teilhaben, der aber meist nichts mit dem Fachgebiet Deutsch zu tun hatte. Michelle befürchtete manchmal, dass dabei der Unterrichtsstoff zu kurz kommen könnte, aber die Schüler mochten den Lehrer und seine Geschichten und Michelle war es auch recht, wenn Max beim Mittagessen gut gelaunt war. Für den Lehrer selbst hatte diese Methode des Unterrichtens offenbar den Vorteil, dass er sich nicht ständig vorbereiten musste, sondern frei assoziierend ins Weite schweifen konnte. Michelle hatte sich vorgenommen, ihm genau das zum Vorwurf zu machen, sollte er einmal auf die Idee kommen, sie wegen Max einzubestellen. Womit leider irgendwann zu rechnen war, denn sie wusste nicht immer, ob Max seine Hausaufgaben richtig oder vollständig oder überhaupt machte. Bisher waren seine Leistungen noch mittelmäßig gewesen, aber mittelmäßig am Gymnasium konnte auch sehr schnell den Absturz bedeuten. Wenn sie abends aus der Kanzlei nach Hause kam, saß Max am PC oder vor dem Fernseher und während sie das Abendessen vorbereitete, erkundigte sie sich auch danach, ob er seine Aufgaben erledigt hatte. Natürlich war das, seinen eigenen Angaben nach, auch immer der Fall, nur hatte sie abends nicht mehr die Kraft, das auch noch zu kontrollieren. Sie musste sich auf ihn verlassen und ihm vertrauen können. Und momentan bestand ja sowieso kein Handlungsbedarf.
Offenbar hatte der Deutschlehrer, hoffentlich wenigstens ausgehend von einer Lektüre oder Ähnlichem, den Kindern etwas von Geheimbünden und Verschwörungen erzählt. Max berichtete Michelle von den Freimaurern, die überall, auch in Karlsruhe, ihre geheimen Treffen veranstalteten, wobei niemand wirklich wüsste, welche Rituale dabei stattfinden würden. Sie taten so, als ob sie harmlos wären, tatsächlich aber wusste man nicht, wie weit ihre Macht gehen könnte. Immerhin hatten sie es geschafft, ihre Symbole auf dem Dollar abzubilden, eine Pyramide und ein allsehendes Auge. Der Deutschlehrer hatte auch angedeutet, dass die Pyramide auf dem Karlsruher Marktplatz möglicherweise nicht nur ein Stück Architektur sei, sondern dass vielleicht auch hier die Freimaurer ihre Finger im Spiel gehabt haben könnten. Max erzählte noch irgendetwas von Rosenkreuzern, den Illuminaten und dann (und hier fand Michelle, dass der Deutschlehrer nun doch eindeutig zu weit gegangen war) von einer Geheimloge P2, die ganz Italien regieren würde, im Geheimen natürlich, und die Kontakte hätte zur Mafia, zum Vatikan und zu den Faschisten. Was wusste ein Sechstklässler schon vom Vatikan, von der Mafia und erst recht von den Faschisten? Hier hatte der gute Mann sich gewaltig verstiegen und Michelle nahm sich vor, ihm auch das bei Gelegenheit zu sagen, eben wenn er auf die Idee kommen sollte, sie wegen Max einzubestellen. Sollten die Leistungen von Max einmal nachlassen, dann könnte es auch daran liegen, dass sehr häufig kein geordneter Unterricht mehr stattzufinden schien. Mit der Geschichte vom Vatikan und der Mafia hatte der Lehrer die Kinder eindeutig überfordert. Das ging nun doch schon in den politischen Bereich und außerdem klang es sehr nach Gerüchteküche und Hörensagen.
Aber Max war noch nicht am Ende. Die Krönung des Ganzen war in seinen Augen eine Organisation, von der man noch nicht einmal wusste, ob es sie tatsächlich gab. Der Lehrer hatte behauptet, sie hieße einfach Omega, und ihr Zeichen sei der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet und sehe so aus (Max zeichnete ein Ω in die Luft). Das sei nun tatsächlich so etwas wie eine geheime Weltregierung und gerade, dass man nicht einmal wüsste, ob sie tatsächlich existierte, zeige doch, wie mächtig sie sei. Das alles könne man übrigens auch bei Wikipedia nachlesen.
Der Gedanke an eine geheime Weltherrschaft hatte offenbar zumindest die Jungs in Max’ Klasse begeistert und Max selbst machte, als er davon erzählte, den Eindruck, als ob er ganz gerne Teil einer solchen Verschwörung wäre.
„Machen können, was man will, ohne dass einem was passieren kann! Geil!“
Michelle war nicht so begeistert, aber sie sagte nichts. Immerhin war Max ein Zwölfjähriger und hatte das Recht, sich für Abenteuer zu interessieren. Sie hätte sich aber gewünscht, dass ein Lehrer etwas seriöser mit Informationen umgegangen wäre, als es hier offenbar der Fall war. Es war schön, wenn es gelang, Schüler zu begeistern, aber bitte nicht auf Kosten des Unterrichts.
Von den Freimaurern und den Illuminaten hatte sie schon einmal etwas gehört, möglicherweise auch von P2 (war nicht ein italienischer Ministerpräsident im Ruf gestanden, Mitglied dieser Loge zu sein?).
Aber eine Organisation, die Omega heißen sollte, war ihr völlig unbekannt. Bei Gelegenheit würde sie einmal bei Wikipedia nachschauen.
Michelle
Michelle war vor drei Jahren von Frankfurt nach Karlsruhe gezogen, nachdem sie sich von Fred getrennt hatte, oder genauer gesagt: nachdem er sich von ihr getrennt hatte.
Sie hatte ihn vor dreizehn Jahren auf einer dieser Frankfurter Partys kennengelernt, wo sich Künstler, Börsianer oder Banker und Journalisten trafen. Fred arbeitete damals im mittleren Management einer großen Bank und war sich sicher, dass er aufsteigen würde. Und genau so war es dann auch gekommen. Seine saloppe Art, einen teuren Anzug zu tragen, mit weißem Hemd und offenem Kragen, hatte ihr gleich auf Anhieb gefallen. Er sah gut aus und als sie ihm zwei oder drei Blicke zugeworfen hatte, war er auf sie zugekommen.
Michelle arbeitete damals als Redakteurin und Sekretärin bei einem Börsenmagazin, obwohl sie kaum etwas von Finanzen verstand. Ihre Aufgabe war es, die sprachlich grausamen Texte in elegantes, lesbares Deutsch umzuformulieren und die reichlich vorhandenen Rechtschreibfehler zu eliminieren, zu denen die Finanzfachleute neigten. Das war alles, was von ihrem Germanistikstudium übrig geblieben war, aber sie konnte ganz gut davon leben.
Ihre Beziehung zu Fred war anfangs eher eine leidenschaftliche Affäre gewesen. Irgendwann hatte er vorgeschlagen, sie könne doch zu ihm ziehen. Ab da hatte ihre Beziehung festere Formen angenommen. Aber bald begann es auch zwischen ihnen zu kriseln. Im Grunde waren es die üblichen Streitereien um Alltägliches, kleine Machtkämpfe um die Vorherrschaft in der Beziehung. Oft endeten die Streitereien mit zugeschlagenen Türen und Fred schlief dann auf seinem Designer-Sofa, oder sie versöhnten sich, indem sie irgendwo in der Wohnung auf grobe Art Sex hatten.
Schließlich wurde Michelle schwanger. Fred war fassungslos; er hatte darauf vertraut, dass sie die Pille nehmen würde, wie sie vereinbart hatten. Aber an manchen Abenden oder in manchen Nächten, wenn sie mit Fred von einer der zahlreichen alkoholisierten Feiern nach Hause gekommen war, hatte sie es das eine oder andere Mal vergessen. Sie fragte sich später häufig, ob ihr Unterbewusstes ihr diesen Streich gespielt hatte, ob am Ende nicht ein heimlicher Kinderwunsch vorhanden gewesen war, der sich auf diese Art und Weise durchgesetzt hatte. Eigentlich hatte sie doch keine Kinder gewollt, oder? Auch ihre biologische Uhr hatte noch nicht zu ticken begonnen, immerhin war sie erst sechsundzwanzig Jahre alt. Sie kannte Frauen, die erst mit vierzig Jahren und mehr schwanger geworden waren und gesunde Kinder bekommen hatten. Aber manchmal hatte sie auf der Straße vielleicht etwas zu lange den Frauen mit Kinderwagen hinterhergesehen, zu lange sich am Anblick von Babys erfreut, wenn eine Mutter mit ihrem Kind im Park oder im Café neben ihr saß. Ob Fred der richtige Mann dafür wäre, hatte sie sich nie gefragt, denn die Frage nach einem Kind war nie zwischen ihnen im Raum gestanden und auch Michelle hatte sie sich nie bewusst gestellt.
Fred war nicht nur bestürzt, als sie ihm von der Schwangerschaft berichtete, sondern regelrecht verzweifelt. Dann fing er an zu toben. Das alles hatte sie seiner Meinung nach von langer Hand eingefädelt. Hatte sich einen gut verdienenden Typen gesucht und ihm dann ein Kind angedreht. Als ob er es nicht geahnt hätte! Es war zu gut gelaufen und jetzt das!
„Ich will kein Kind“, hatte er gebrüllt, „such dir einen anderen Deppen!“
Ihre Einwände, dass sie wirklich nichts dafür könne, dass es ein Versehen gewesen sei, ein Unfall quasi, von ihr nicht gewollt, ließ er nicht gelten. Sie hatte ihn, so sah er das, „über den Tisch gezogen“ und „eiskalt ausgetrickst“.
Schließlich versuchte er sie zu einer Abtreibung zu bewegen, aber sie hatte sich schon für das Kind entschieden. Nach und nach schien sich auch Fred an den Gedanken zu gewöhnen, Vater zu werden. Aber während Michelle einen unbändigen Appetit entwickelte und allmählich an Gewicht zunahm, wurde ihre ursprünglich leidenschaftliche Beziehung routiniert und bald auch lieblos. Fred blieb lange im Büro oder traf sich danach mit seinen Börsen-Kumpels in einer dieser Kneipen, wo er mit anderen Zockern ihre Tagesgewinne feierte oder den Frust über Verluste wegtrank.
Michelle durfte keinen Alkohol mehr trinken und Fred vermied es von da an, sich mit ihr auf Partys zu zeigen. Er fürchtete um sein Image des coolen Hundes. Michelle hatte ihn in seinen Augen und vor aller Welt an die Leine gelegt.
Sie war sich auch im Klaren darüber, dass er nie von sich aus das Thema Ehe ansprechen würde. Sie nicht zu heiraten würde seine Art sein, sich für den „Betrug“ zu rächen.
„Ich bin nicht für die Ehe gemacht“, hatte er früher einmal charmant lächelnd zu ihr gesagt.
Sie hatte das Thema von sich aus nicht mehr angeschnitten, auch dann nicht, als Max geboren war. Die ersten drei Jahre hatte sie den Mutterschutz beansprucht, dann hatte sie Max in einen Kinderhort gegeben und war wieder wie zuvor arbeiten gegangen. Am meisten schmerzte es sie, dass Fred offenbar nie eine wirkliche Beziehung zu Max entwickeln konnte. Er nahm ihn zwar auf den Arm, alberte mit ihm herum und manchmal schien auch so etwas wie Stolz oder Freude dabei im Spiel zu sein, aber Liebe war es wohl nie. Er hatte meist auch schnell genug davon und gab den Kleinen schleunigst wieder ab. Wenn Max schrie oder seine Aufmerksamkeit erforderte, wurde Fred bald ungeduldig und manchmal auch zornig. Seine bisherige Ruhe war nun ein für alle Mal gestört.
So lebten sie wie in einer ganz normalen Ehe. Sie brachten abwechselnd, je nachdem, wie es sich ergab, Max in den Kindergarten und später in den Hort. Aber auch darüber gab es immer wieder Streit: Wer hatte mehr Zeit dafür, mehr als der andere? Michelle besorgte auf dem Heimweg etwas für das kalte Abendessen und einmal in der Woche erschien eine Putzfrau. Mittags aßen sie getrennt: Fred in der Caféteria der Bank oder in einem Restaurant, Michelle im Büro und Max wurde im Hort versorgt. Gelegentlich luden sie am Wochenende Kollegen zum Essen ein oder wurden eingeladen. Wenn Fred abends zu Hause war, saß er oft in seinem Arbeitszimmer vor seinen drei Flachbildschirmen, die gleichzeitig eingeschaltet waren, einen Whisky in der Hand, und beobachtete irgendeine asiatische Börse. Anfangs leisteten sie sich noch gemeinsame teure Urlaube in der Karibik oder an der Côte d’Azur, später fuhr Michelle mit Max alleine weg, während Fred angeblich arbeitete. Es war ihr da aber auch schon egal, was er tatsächlich trieb. Gelegentlich hatten sie noch Sex miteinander, so wie man ein Wurstbrot isst, wenn man Hunger hat.
Als Max neun Jahre alt war, geschah das, womit Michelle schon eine Weile gerechnet hatte. Fred teilte ihr eines Tages mit, nachdem er während des Abendessens finster geschwiegen hatte, dass er eine andere Frau kennengelernt hatte. Ja, eine Kollegin, ja, auch eine etwas jüngere noch dazu, auch das, aber das tat nichts zur Sache. Er war bereit, Michelle die Wohnung zu überlassen, wenn sie es sich leisten könnte, aber er wusste sehr gut, dass sie das nicht konnte. Ein Anwalt, den sich Michelle daraufhin genommen hatte, informierte sie darüber, welchen Anspruch auf Unterhalt Max haben würde. Für sich würde sie selbst aufkommen müssen, aber das hatte sie auch bisher getan.
Fred hatte es anscheinend eilig, sie und Max loszuwerden, die Neue saß vielleicht schon auf gepackten Koffern und wartete darauf, einziehen zu können. Er hatte vor, ein neues Leben zu beginnen, und sie und Max waren nun einmal diesem Plan im Weg.
Da sie nie verheiratet waren und keine gemeinsamen Anschaffungen gemacht hatten, ging ihre Beziehung einfach so zu Ende. Fred formulierte es auf seine elegant prägnante Art so: „Ich denke, es ist das Beste, wenn wir unsere Beziehung langsam auslaufen lassen, was meinst du? Hast du schon einen Plan?“
Es war nicht der Verlust Freds, der Michelle bedrückte, sondern vielmehr das allgemeine Gefühl der Verlassenheit, das sich nach der Trennung einstellte. Seine Freunde waren auch ihre gewesen, und er würde es so oder so leichter haben als sie. Was das Finanzielle anging, hatte er ein höheres Einkommen und sie hatte sich, was die sozialen Kontakte anging, zu sehr auf ihn verlassen. Sie bezweifelte auch, dass er eine große Sehnsucht nach Max haben würde und wollte deshalb nicht, dass ein Kontakt zu ihm über das Notwendigste hinaus weiterhin bestehen würde. Deshalb beschloss sie, Frankfurt zu verlassen und nach Karlsruhe zu ziehen, wo sie studiert hatte und es noch flüchtige Kontakte gab, die sich vielleicht wiederbeleben ließen. Clara war eine gute Kommilitonin und Freundin während des Studiums gewesen; die würde sie demnächst einmal anrufen.
Karlsruhe
Als Michelle nach Karlsruhe gezogen war, hatte sie sich eine neue Stadtkarte und einen Fremdenführer gekauft. Natürlich konnte sie sich an vieles noch erinnern, aber sie wollte sich auf den neuesten Stand bringen. Allzu viel hatte sich aber seit ihrem Studium nicht verändert. Immerhin fand sie im Fremdenführer die interessante Information, dass Karlsruhe auch das eine oder andere Mal in der Weltliteratur Erwähnung gefunden hatte. Dostojewski erwähnte in „Dämonen“ ganz am Rande einen russischen Ingenieur, der in Karlsruhe studiert hatte (die Universität hatte also schon damals auf diesem Gebiet einen internationalen Ruf), Dino Buzatti nannte in seiner Geschichte „Orpheus und Eurydike“ Karlsruhe in einem Atemzug mit Mailand, und Goethe notierte in seinem Tagebuch, als er auf der Durchreise Karlsruhe besuchte, lapidar und vernichtend: „Man isst schlecht am Karlsruher Hof“.
Obwohl beinahe zehn Prozent der Karlsruher Einwohner Studenten waren, hatte die Stadt, besonders bei Zugezogenen, den Ruf einer langweiligen Beamtenstadt. Die Karlsruher waren auch nicht für ihre überschäumende Offenheit und Herzlichkeit bekannt, aber unter der manchmal etwas ruppigen Oberfläche waren sie durchaus lebenspraktisch und umgänglich.
Aber das war nicht alles. Die Stadt hatte ihre Vorzüge: einerseits großstädtisch, doch auch überschaubar. Das Elsass lag in unmittelbarer Nähe, man musste nur ein kleines Stück über den Rhein hinaus. Die Nähe Frankreichs hatte auf die Karlsruher abgefärbt: Man saß hier schon gerne zum Essen und Trinken im Freien, als das im Rest der Republik noch nicht in Mode war, und Muscheln, Schnecken und auch Froschschenkel waren hier schon früher auf die Speisekarten gekommen als anderswo. Der städtische Bereich mit seinem urbanen Charakter, mit den auch architektonisch interessanten Plätzen in der Innenstadt wurde ergänzt durch weitläufige Parks, Anlagen und Waldbestände nahe dem Stadtzentrum und große Naherholungsgebiete rings um die Stadt.
Noch schneller als im Elsass war man in der noch stark ländlich geprägten Pfalz, wo das kulinarische Angebot weniger ausgefeilt war als in Karlsruhe oder Frankreich. Hier dominierten noch einfache Schnitzel- und Bratengerichte. Zwar hatten die Pfälzer inzwischen Döner und Chinesisches vom Schnellimbiss in ihren Speiseplan integriert, aber auf die Idee, Schnecken oder Froschschenkel zu essen, waren sie bisher nicht gekommen. Selbst Innereien wie Nieren, Kutteln oder Bries waren den meisten ein Gräuel, dafür verarbeiteten sie die Schweineleber sehr gerne in ihrer rustikalen, berühmten Leberwurst. Aber anders als mit den Karlsruhern kam man mit den Pfälzern leicht ins Gespräch, wenn man auf einem der zahlreichen Dorf- oder Weinfeste mit ihnen an einem Tisch saß.
Die Karlsruher waren im Vergleich dazu zurückhaltend und blieben lange reserviert. Michelle hatte es erlebt, wie das Publikum in der Konzerthalle zwei Stunden lang der schwungvollen, mitreißenden Musik eines griechischen Sängers und seiner Gruppe zugehört hatte, stumm, regungslos und völlig starr, während die Künstler auf der Bühne ins Schwitzen gerieten. Aber als das Konzert zu Ende war, standen alle auf und es brach ein begeisterter Beifall aus. Natürlich gaben die Musiker eine Zugabe und noch eine und noch eine, und jetzt klatschten die Karlsruher mit, tanzten und sangen, jetzt, wo es eigentlich schon zu spät war. Michelle erschien dieses Verhalten typisch für den hier lebenden Menschenschlag.
Nachdem Michelle nach Karlsruhe gezogen war, hatte sie gelegentlich am Wochenende alleine einen Abstecher in die Stadt gemacht, um in irgendeiner Kneipe etwas zu trinken und vielleicht mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Hier in der Weststadt gab es zwar Lokale und Bars, aber es trafen sich dort meist Leute, die sich schon kannten. Sie hatte aber auch keine Lust auf den Ball der einsamen Herzen, auf diese speziellen Bars, in denen sich Menschen mittleren Alters aus nur einem Grund versammelten. Genauso ging es ihr mit den Partnerbörsen und Single-Foren im Internet. Hier erschien ihr alles zu eindeutig auf nur eine Problematik verengt und aufgesetzter Frohsinn und gespielte Coolness verdeckten nur unvollkommen die dahinter steckende Verzweiflung. Für Michelle war ohnehin nichts dabei gewesen. Männer, die sie hätten interessieren können, scheuten offenbar diesen Weg.
Sie war damals fünfunddreißig Jahre alt. Wenn sie an einen Mann dachte, den sie gerne kennenlernen würde, dann war dieser nur wenig älter als sie selbst oder könnte durchaus auch etwas jünger sein. Aber die Studentenkneipen in der Nähe der Uni, „Die Zwiebel“ oder „Der Sockenschuss“, enttäuschten sie. Hier saßen im holzgetäfelten Halbdunkel überwiegend junge Männer in T-Shirts, ausgeleierten Jeans und abgetretenen Sneakers, die Bier tranken und sich vor den wenigen anwesenden Frauen aufspielten. Es waren wohl angehende Bauingenieure, Chemiker, Informatiker oder Maschinenbauer, die sie wenig reizten. Unangenehm wurde es besonders dann, wenn eine Frau in ihrem Alter, vielleicht in gleicher Absicht wie sie, das Lokal betrat. Dass sie vom Alter nicht mehr hierher gehörten, wurde dann noch deutlicher. Natürlich wurden sie wahrgenommen, aber es schien ihr eine Mischung aus Unsicherheit und Häme zu sein, mit denen man sie betrachtete.
Michelle hatte keine Probleme mit ihrem Äußeren, zumindest nicht mehr als andere Frauen auch. Sie wusste, dass sie ganz gut aussah, sie wusste auch, dass sie für solche Lokale eigentlich schon etwas zu alt war. Aber die Typen, die hier herumsaßen, schützen sich mit diesen hämischen Blicken gegen ihre eigene Unsicherheit, gegen das Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit, der Unfähigkeit, mit einer Frau ihrer Klasse in Kontakt zu kommen.
Schließlich entdeckte Michelle das „Kap“ in der Kapellenstraße. Hier war das Publikum gemischt, auch Männer und Frauen ihres Alters standen neben jüngeren an der Theke oder saßen an einem der zahlreichen kleinen runden Tische. An den Wänden hingen Bilder von Künstlern, die Michelle nicht kannte, aber das Ganze hatte eine etwas gehobene Atmosphäre und sie sah interessante Typen und spannende Gesichter. Im hinteren Teil gab es sogar eine große Cocktailbar, aber die Theke vorne beim Eingang schien interessanter zu sein.
Als sie das erste Mal hier hereinkam, war es zwar schon 22.30 Uhr, aber offenbar noch zu früh. Das Lokal war nur zur Hälfte besetzt. Doch etwa eine halbe Stunde später strömten die Leute herein, die Musik wurde lauter und bald gab es keinen Sitzplatz mehr und kaum noch eine Gelegenheit, sich irgendwo hinzustellen. Michelle war froh, noch einen Platz an der Theke erwischt zu haben und nicht aus der zweiten oder dritten Reihe ihr Getränk bestellen zu müssen. Jetzt war es selbst aus dieser Position nicht einfach, die Thekenbedienungen, zwei junge Männer und eine Frau, auf sich aufmerksam zu machen. Einer der beiden Typen hatte aber offenbar ein Auge auf sie geworfen, und so musste sie nicht allzu lange warten. Er sah immer wieder zu ihr her und gab ihr einmal sogar einen Drink aus, doch gegen 1 Uhr erschien eine hübsche Blondine, ging ohne Weiteres hinter den Tresen und gab ihm demonstrativ einen Kuss. Diese Sache war also gelaufen, aber Michelle freute sich dennoch. Der Typ war attraktiv und sie kam offenbar immer noch ganz gut an.
Das „Kap“ gefiel ihr und sie kam von jetzt an gelegentlich samstagabends, wenn Max schon schlief oder schlafen sollte, hierher. Sie hatte ihm die Nummer gegeben und wusste, dass man im Lokal ihren Namen ausrufen würde, wenn Max anrufen sollte. Es kam hier ab und zu vor, dass das Telefon hinter der Theke klingelte und einer der Barkeeper es abhob, um dann mit hochgehaltenem Hörer ins Lokal zu brüllen: „Fritz, Fritz! Hier ist ein Anruf für Fritz!“, bis jemand von einem der Tischchen aufstand und sich hinter die Bar schlängelte.
Es gab eine Reihe von Stammgästen, die immer hier waren. Manchmal kam sie an der Theke auch mit jemandem ins Gespräch, aber ein regelmäßiger Kontakt, eine Art freundschaftlicher Beziehung ergab sich daraus nie. Man nickte sich zu, wenn man ein paarmal miteinander geredet hatte, aber alles blieb im Unverbindlichen und manchmal gingen auch Leute, mit denen sie schon ein ganz gutes Gespräch geführt hatte, grußlos und ohne mit der Wimper zu zucken an ihr vorbei. Man pflegte hier mitunter auch eine gewisse Coolness, aber Michelle kam damit klar. Sie war noch nicht verzweifelt, wie manche andere, die umso einsamer wirkten, je cooler sie sich gaben.
Es gab auch Begegnungen, die irritierend waren und nach denen Michelle eine Weile das Ausgehen vermied. So war sie einmal mit einem ganz gut aussehenden Typen ins Gespräch gekommen, der ihr gefiel und der sich auch für sie zu interessieren schien. Er erzählte zunächst von der Geschichte des „Kap“, wo er offenbar Stammgast war. Am Anfang sei hier noch sehr viel mehr losgewesen als jetzt, meinte er, bekannte Künstler und Professoren der Akademie hätten hier verkehrt, auch der weltberühmte Lüpertz sei regelmäßig mit seiner Bande aufgetaucht. Manchmal sei es so voll gewesen, dass die Bedienungen einfach nicht mehr abkassiert und betrunkene Gäste an die Theke gepinkelt hätten. Glorreiche Zeiten waren das gewesen. Er selber hatte Betriebswirtschaft studiert und arbeitete nun in einer Beratungsfirma. Betriebswirtschaft sei ein trockenes Thema, obwohl ...
Er hatte schon mindestens fünf oder sechs Pils getrunken, als er plötzlich seinen Kopf in die Hand stützte und Michelle mit großen Augen einen Moment lang anstarrte.
„Es gibt da Dinge, von denen man sich nicht träumen lässt“, meinte er. Wieder sah er sie erwartungsvoll an, die Augen weit aufgerissen und starr auf sie gerichtet.
Michelle musste innerlich lächeln. Er hatte ganz eindeutig einen zu viel auf die Lampe gegossen und jetzt entglitt ihm irgendwie die Konversation. Das neue Thema schien ihn brennend zu interessieren. Sie selbst war noch beinahe nüchtern (ein Orangensaft und zwei Wodka-Tonic, vielleicht auch drei). Sie sah ihn aufmerksam an und wartete ab.
„Ist dir schon einmal aufgefallen, wie hier in Karlsruhe die Ampeln geschaltet sind, hm?“, fragte er.
Meistens war Michelle mit dem Rad unterwegs, die Stadt war ideal dafür, nämlich eben und mit vielen Radwegen ausgestattet. Natürlich fuhr sie auch Auto, aber an den Ampeln war ihr noch nichts aufgefallen.
„Nee, wieso? Was soll mir da aufgefallen sein?“
„Natürlich, das springt einem nicht so ins Auge, soll es ja auch nicht. Das ist ganz raffiniert gemacht. Aber wenn du Bescheid weißt, dann ist es nicht schwer zu bemerken.“ Wieder starrte er sie an.
„Und was soll einem da auffallen?“
„Die Ampeln sind so geschaltet, dass die Autos ständig anhalten müssen. Es gibt praktisch keine grüne Welle. Da gibt es sogar einen alten Karlsruher Spruch: ‚Karlsruher originelle, immer rote Welle‘. Ständig stehst du an einer Ampel, und ständig musst du wieder anfahren.“
„Das ist doch überall so, das geht halt nicht anders. In Frankfurt ist es genauso.“
„Klar, das gilt nicht nur für Karlsruhe, das ist in allen Großstädten von Deutschland so, das ist auf der ganzen Welt so!“ Er nickte und sah sie wieder mit großen Augen an. Auf was wollte er hinaus?
„Ja, und was jetzt? Was soll das bedeuten?“
„Das kann ich dir erklären, es ist nämlich ganz einfach. – Noch ein Pils!“, rief er zum Barkeeper, dann wandte er sich wieder Michelle zu. Diesmal fasste seine Hand nach ihrem Unterarm und hielt ihn fest. „Wir alle glauben, dass es weltweit ein paar Mineralölfirmen gibt und noch viel mehr Reifenhersteller, weltweit. Aber das ist Quatsch. In Wirklichkeit gibt es da nur noch eine einzige große Firma, die sich zum Schein in viele kleinere unterteilt hat, die sie einmal aufgekauft hat. Das ist wie eine Weltregierung. Was das Öl und das Benzin kosten, wird da an einem Tisch festgelegt. Die sind weit über alle Regierungen hinaus, das ist nicht nur ein Trust, das ist vielmehr. Das ist globalisierter Faschismus. Die bestimmen alles, auch wie die Ampeln weltweit zu schalten sind. Nämlich so, dass die Autos möglichst oft anhalten und wieder anfahren müssen. So wird mehr Benzin verbraucht und die Reifen nutzen sich schneller ab. Das ist ganz einfach!“
Er war jetzt mit seinem Gesicht dem ihren ganz nahe gekommen, näher als ihr lieb war. Auch seine Hand wollte sie jetzt loswerden. Sie zog den Arm etwas zurück, aber er hielt ihn fest.
„Und das mit den Ampeln ist nicht die Hauptsache, das ist nur eine Sache von vielen. Dieser Konzern ist so groß, der hat noch nicht mal einen Namen, der steht in keinen Büchern. Natürlich zahlen die auch Steuern und so, aber eben über ihre Unterfirmen, die wir alle kennen, BP und Aral, Michelin und Goodyear und so: Alles das Gleiche! Wer Präsident in Amerika wird, bestimmen die. Die bezahlen den Wahlkampf von dem Typen, den sie haben wollen, den sie aufgestellt haben. Die kontrollieren alles, glaub mir!“