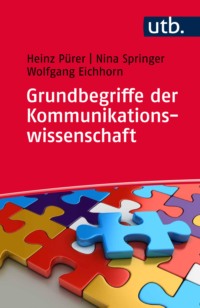Read the book: «Grundbegriffe der Kommunikationswissenschaft»
| utb 4298 |  |
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Böhlau Verlag • Wien • Köln • Weimar
Verlag Barbara Budrich • Opladen • Toronto
facultas • Wien
Wilhelm Fink • Paderborn
A. Francke Verlag • Tübingen
Haupt Verlag • Bern
Verlag Julius Klinkhardt • Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck • Tübingen
Nomos Verlagsgesellschaft • Baden-Baden
Ernst Reinhardt Verlag • München • Basel
Ferdinand Schöningh • Paderborn
Eugen Ulmer Verlag – Stuttgart
UVK Verlagsgesellschaft • Konstanz, mit UVK/Lucius • München
Vandenhoeck & Ruprecht • Göttingen • Bristol
Waxmann • Münster • New York
Heinz Pürer
Nina Springer
Wolfgang Eichhorn
Grundbegriffe der Kommunikationswissenschaft
UVKVerlagsgesellschft mbH • Konstanz mit UVK/Lucius • München
Prof. Dr. Heinz Pürer lehrte 1986-2012 Kommunikationswissenschaft an der Universität München. Dr. Nina Springer und Dr. Wolfgang Eichhorn sind dort wissenschaftliche Mitarbeiter.
Online-Angebote oder elektronische Ausgaben sind erhältlich unter www.utb-shop.de.
Im Buch werden nur die männlichen Formen verwendet. Selbstverständlich sind die weiblichen Formen jeweils mit gemeint.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz und München 2015
Einband: Atelier Reichert, Stuttgart
Einbandfoto: © goritza; Fotolia.com
Satz: Klose Textmanagement, Berlin
UVK Verlagsgesellschaft mbH
Schützenstr. 24 • D-78462 Konstanz
Tel.: 07531-9053-0 • Fax:07531-9053-98
UTB-Nr. 4298
ISBN 978-3-8252-4298-5 (print)
ISBN 978-3-8463-4298-5 (epub)
eBook-Herstellung und Auslieferung:
Brockhaus Commission, Kornwestheim
Inhalt
Vorwort
1 Einführung
2 Kommunikation (Heinz Pürer)
2.1 Unterscheidung von Kommunikation
2.2 Kommunikation, Interaktion, symbolische Interaktion
2.3 Kriterien von Kommunikation
2.4 Kommunikation – ein komplexer Prozess
2.5 Kommunikation – ein vermittelter Prozess
2.6 Die Kommunikations-»Kanäle«
2.7 Exkurs: Man kann nicht nicht kommunizieren
2.8 Sprache und Kommunikation
2.9 Arten von Kommunikation
3 Massenkommunikation (Heinz Pürer)
3.1 Schrift – Druck – Funk
3.2 »Massen«-Kommunikation
3.3 Massen-»Kommunikation«
3.4 Sender und Empfänger in der Massenkommunikation
3.5 Interpersonale Kommunikation und Massenkommunikation
3.6 Zur Terminologie in der Massenkommunikation
3.7 Massenkommunikation als gesamtgesellschaftliches Phänomen
4 Computervermittelte Kommunikation (Nina Springer, Heinz Pürer, Wolfgang Eichhorn)
4.1 Elektronisch mediatisierter Kommunikationsraum
4.2 Der Computer als Kommunikationsmedium
4.3 Interaktivität und computervermittelte Kommunikation
4.4 Web 2.0, Social Web und User-generated Content
4.5 Virtuelle Vergemeinschaftung
4.6 Neue Begriffe?
4.7 Neue Kompetenzen
Literatur
Index
Vorwort
Die Publizistik- und Kommunikationswissenschaft befasst sich als Sozialwissenschaft primär mit allen Formen öffentlicher Kommunikation, insbesondere mit klassischer Massenkommunikation (Print, Radio, Fernsehen) sowie mit öffentlicher und teil-öffentlicher Kommunikation in und mittels Onlinemedien. Im Zentrum des Lehr- und Forschungsfeldes stehen in Analogie zum Ablauf publizistischer bzw. massenkommunikativer Prozesse die Kommunikator-, die Aussagen-, die Medien(struktur)- sowie die Rezipienten- und Wirkungsforschung. Diesen Feldern kann man sich aus unterschiedlichen Fachperspektiven nähern – wie etwa der politologischen, psychologischen und soziologischen Perspektive. Zur Klärung offener wissenschaftlicher Fragestellungen bedient sich das Fach weitgehend sozialwissenschaftlich-empirischer Forschungstechniken.
In meinem 2003 erstmals publizierten sowie 2014 umfassend überarbeiteten und erweiterten Lehrbuch »Publizistik- und Kommunikationswissenschaft« habe ich versucht, das Lehr- und Forschungsfeld dieser Disziplin inhaltlich zu strukturieren und möglichst umfassend aufzubereiten und auch wichtige Grundbegriffe erörtert. Es erscheint nun – neu konfektioniert und leicht überarbeitet – auch in Teilbänden. Der vorliegende Band enthält, wie sein Titel sagt, »Grundbegriffe der Kommunikationswissenschaft«. Es sind dies die Begriffe Kommunikation, Massenkommunikation sowie computervermittelte Kommunikation. Letztere spielt seit etwa zwanzig Jahren im Fach eine zunehmend wichtige Rolle: Formen computervermittelter Kommunikation durchdringen seither in rapide wachsendem Maße zahlreiche Lebensbereiche, allen voran die Individual-, Gruppen- und Massenkommunikation.
Weitere Teilbände sind der Kommunikator- bzw. Journalismusforschung, der Medienforschung und den Medienstrukturen, der Rezipientenforschung (mit ihren Teilfeldern Mediennutzungs-, Medienrezeptions- und Medienwirkungsforschung) sowie der Kommunikationswissenschaft als interdisziplinäre Sozialwissenschaft gewidmet. Ebenso gibt es einen Band zu den quantitativen und qualitativen empirischen Forschungsmethoden. Die Bände erscheinen auch als E-Books. Mit diesem Publikationsprogramm sollen Interessenten angesprochen werden, die sich in ein Teilgebiet der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft vertiefen wollen.
Ich danke Nina Springer und Wolfgang Eichhorn für die Mitarbeit an dieser Publikation (Kap. 4) und Rüdiger Steiner, dem Verlagslektor von UVK, für die gute Zusammenarbeit bei der Entstehung des vorliegenden Buches.
| München, im April 2015 | Heinz Pürer |
1 Einführung
Auch die Kommunikationswissenschaft kommt ohne eigenes Begriffsinventar nicht aus. Zwar sind viele ihrer Begriffe der Alltagssprache entnommen oder umgekehrt aus dem Fach in die Alltagssprache eingeflossen. Gleichwohl bedient sich die Disziplin oftmals einer Fachsprache, die für Fachfremde mitunter nicht gleich verständlich ist. Dies gilt übrigens auch für die Begrifflichkeit zahlreicher Berufe. Welcher Durchschnittsbürger weiß schon, was im grafischen Gewerbe mit »Hurenkind« gemeint ist, was in der Medizin »intubieren« heißt, was im Tunnelbau der »Kalottenvortrieb« ist oder in der Luftfahrt »abschmieren« bedeutet?
Fachbegriffe stellen folglich nichts anderes als Verallgemeinerungen konkreter Phänomene dar. Ihre Funktion besteht darin, v. a. komplexe Sachverhalte nach Möglichkeit vereinfacht – jedoch möglichst nicht verkürzt – zu beschreiben. Daher zeichnet sich die Fach- oder Wissenschaftssprache durch genau definierte Begriffe oder, wo kompakte Definitionen nicht möglich sind, zumindest durch konkrete Begriffsbeschreibungen aus. Es liegt auch im Wesen der Wissenschaft, dass ständig neue Fachbegriffe »generiert«, d. h. aus neuen Erkenntnissen hergeleitet, entwickelt und gebildet werden. Dabei kommt es oftmals zu Fremdwortbildungen und zu Übernahmen aus dem Englischen bzw. Amerikanischen, »zumal ein großer Teil der kommunikationswissenschaftlichen Fachliteratur aus diesem Sprachraum stammt und die internationale Wissenschaftskommunikation (Kongresse und Fachzeitschriften) zur Verbreitung dieser Fachsprache erheblich beigetragen hat« (Bentele/Beck 1994, S. 16). Auch ist nicht zu übersehen, dass die Kommunikationswissenschaft Begriffe aus anderen Fächern, v. a. aus sozialwissenschaftlichen Disziplinen wie der Soziologie, der Psychologie, der Politikwissenschaft, der (Sozio-)Linguistik oder den Wirtschaftswissenschaften und der Informatik entlehnt bzw. übernimmt.
Es ist nicht möglich, nachfolgend alle Fachbegriffe der Kommunikationswissenschaft detailliert aufzuführen und inhaltlich zu klären (schließlich soll hier kein Fachwörterbuch der Kommunikationswissenschaft geschrieben werden). Vielmehr seien einige zentrale Begriffe herausgehoben, deren Kenntnis für das Verständnis des Fachgegenstandes wichtig sind, zumal schon die Fachbezeichnung »Kommunikationswissenschaft« nicht selten zu Missverständnissen führen kann. Als derart zentrale Begriffe erweisen sich die Termini Kommunikation‚ Publizistik‚ (klassische) Massenkommunikation sowie computervermittelte Kommunikation. Dem interdisziplinären Charakter des Faches folgend werden dabei neben kommunikationswissenschaftlichen Aspekten auch soziologische, psychologische sowie teils auch (sozio-)linguistische Aspekte angesprochen.
2 Kommunikation
Kommunikation ist ein sowohl fach- wie auch alltagssprachlich verwendeter Begriff mit zahlreichen Bedeutungsgehalten. Bezogen auf soziale, also gesellschaftliche Kommunikation ist er im deutschen Sprachraum über den Begriff Massenkommunikation »bekannt, ja modisch geworden« (Merten 1977, S. 141). Massenkommunikation wiederum ist die in den 1960er-Jahren aus dem Amerikanischen übernommene Bezeichnung für mass communication. Zweifellos erfuhr der in jüngerer Zeit inflationär verwendete Begriff Kommunikation seine inhaltliche Prägung durch die Kommunikationswissenschaft. Für die deutschsprachige Kommunikationswissenschaft ist von der Übernahme der beiden aus dem Amerikanischen stammenden Begriffe der Impuls ausgegangen, sich neben medienvermittelter Kommunikation auch mit dem komplexen Phänomen zwischenmenschlicher Kommunikation zu befassen.
2.1 Unterscheidung von Kommunikation
In einer bereits 1977 durchgeführten Analyse von 160 Begriffsbestimmungen über Kommunikation nahm der Münsteraner Kommunikationswissenschaftler Klaus Merten u. a. eine hierarchische Unterscheidung von Kommunikation vor. Dabei differenzierte er u. a. zwischen subanimalischer, animalischer, Human- und Massenkommunikation (Merten 1977, S. 94ff):
Mit subanimalischer Kommunikation ist vor allem Kommunikation zwischen Organismen gemeint (vgl. Merten 1977, S. 94). Aber auch technische oder naturwissenschaftliche Erscheinungen von Kommunikation wie etwa die reziproke Einwirkung zweier magnetischer Substanzen aufeinander oder die Entstehung einer Verbindung aus zwei Molekülen können erwähnt werden (vgl. ebd.).
Animalische Kommunikation meint Kommunikation zwischen/unter Lebewesen, die je nach Level ihrer Evolution unterschiedlich entwickelt und leistungsfähig ist (taktiler, akustisch-vokaler, visueller etc. Wahrnehmungskanal) (vgl. Merten 1977, S. 98ff).
Mit der Bezeichnung Humankommunikation ist ausschließlich Kommunikation unter Menschen angesprochen. Ihr besonderes Kennzeichen ist die Verfügbarkeit eines sprachlichen Kanals über und neben anderen – nonverbalen – Kommunikationskanälen (vgl. Merten 1977, S. 118).
(Klassische) Massenkommunikation ist eine (Sonder-) Form technisch vermittelter (Human-) Kommunikation, ein System, in welchem Aussagen organisational von »organisierten Kommunikatoren« hergestellt und publiziert und von einer »anonymen Zahl anonymer Rezipienten rezipiert« werden (vgl. weiterführend Merten 1977, S. 150; Maletzke (1963) spricht vom ›dispersen Publikum‹ – vgl. Kap 3).
Zu ergänzen ist diese Systematisierung um die
Computervermittelte Kommunikation: Dabei handelt es sich um einen aus der Multimedia-Kommunikation hergeleiteten Begriff. Gemeint sind neue Kommunikationsformen, die durch das Verschmelzen von Telekommunikation, Computerisierung und herkömmlichen elektronischen Massenmedien möglich geworden sind. Sie integriert elektronisch vermittelte Individual-, Gruppen- und Massenkommunikation (vgl. Kap. 4).
Summa summarum kann man der hier dargestellten Differenzierung zufolge zwischen Kommunikation im weiteren sowie im engeren Sinne unterscheiden. Kommunikation im weiteren Sinne meint alle Prozesse der Informationsübertragung und bezieht technische, biologische, psychische, physische und soziale Informationsvermittlungssysteme ein. Unter Kommunikation im engeren Sinn versteht man einen Vorgang der Verständigung und der Bedeutungsvermittlung zwischen Lebewesen (vgl. Maletzke 1963, S. 16). Kommunikation zwischen Menschen schließlich stellt – soziologisch betrachtet – eine Form sozialen Handelns dar, das mit subjektivem Sinn verbunden sowie auf das Denken, Fühlen und Handeln anderer Menschen bezogen ist (vgl. Weber 1980, S. 1, 11).
2.2 Kommunikation, Interaktion, symbolische Interaktion
Der Gedanke, wonach soziales Handeln »mit subjektivem Sinn« verbunden sowie »auf das Verhalten anderer Menschen bezogen und daran in seinem Ablauf orientiert ist«, geht auf den Soziologen Max Weber zurück (Weber 1980, S. 1). Wenn zwei oder mehr Personen sich »in ihrem gegenseitigen Verhalten aneinander orientieren und sich auch gegenseitig wahrnehmen können« (Jäckel 1995, S. 463), wird dies als Interaktion bezeichnet (ebd.). Interaktion ist also gekennzeichnet durch »Prozesse der Wechselbeziehung bzw. Wechselwirkung« (Burkart 1998, S. 30). Demgemäß soll in Anlehnung an Roland Burkart unter sozialer Interaktion ein wechselseitiges Geschehen zwischen zwei oder mehr Personen verstanden werden, »welches mit einer Kontaktaufnahme […] beginnt und zu (Re-)Aktionen der im Kontakt stehenden Lebewesen führt« (Burkart 1998, S. 30). Kommunikation kann somit als eine »spezifische Form der sozialen Interaktion« verstanden werden (Graumann 1972, S. 1110; vgl. auch Burkart 1998, S. 30; Kunczik/Zipfel 2005, S. 26–30), zumal zwischenmenschliche Kommunikation sich in aller Regel auch durch Wechselseitigkeit auszeichnet.
Die Begriffe Kommunikation und Interaktion werden gelegentlich auch synonym verwendet. Dies ist nicht uneingeschränkt zulässig, sondern bedarf einer Differenzierung: Zweifellos stehen die Begriffe Kommunikation und Interaktion zueinander in Beziehung. Mit Kommunikation ist von der Wortbedeutung her jedoch eher Verständigung und sind damit in erster Linie inhaltliche Bedeutungsprozesse gemeint (vgl. Maletzke 1998, S. 43). Interaktion hingegen meint den Charakter und Handlungsablauf sozialer Beziehungen (Jäckel 1995, S. 463; vgl. Graumann 1972, S. 1110ff). Wenn Interaktion folglich als Synonym für soziales Handeln steht, kann Kommunikation als Interaktion vermittels Zeichen bzw. Symbolen bezeichnet werden (vgl. w. u. S. 57).
Versucht man folglich, eine Definition für interaktive, zwischenmenschliche Kommunikation zu finden, die sowohl den formalen Charakter sozialer Beziehungen als auch das Merkmal der Verständigung in sich vereinigt, so kann man Kommunikation definieren als verbales und/oder nonverbales Miteinander-in-Beziehung-Treten von Menschen (Interaktion) zum Austausch von Informationen (Kommunikation).
Kommunikation wurde soeben als Interaktion vermittels Zeichen bzw. Symbolen erklärt. Darin klingt die Theorie der Symbolischen Interaktion an, die zuerst mit den Namen George H. Mead (Mead 2008/1934) sowie Herbert Blumer (1973) verbunden war. Sie »geht davon aus, dass der Mensch nicht nur in einer natürlichen, sondern auch in einer symbolischen Umwelt lebt […] und begreift ihn demgemäß als ein Wesen, das den Dingen seiner Umgebung Bedeutungen zuschreibt. Die Kategorie ›Bedeutung‹ kennzeichnet denn auch zentral symbolisch-interaktionistisches Denken« (Burkart 2002, S. 432, mit Bezugnahme auf Rose 1967; Hervorhebung i. Orig.). Auf folgenden Annahmen bzw. Prämissen basiert die Theorie (vgl. Blumer 1992):
1) Menschen handeln gegenüber »Dingen« (Gegenständen, Personen, Ereignissen etc.) auf der »Grundlage von Bedeutungen […], die diese Dinge für sie besitzen« (Blumer 1992, S. 23).
2) Die Bedeutung solcher Dinge ist abgeleitet oder entsteht »aus der sozialen Interaktion, die man mit seinen Mitmenschen eingeht« (Blumer 1992, S. 24).
3) Diese Bedeutungen werden »in einem interpretativen Prozess, den die Person in ihrer Auseinandersetzung mit den ihr begegnenden Dingen benutzt, gehandhabt und abgeändert« (ebd.). Bedeutungen stellen »keine stabilen Größen« dar, sie können geändert werden und auch mehrdeutig sein (Burkart 2002, S. 435; vgl. Winter 2010, S. 79). Kommunikation erscheint somit »als ein Prozess, in dem Menschen mit Hilfe von Symbolen (verbaler und nonverbaler Natur) einander wechselseitig Bedeutungen ins Bewusstsein rufen« (Burkart 2002, S. 433). Sprache, die ihr innewohnenden Zeichen bzw. Symbole, paraverbale und nonverbale Elemente sowie auch Blickkontakt, Mimik, Gesten und raumbezogenes Verhalten zweier oder mehr Kommunizierender stellen daher ein wichtiges Symbolsystem dar. Es kommt auch in der Massenkommunikation sowie in der computervermittelten Kommunikation zum Tragen (vgl. Burkart 2002, S. 435). Einen kompakten Überblick über relevante Aspekte von symbolischer Interaktion vermittelt Herbert Blumer (2013).
2.3 Kriterien von Kommunikation
Zwischenmenschliche, interaktive Kommunikation besteht (in einer vereinfachten Darstellung) aus mindestens vier Elementen, nämlich: einem Sender (Kommunikator), einem Kommunikationsinhalt (Aussage, Botschaft, Bedeutung) einem Kanal, über den der Inhalt vermittelt wird (Medium; in der zwischenmenschlichen Kommunikation, v. a. Sprache) sowie einem Empfänger (Rezipient). Der Kommunikationsvorgang läuft so ab, dass der Sender (Kommunikator) eine Botschaft verschlüsselt (encodiert), sprachlich an den Kommunikationspartner übermittelt und der Empfänger (Rezipient) die übermittelte Botschaft erfasst und entschlüsselt (decodiert) (vgl. w.u.). Der Vorgang bzw. Prozess ist in mehreren Kommunikationsmodellen dargestellt (vgl. z. B. McQuail/Windahl 1994; Bentele/Beck 1994, S. 21–25; Kunczik/Zipfel 2005, S. 41–47; Stöber 2008, S. 16–27; Beck 2013).
In der bereits erwähnten Analyse von Begriffen über Kommunikation, in denen Interaktion »den höchsten Rang einnimmt« (Merten 1977, S. 74), versuchte Merten, systematisch Kriterien für interaktive Kommunikation zu ergründen. Als solche ermittelte er Reziprozität (simultane Wechselseitigkeit der Rollenwahrnehmung der Kommunikationspartner), Intentionalität (Absichtshaftigkeit des Kommunikators), Anwesenheit (gegenseitige Wahrnehmbarkeit der Kommunikationspartner), Sprachlichkeit (verbal, nonverbal), Wirkung (Folgen; schwer ermittelbar) sowie Reflexivität (Rückbezüglichkeit) (vgl. Merten 1977, S. 70ff). Sie sind dem Autor zufolge nur teils von Relevanz (vgl. Merten 1977, S. 75–89). Das wichtigste Kriterium sieht er in der Reflexivität (vgl. Merten 1977, S. 86ff). Diese bezieht sich auf die Kommunikationspartner. Merten unterscheidet zwischen Reflexivität in der Zeit-, Sach- sowie Sozialdimension (Merten 1977, S. 86–8 sowie S. 161f). Reflexivität in der zeitlichen Dimension meint die Rückwirkung der Folgen von Kommunikation auf den Kommunikationsprozess selbst (vgl. Merten 1977, S. 161). Reflexivität in der sachlichen Dimension meint, »dass Kommunikation jeweils mit dem Code […] operieren kann, der dem sachlichen Anliegen am angemessensten ist« (Kübler 1994, S. 18 mit Bezugnahme auf Merten). Kommunikation rekurriert auf bewusstseinsmäßige Vorleistungen, kann Informationen auswählen, aufeinander beziehen, »Traditionen bilden und an Sinnstrukturen anknüpfen« (ebd.). Reflexivität in der sozialen Dimension bedeutet, »dass Kommunikation Individuen verbindet, Sozialität stiftet, kognitive Leistungen wie Wahrnehmen, Erwarten und Handeln verlangt bzw. erzeugt und damit letztlich menschliche Identität konstituiert« (ebd.). Merten erarbeitete seine differenziert aufbereite Begriffsanalyse auf Basis eines systemtheoretischen Verständnisses von Kommunikation. Für ihn kann interaktiv geführte Kommunikation auf Humanebene »als kleines, flüchtiges soziales System« gesehen werden, zugleich mögliche »Keimzelle für alle soziale Evolution […]: Kommunikation auf der Humanebene ist das kleinste soziale System mit zeitlich-sachlich-sozialer Reflexivität« (Merten 1977, S. 162, Hervorhebung i. Orig.).
Kommunikation ist durch ein Mindestmaß an Verständigung, an Gemeinsamkeiten der Gedanken oder Absichten zwischen Sender und Empfänger gekennzeichnet. Verständigung liegt vor, »wenn der Rezipient eine ihm mitgeteilte Aussage so versteht, wie sie vom Kommunikator gemeint ist« (Burkart 1998, S. 75). Dazu bedarf es eines gemeinsamen, übereinstimmenden Symbol- bzw. Zeichenvorrates. Ein solcher liegt vor, wenn die Kommunikationspartner nicht nur die gleiche Sprache sprechen, sondern auch über ähnliche oder gleiche Interessen und Erfahrungen verfügen.
2.4 Kommunikation – ein komplexer Prozess
Der uns so selbstverständlich erscheinende Vorgang von Kommunikation als Prozess ist kein Vorgang, der kausal einfach zu erfassen ist (Merten 1977, S. 53). Vielmehr stellt Kommunikation einen komplexen Sachverhalt dar, in dessen Verlauf Rücksteuerungen und Rückkopplungen sowie ein- und gegenseitige Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den Kommunizierenden eine Rolle spielen. Bei Kommunikation bzw. kommunikativem Handeln wird seitens der Kommunikationspartner Sinn konstruiert, werden Information generiert und ausgetauscht. Außerdem kommen auch subjektive Auswahl- bzw. Selektionsprozesse der Kommunikationspartner zum Tragen (vgl. Bentele/Beck 1994, S. 32). In der zwischenmenschlichen Kommunikation von Angesicht zu Angesicht (face to face) nehmen die Kommunizierenden abwechselnd die Rolle von Sender und Empfänger, von Kommunikator und Rezipient ein. Dies erfolgt oft »in so rascher Folge und mit Überschneidungen, dass man von einer gewissen Koinzidenz beider Rollen bei beiden Partnern ausgehen kann« (Schulz 1994, S. 147). Dabei handelt es sich weniger um eine Übertragung als vielmehr um einen Austausch von Information.
Dieser Austausch von Information bedient sich sprachlicher (verbaler) wie nichtsprachlicher (nonverbaler) Kommunikationsformen. Das Sprachliche manifestiert sich – übrigens in Spreche wie in Schreibe – im Gebrauch von Zeichen bzw. Symbolen. Bei gesprochener Sprache kommen paraverbale Merkmale wie Stimmqualität, Tonfall, Lautstärke, Stimmmelodie, Sprechpausen, dialektische Färbung u.a.m. hinzu. Bei geschriebener Sprache, z.B. im Brief oder auch bei gedruckten Medien, spielen (qualitativ-) formale Merkmale wie Schriftcharakter und Schriftbild eine Rolle. Allen diesen Merkmalen kann der Empfänger Informationen über den Sender entnehmen.
Nonverbale Kommunikation bezeichnet »Formen des menschlichen Elementarkontaktes außerhalb der Sprache« (Beth/Pross 1976, S. 93). Diese nichtsprachliche Kommunikation findet ihren Ausdruck in zahlreichen – (quasi-)formalen – Manifestationen wie Mimik, Gestik, Körperhaltung, Blickkontakt, raumbezogenem Verhalten (räumliche Distanz der Kommunizierenden) etc.; sie werden vorwiegend über den optischen bzw. visuellen Kanal wahrgenommen. Nonverbale Kommunikationselemente sind aber auch in Mitteilungen zu sehen, die durch Geruch, Geschmack, Berührungen und Wärmeempfindungen vermittelt und wahrgenommen werden. Insgesamt kann man also unterscheiden zwischen sprachunabhängigen und sprachabhängigen nonverbalen Elementen (vgl. Kübler 1994, S. 24). Einen Sonderfall stellt die Sprache der (Taub-)Stummen bzw. Gehörlosen dar, die vorwiegend mit Mimik, Gestik und Gebärden operiert. Diese Sprache stellt in Form der Deutschen Gebärdensprache (DGS) übrigens ein eigenes, staatlich anerkanntes Sprachsystem dar. (In manchen Fernsehnachrichtensendungen – leider in viel zu wenigen – werden Personen eingeblendet bzw. gezeigt, die gehörlosen Zusehern das Gesprochene in die Sprache der Gehörlosen übersetzen).
Mit Blick auf verbale und nonverbale Kommunikation ist zu erwähnen, dass nonverbale Kommunikation durch die verbale nicht abgelöst wird. Vielmehr ergänzen sich die Kanäle »komplementär zu einer wirksamen Struktur, die in der Bezogenheit aufeinander Leistungen ermöglicht, die keiner der Kanäle allein erbringen könnte« (Merten 1977, S. 82). Es ist jedoch unbestritten, dass jede leistungsfähige Kommunikation, die erinnerbar, multiplizierbar oder zurechenbar sein will, auf Sprache (in gesprochener oder geschriebener Form) aufbaut (vgl. ebd.). Im Unterschied zu nonverbaler Kommunikation befähigt Sprache zur Kommunikation über Personen, Dinge und Gegenstände sowie Sachverhalte »unabhängig von ihrer raum-zeitlichen Gegenwart« (Bergler/Six 1979, S. 27). Dies gilt übrigens auch für einen beträchtlichen Teil der Kommunikation von Blinden bzw. Nichtsehenden. Für sie muss geschriebene Sprache freilich in einen eigenen materiellen Code transformiert werden, dessen Dekodierung über den Tastsinn erfolgt.
2.5 Kommunikation – ein vermittelter Prozess
In der Kommunikationswissenschaft versteht man unter zwischenmenschlicher Kommunikation den sich der Sprachen, Zeichen und Symbole bedienenden Austausch von Bedeutungsgehalten zwischen zwei oder mehreren Personen, der auch nichtsprachliche Elemente enthält. Wenn wir uns zum Kommunizieren also z. B. der gesprochenen Sprache bedienen, so ist damit ausgesagt, dass alle menschliche Kommunikation – auch jene von Angesicht zu Angesicht – vermittelt ist. Kommunikation bedarf folglich immer einer Instanz, eines Mittels oder Mediums, mit dessen Hilfe eine Botschaft generiert bzw. artikuliert und »durch das hindurch eine Nachricht übertragen bzw. aufgenommen wird« (Graumann 1972, S. 1182). Der Begriff »Medium« steht daher »sowohl für personale (der menschlichen Person ›anhaftende‹) Vermittlungsinstanzen als auch für jene technischen Hilfsmittel zur Übertragung einer Botschaft« (Burkart 1998, S. 36)‚ wie wir sie aus Telekommunikation (Telefon, Sprechfunk, Fax etc.), Massenkommunikation (Zeitung, Zeitschrift, Radio, Fernsehen) sowie auch aus der computervermittelten Kommunikation (E-Mail, Foren, neue soziale Medien und Netzwerke) kennen.
Menschliche Kommunikation zeichnet sich also durch eine Vielfalt immaterieller wie materieller Vermittlungsformen und -möglichkeiten aus. Von Harry Pross stammt der 1972 unternommene Versuch, diese Vielfalt zu differenzieren. Er unterscheidet zwischen primären, sekundären und tertiären Medien (Pross 1972, S. 10ff):
Primäre Medien sind demzufolge die Medien des »menschlichen Elementarkontaktes«. Dazu gehören die Sprache sowie nichtsprachliche Vermittlungsinstanzen wie Mimik, Gestik, Körperhaltung, Blickkontakt etc. Allen diesen originären Medien ist gemeinsam, dass kein Gerät zwischen den Kommunikationspartnern geschaltet ist »und die Sinne der Menschen zur Produktion, zum Transport und zum Konsum der Botschaft ausreichen« (Pross 1972, S. 145).
Sekundäre Medien sind dann jene, die auf der Produktionsseite technische Geräte erfordern, nicht aber beim Empfänger zur Aufnahme der Mitteilung. Gemeint sind Rauchzeichen, Feuer- und Flaggensignale sowie alle jene Manifestationen menschlicher Mitteilungen, die der Schrift (z. B. öffentliche Inschriften, Brief etc.), des Drucks (Einblattdruck, Flugblatt, Flugschrift, Zeitung, Zeitschrift, Buch, Plakat) oder einer anderen Form der materiellen Speicherung und Übertragung (z. B. Kopie) bedürfen.
Mit tertiären Medien sind alle jene Kommunikationsmittel gemeint, bei denen sowohl aufseiten des Senders (zur Produktion und Übermittlung) wie auch auf Seiten des Empfängers (zur Rezeption) ein technisches Mittel erforderlich ist. Dazu gehören der gesamte Bereich der Telekommunikation (Telefon, Telegrafie, Funkanlagen etc.) sowie v. a. die elektronischen Massenmedien wie Radio, Fernsehen, Film, ebenso Videotechniken, in einem weiteren Sinn auch Computer und Datenträger unterschiedlicher Art.
Mit Blick auf die computervermittelte Kommunikation, auf Digitalisierung und Konvergenz, ist diese Typologie dennoch zu erweitern um die quartären Medien (vgl. Burkart 2002, S. 38). Diese bedürfen auf Sender- wie Empfängerseite einer Online-verbindung und vermögen Texte, Töne, Bilder, Grafiken etc. multimedial zu integrieren. »Neu ist außerdem, dass bei diesen Medien die bislang eher starre Rollenzuschreibung in Sender und Empfänger [wie wir sie in der klassischen Massenkommunikation kennen – Ergänzung H. P.] durch interaktive Momente eine gewisse Flexibilität erfährt« (ebd.). Vielfach kann in der computervermittelten Kommunikation (vgl. Kap. 4) »ein Aufweichen dieser traditionellen Sender-Empfänger-Beziehung beobachtet werden« (ebd.).
Ergänzend zu vermerken ist, dass die »jeweiligen Kommunikationsmittel […] der Mitteilung […] nicht nur dazu [verhelfen], überhaupt in Erscheinung zu treten« (ebd.). Sie bestimmen vielmehr »auch die Form, in der dies geschieht: eine Mitteilung kann gesprochen, geschrieben, gedeutet, gezeichnet (u.Ä.) werden; sie kann darüber hinaus aber auch via Druck oder Funk Verbreitung finden« (ebd.; Hervorhebung i. Orig.).
Interpersonale Kommunikation von Angesicht zu Angesicht bedient sich der hier dargelegten Differenzierung zufolge primärer Medien. Ihre wichtigsten Kanäle sind verbale und nonverbale Vermittlungsformen. Kommunikation ist demnach erfolgreich, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind: Wenn die zu vermittelnden Gedanken, Absichten oder Bedeutungen – der immaterielle Bewusstseinsgehalt‹ eines Kommunikators – in ein kommunizierbares verbales und/oder nonverbales Zeichensystem umgewandelt werden können; wenn sich die Codes bzw. Zeichen und Chiffren in ›physikalische Signale‹ (optische, akustische, taktile) transformieren lassen und von den Sinnesorganen des Adressaten wahrgenommen werden; sowie wenn der Adressat die empfangenen Zeichen deuten, d.h. decodieren, dechiffrieren und durch Interpretation die vermittelten Inhalte erschließen kann (vgl. Kap. 2.8).
The free sample has ended.