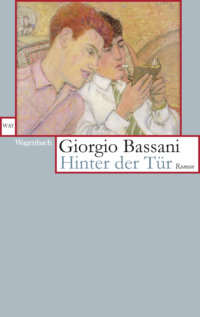Read the book: «Hinter der Tür»
Die italienische Originalausgabe erschien 1956 unter dem Titel Dietro la porta bei Giulio Einaudi Editore in Turin. Die erste deutsche Ausgabe erschien 1967 unter dem Titel Hinter der Tür im Piper Verlag in München. Die Übersetzung wurde nach der Ausgabe der 1998 bei Arnaldo Mondadori in Mailand von Roberto Cotroneo herausgegebenen Opere durchgesehen.
Diese Ausgabe wurde in freundlicher Zusammenarbeit mit der Fondazione Giorgio Bassani veröffentlicht.

E-Book-Ausgabe 2020
© 1980 Arnoldo Mondadori Editore, Milano
© 2008 Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin
Covergestaltung Sebastian Maiwind unter Verwendung des Gemäldes Red with Ian, 1959 von Peter Samuelson © The Bridgeman Art Library. Das Karnickel zeichnete Horst Rudolph.
Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 978 3 8031 4302 0
Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 2596 4
Ah, Seigneur! donnez-moi la force et le courage de contempler mon coeur et mon corps sans dégout!
Baudelaire
1
Ich bin in meinem Leben oft unglücklich gewesen, als kleines Kind, als Knabe, als Heranwachsender und schließlich als Erwachsener, und meine Verzweiflung hat oft den äußersten Punkt erreicht. Aber ich kann mich an keine Zeit erinnern, die schwärzer für mich gewesen wäre als die Monate vom Oktober 1929 bis zum Juni 1930, während ich die erste Klasse des Liceo, der Oberstufe des Gymnasiums, besuchte. All die Jahre danach haben daran im Grunde nichts ändern können. Sie konnten mir einen Schmerz nicht nehmen, der wie eine verborgene Wunde blieb, weiterblutend im geheimen. Heilung? Befreiung? Ich weiß nicht, ob sie jemals möglich sein werden.
Von Anfang an fühlte ich mich unbehaglich, ja vollkommen entwurzelt. Ich mochte unser neues Klassenzimmer nicht. Es lag am Ende eines düsteren Korridors, weit entfernt von dem anheimelnden, so vertrauten Gang des Ginnasio, der Unterstufe des Gymnasiums, mit seinen dreizehn Klassentüren. Ich mochte unsere neuen Lehrer nicht, die mit ihrer distanzierten, ironischen Art jedes Vertrauen, jedes persönliche Verhältnis unmöglich machten (sie alle siezten uns), wenn sie nicht gar – wie der Professor* für Latein und Griechisch, Guzzo, oder die Krauss, unsere Professorin für Chemie und Naturkunde – für die nächste Zukunft die Härte und Strenge wahrer Kerkermeister verhießen. Ich mochte unsere neuen Mitschüler nicht, die von der ›Fünf a‹ kamen und der wir, von der ›Fünf b‹, angegliedert worden waren. Mir schienen sie grundverschieden von uns, vielleicht tüchtiger, vielleicht schöner und, im großen und ganzen, aus besseren Familien als wir, aber jedenfalls hoffnungslos fremd. Und ich konnte die vielen unter uns von der alten ›Fünf a‹ nicht verstehen oder gar entschuldigen, die im Gegensatz zu mir sogleich Anschluß an die Neuen suchten und, wie ich zu meiner Bestürzung erkannte, durch Erwiderung der Sympathien, durch die gleiche unbefangene Verträglichkeit, wie sie sie ihnen entgegenbrachten, belohnt wurden. Ist das möglich?, fragte ich mich, verstimmt und eifersüchtig. In meiner Treue zur alten Klasse wollte ich am liebsten, daß auch hier noch, in der Oberstufe, eine Art unsichtbarer Demarkationslinie alle, die von der ›Fünf b‹ kamen, von denen aus der früheren ›Fünf a‹ schied, um jeden Verrat und jede Korruption in unseren Reihen auszuschließen. Und wie grausam hatte ich mich in meiner lächerlichen Anhänglichkeit gleich am ersten Tage verletzt gefühlt, als ich von weitem den geliebten Professor Meldolesi, der uns in der ›Fünften‹ in Literaturgeschichte unterrichtet hatte, an der Spitze seiner neuen ›Vierten‹ auf dem für uns nun verbotenen Korridor des Ginnasio verschwinden sah.
Aber am bittersten war für mich folgender Umstand: Otello Forti, der von der Grundschule an immer neben mir gesessen hatte, war bei der Abschlußprüfung der Unterstufe durchgefallen. (Ich selbst mußte wie im vorigen Jahr die Prüfung in Mathematik im Oktober wiederholen, aber Forti hatte im Oktober, obwohl er nur die Englisch-Prüfung noch einmal machen mußte, endgültig versagt.) Das hieß nicht nur, daß er nun nicht mehr wie seit jeher an meiner rechten Seite saß, sondern auch, daß ich mit ihm außerhalb der Schule nicht mehr zusammenkommen konnte. Nicht am Mittag, wenn wir gemeinsam von der Schule aus den Heimweg über den Corso Giovecca antraten, nicht am Nachmittag zum Fußballspiel auf dem Montagnone oder – und dies vor allem – nicht mehr bei ihm zu Hause, in diesem schönen, großen, fröhlichen Haus, in dem es so viele Brüder, Schwestern, Vettern und Basen Otellos gab und in dem ich so viele Stunden verbracht hatte. Denn der arme Otello, der den Schmerz über die Ungerechtigkeit, daß man ihn hatte durchfallen lassen, nicht verwand, hatte seinen Vater gebeten, die fünfte Klasse in Padua in einem Internat der Barnabiten, das den Staatsschulen gleichgestellt war, wiederholen zu dürfen. Und ohne Otello, ohne daß ich seinen massiven, ein wenig schwerfälligen Körper – so viel stärker und schwerer als der meine – neben mir spürte, ohne die Herausforderung, ja auch den Ärger, den mir seine zurückhaltende Art bedeutete, seine grobe, ironische und im Grunde so herzliche Art, wann immer wir zusammen, bei mir oder bei ihm, unsere Schularbeiten machten, ohne Otello empfand ich vom ersten Tage an den anhaltenden Schmerz des Verwaisten: das Gefühl eines durch nichts auszufüllenden Vakuums. Was wollte es da besagen, daß er mir schrieb und mit überraschender Wortgewandtheit (ich hatte ihn nie für sehr intelligent gehalten) sein Gefühl für mich in seine Briefe strömen ließ? Was machte es aus, daß ich ihm mit nicht geringeren Freundschaftsbeteuerungen antwortete? Ich besuchte jetzt das Liceo, und er ging noch immer ins Ginnasio – ich in Ferrara, er in Padua. Das war die unabänderliche Wirklichkeit, die er sich mit dem Mut, der Einsicht und der plötzlichen Reife des Unterlegenen noch deutlicher bewußt machte als ich. Weihnachten sehen wir uns wieder, schrieb ich ihm. Worauf er antwortete: Ja, Weihnachten, also in zweiundeinhalb Monaten, würden wir uns vermutlich wiedersehen (vorausgesetzt allerdings – er hatte es sich selber geschworen –, daß er in allen Fächern eine ausreichend gute Zensur erhielt, was nun keineswegs so sicher war!); doch würden zehn gemeinsam verlebte Tage an unserer Situation nichts ändern. Er schien mir raten zu wollen: Los, vergiß mich, such dir einen anderen Freund – falls du nicht schon einen gefunden hast. Nein, das Briefeschreiben nützte recht wenig. So daß wir tatsächlich bereits nach den Feiertagen von Anfang November – Allerheiligen, Allerseelen und dem Siegesgedenktag – in stillschweigendem Einverständnis beide damit aufhörten.
Ich hatte das Bedürfnis, meiner Unzufriedenheit Luft zu machen und ihr deutlich Ausdruck zu geben. So verzichtete ich am ersten Schultag bewußt darauf, mich am Sturm auf die bevorzugten Bänke zu beteiligen – das heißt auf jene, die dem Katheder am nächsten standen –, wie ihn meine Mitschüler stets zu Beginn eines neuen Schuljahres unternahmen. Das überließ ich den anderen, denen von der alten ›Fünf b‹ wie denen von der ›Fünf a‹, und blieb auf der Schwelle zum Klassenzimmer stehen, von wo aus ich angewidert die Szene beobachtete. Schließlich setzte ich mich nach hinten, auf die letzte Bank in der für die Mädchen bestimmten Reihe, nahe dem Fenster in der Ecke. Es war die einzige leer gebliebene Bank, eine große Bank, meiner mittelgroßen Statur nur schlecht angepaßt, dafür aber um so mehr meinem Wunsch nach Selbstverbannung. Wer weiß, wieviel lange Kerle hier schon vor mir gesessen hatten, die ein Schuljahr wiederholen mußten! Ich las die Inschriften, die meine Vorgänger mit dem Taschenmesser tief in den Lack der schrägen Tischfläche eingeritzt hatten – zumeist Beschimpfungen des ›Lehrkörpers‹, insbesondere des Direktors, der Turolla hieß, aber den Spitznamen ›Halber Liter‹ führte –, und als ich dann meinen Blick über die etwa dreißig Hinterköpfe vor mir gleiten ließ, fühlte ich Bitterkeit in mir aufsteigen. Zwar quälte mich noch immer der Makel meines Mißerfolgs in Mathematik, und ich konnte es kaum erwarten, die Scharte auszuwetzen, um wieder zu den Begabten und Intelligenten zu zählen: dennoch verstand ich zum erstenmal, was die Faulpelze auf den hintersten Bänken fühlten. Die Schule als Gefängnis gesehen, mit dem Direktor als Gefängnisvorstand, den Professoren als Wärtern und den Mitschülern als Sträflingen – kurz, als eine Welt, in die man keineswegs, zu begeisterter Mitarbeit bereit, sich einzufügen suchte, sondern die man sabotierte und schlechtmachte, wo man nur konnte. Wie gut verstand ich jetzt den Geist anarchischer Verachtung, den ich immer schon in der Grundschule mit furchtsamem Schaudern aus dem Hintergrund des Klassenzimmers hatte wehen spüren!
Ich sah mich in der Klasse um und lehnte ab: alle und alles. Die Mädchen in ihren unvorteilhaften schwarzen Schulschürzen zählten als Frauen überhaupt nicht. Die vier auf den beiden ersten Bänken (sie kamen aus der ›Fünf a‹) waren lächerlich klein und schienen mit ihren dünnen Zöpfen, die ihnen auf den schmächtigen Rücken herabhingen, geradewegs aus dem Kindergarten zu kommen. Wie hießen sie doch? Ihre Familiennamen endeten jedenfalls alle auf. ›-ini‹, so ähnlich wie Bergamini, Bolognini, Santini, Scanavini, Zaccarini; Namen, die allein durch ihren Klang an Familien des allerkleinsten Bürgertums erinnerten, an die Inhaber von Kurzwaren- oder Lebensmittelgeschäften, an Buchdrucker, städtische Angestellte, Vertreter und dergleichen mehr. Die beiden auf der dritten Bank, die Cavicchi und die Gabrieli – die erste schrecklich dick, die zweite so dünn, daß man beinahe durch sie hindurchsehen konnte, mit einem Gesicht voller Pusteln, von verwaschenem Ausdruck, dem Gesicht einer unverheirateten Dreißigjährigen –, waren allein von dem Dutzend Mädchen aus der ›Fünf b‹ übriggeblieben. Es waren gewiß die beiden häßlichsten – zwei farblose, geschlechtslose Büfflerinnen, die einmal Apothekerin oder Lehrerin werden sollten und so unpersönlich wie Dinge, wie bloße Gegenstände anzusehen waren. Die letzten auf der vierten und fünften Bank – die Balboni und Jovine auf der vierten, die Manoja allein auf der fünften – kamen von außerhalb: die Balboni vom Lande (man sah es – die Ärmste! – nur allzu gut an ihrer Kleidung; ihre Mutter war Dorfschneiderin und – was lag näher? – schneiderte die Kleider für sie); die Jovine aus Potenza und die Manoja aus Viterbo, vermutlich Töchter von Beamten der Provinzialverwaltung oder Staatsbahn, die wegen besonderer Verdienste nach Oberitalien versetzt worden waren. Es war schon ein rechtes Elend! Mußten Frauen, wenn sie es mit dem Studium ernst nahmen, wirklich so sein: Betschwestern ähneln, geduckt und farblos (übrigens waren sie auch nicht besonders gut gewaschen, diese Mumien, nach dem Mief zu urteilen, den sie ausströmten!), während man Schönheiten wie die Legnani und die Bertoni zum Beispiel, die beiden Vamps aus der ›Fünf b‹, immer erbarmungslos durchfallen ließ? Nur machten die sich nicht viel daraus. Die Legnani stand im Begriff zu heiraten, wenn nicht alles trog; und konnte man sich vielleicht vorstellen, daß die Bertoni, mit ihrer Wespentaille, ihrer schwarzen, glänzenden Fransenfrisur und den verschmitzt dreinblickenden Augen (im Stil der Elsa Merlini) die fünfte Klasse wiederholt hätte? Sie war ganz der Mensch, nach Rom zu verschwinden und zum Film zu gehen, wie sie uns so oft erklärt hatte, jedenfalls alles andere eher zu tun, als hierzubleiben und hinter der Tür des Gymnasiums zu versauern!
Aber hauptsächlich richtete sich meine Kritik gegen die männlichen Mitschüler, besonders gegen die in den Bänken der mittleren Reihe, die sich dem Katheder gegenüber befand. Da vorn, in der ersten und zweiten Bank, hatte die alte ›Fünf a‹ gleich drei der Ihren placieren können: Boldini, Grassi und Droghetti, dazwischen Florestano Donadio von der ›Fünf b‹, der auf der zweiten Bank neben Droghetti saß, nur wie ein geduldeter Gast wirkte, dürftig wie er in allem war, in geistiger, körperlicher und überhaupt in jeder Beziehung. Mit Droghetti, dem Sohn eines Kavallerieoffiziers, einem Jungen von ebenso untadeligem wie geistlosem Aussehen, das ihn, wie man schwören mochte, dazu bestimmte, die Laufbahn seines Vaters einzuschlagen, war zwar gewiß nicht viel los. Aber die beiden auf der vorderen Bank, Boldini und Grassi, die zu den Besten der a-Klasse gehörten, stellten zusammen eine Großmacht dar, der sich der blonde, kleine und rosige Donadio, dieses ängstliche Vögelchen, das er von jeher gewesen war, als tributpflichtiger Vasall geradezu anbot. Auf der dritten Bank saß wieder ein schlecht zusammengestelltes Paar: Giovannini von der ›Fünf b‹ und Camurri von der ›Fünf a‹. Nicht, daß Giovannini weniger tüchtig gewesen wäre als sein Nachbar, da es doch der gute Walter trotz seiner ländlichen Herkunft sogar fertigbrachte, sich in der Schriftsprache auszudrücken. Aber Camurri war ein Herr – häßlich, kurzsichtig, bigott, aber ein Herr. Seine Familie (die Camurri aus der Via Carlo Mayr – wer kannte sie nicht?) gehörte zu den reichsten der Stadt. Sie besaß Hunderte Hektar Land in der Gegend von Codigoro, aus der Walter kam, so daß es keineswegs ausgeschlossen war, daß Walters Vater oder Großvater früher, ja, vielleicht noch jetzt im Dienst der Familie Camurri stand … In der vierten Bank aber saß, allein, wer weiß, warum – vielleicht um anzudeuten, daß niemand soviel Verdienste aufwies, um neben ihm sitzen zu dürfen –, Cattolica, Carlo Cattolica, der schon von der ersten Gymnasialklasse an der unbestrittene Star der a-Klassen gewesen war (regelmäßig acht oder neun von zehn Punkten in sämtlichen Fächern). Man sah es ihnen nicht an – aber über die getreuen Camurri und Droghetti, die mit gebeugten Rücken vor ihm saßen, würde es für Cattolica in jeder Lage ein Kinderspiel sein, sich mit den nicht minder getreuen Boldini und Grassi in der ersten Bank in Verbindung zu setzen. Das würde man bald merken bei den Klassenarbeiten in Latein und Griechisch, und wie! Die Nachrichtenverbindung zwischen der vierten und ersten Bank würde so gut funktionieren, als ob die von der ›Fünf a‹ über ein Feldtelefon verfügten.
Hinter Cattolica saßen zwei von uns: Mazzanti und Malagù, beide ziemliche Nullen. Rechts neben mir saßen, tief über die Bank gebeugt, um sich zu verstecken und den forschenden Blicken des Professors hinter dem Katheder zu entgehen, Veronesi und Danieli. Veronesi war mindestens zwanzig Jahre alt, Danieli noch älter, sie waren daran gewöhnt, jede Klasse wiederholen zu müssen, alte Faulpelze, die nicht einmal zum Sport taugten und sich nur auf einem einzigen Gebiet auskannten: dem der Freudenhäuser der Stadt, in denen sie seit Jahren zu den eifrigsten Stammgästen zählten.
Wenn nun die Plätze in der Bankreihe der Tafel gegenüber und neben der Tür auch ein wenig besser besetzt waren (in der zweiten Bank war Giorgio Selmi neben Chieregatti gelandet, in der dritten war es Ballerini wieder gelungen, neben Giovanardi, von dem er unzertrennlich war, Platz zu finden), wie hätte ich mich wohl damit abfinden können, auf der vierten Bank neben Lattuga zu sitzen, Aldo Lattuga, diesem infamen Stinker, der von allen gemieden und verspottet wurde und bei dem sich in den unteren Klassen selten jemand bereit gefunden hatte, die Bank mit ihm zu teilen, und der nun auch hier wie Cattolica – selbst wenn aus genau entgegengesetzten Gründen – allein geblieben war? Nein und noch mal nein!, sagte ich mir. Dann besser auf meinem einsamen Platz bleiben, den ich mir auf der hintersten Bank in der Reihe der Mädchenplätze gesucht hatte. Professor Bianchi hatte den Italienischunterricht mit dem Vortrag einer Kanzone Dantes begonnen, und ein Vers daraus hatte mich merkwürdig angerührt: »Die Verbannung, die mir zuteil ward, rechne ich mir zur Ehre an.« Das könnte mein Wahlspruch sein, dachte ich.
Eines Tages blickte ich zerstreut durch das hohe Fenster links von mir auf den tristen, von hungrigen Katzen bevölkerten Hof, der das Guarini-Gymnasium, das sich im Gebäude eines ehemaligen Klosters befand, von der Seitenwand der Kirche del Gesù trennte. Ich dachte, daß es eigentlich schön gewesen wäre, wenn mich zum Beispiel Giorgio Selmi, der mir im Grunde immer sehr sympathisch gewesen war, von sich aus am ersten Schultag gebeten hätte, mich zu ihm zu setzen. Selmi war Vollwaise und wohnte mit seinem Bruder Luigi zusammen bei einem Onkel väterlicherseits, dem Rechtsanwalt Armando, einem mürrischen Junggesellen, der sich den Sechzig näherte und der nur auf die Stunde wartete, da er seine Neffen los wurde, wenn er den einen auf die Militärakademie in Modena und den anderen auf die Marineakademie in Livorno schicken konnte. Wie kam es, daß sich Giorgio lieber mit diesem stumpfsinnigen Büffler Chieregatti zusammensetzte als mit mir? Die Wohnung seines Onkels an der Piazza Sacrati (eine Anwaltskanzlei mit einigen dazugehörigen Wohnräumen) war sicherlich nicht besonders geeignet, um dort gemeinsam Schularbeiten zu machen, wenn es zutraf – und es traf wohl zu –, daß Giorgio in seinem Schlafzimmer lernen mußte, einem Kämmerchen von drei mal vier Metern. Bei mir zu Hause hingegen hätten wir so viel Raum gehabt, wie wir nur brauchten. In meinem Arbeitszimmer gab es Platz genug für mich, ihn und jeden, den wir noch in unsere Gemeinschaft aufnehmen wollten. Und was für einen prächtigen Imbiß, mit Tee, Butter und Marmelade als Grundlage, hätte uns meine Mutter um fünf Uhr bereitet, da sie so froh darüber war, daß ich jetzt den Nachmittag stets zu Hause und nicht wie früher bei den Fortis verbrachte. Es war wirklich schade, daß sich Giorgio Selmi nicht zu mir gesetzt hatte. Nur Eifersucht und Mißgunst konnten ihn davon abgehalten haben. Unsere Wohnung war im Vergleich mit seiner zu schön und zu komfortabel. Und ich hatte noch meine Mutter, während er nur einen alten, wunderlichen Onkel hatte. Der Antisemitismus spielte dabei ausnahmsweise mal keine Rolle; nein, damit hatte es ganz und gar nichts zu tun.
»Sss!«
Ein leiser Pfiff von rechts ließ mich zusammenfahren. Mit einem Ruck wandte ich mich zur Seite. Es war Veronesi. Geduckt hinter dem Rücken Mazzantis forderte er mich mit ausgestrecktem Zeigefinger auf – es war ein dünner, unwahrscheinlich nikotinverfärbter Finger –, nach vorn zu blicken. Was ich denn mache, schien er mich, halb belustigt, halb besorgt, fragen zu wollen. Wo meinte ich wohl zu sein, ich närrischer Kauz, für den, wenn nicht für Schlimmeres, er mich hielt!
Ich blickte auf. In der vollkommenen Stille, kaum unterbrochen durch ein halb unterdrücktes Lachen, waren alle Gesichter mir zugewandt. Auch Professor Guzzo fixierte mich vom Katheder aus mit einem ironischen Lächeln.
»Endlich!« bemerkte er mit sanfter Stimme.
Ich stand auf.
»Sie heißen?«
Ich stammelte leise meinen Namen.
Guzzo war für seine Bosheit berüchtigt; sie grenzte an Sadismus. Er war ein Mann um die fünfzig, hochgewachsen, von herkulischer Kraft, mit großen, blitzenden Augen – von smaragdgrüner Farbe mit braunen Flecken, wie die Haut gewisser Eidechsen – unter einer gewaltigen Stirn (einer Wagnerstirn) und mit langen grauen Koteletten, die bis zur Mitte seiner hageren Wangen reichten. Im Guarini-Gymnasium galt er als eine Art Genie. (Die Worte auf der Gedenktafel für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, die sich unten im Treppenhaus so schön ausnahm, waren von ihm: ›Mors domavit corpora – Vicit mortem virtus: Der Tod bezwang die Körper – Die Tugend besiegte den Tod‹.) Er gehörte nicht der faschistischen Partei an, und nur deshalb – so sagten alle – hatte er nicht den Lehrstuhl an der Universität erhalten, für den ihn seine in Deutschland veröffentlichten philologischen Arbeiten gewiß legitimiert hätten.
»Wie bitte?« fragte er und hielt dabei seine Hand hinter das Ohr, während er sich so weit vorbeugte, daß er mit dem mächtigen Oberkörper das aufgeschlagene Klassenbuch berührte. »Sprechen Sie bitte lauter!«
Keine Frage: Es machte ihm Spaß. Er spielte Komödie.
Ich wiederholte meinen Namen.
Mit einem Ruck richtete er sich wieder auf und blickte aufmerksam ins Klassenbuch. »Gut«, bemerkte er, während er eine geheimnisvolle Eintragung vornahm.
»Und jetzt erzählen Sie mir ein bißchen von sich«, fuhr er fort und lehnte sich wieder auf seinem Stuhl zurück.
»Von mir?«
»Natürlich, von Ihnen. Kommen Sie aus der ›Fünf a‹ oder aus der ›Fünf b‹?«
»Aus der ›Fünf b‹.«
Er verzog den Mund.
»Also aus der ›Fünf b‹. Und wie haben Sie den Aufstieg hierher geschafft? Im ersten Anlauf, im Fluge oder – verzeihen Sie mein schlechtes Gedächtnis – erst in zweiter Instanz?«
»Ich habe die Prüfung in Mathematik im Oktober wiederholen müssen.«
»Nur in Mathematik?«
Ich bejahte.
»Tatsächlich? Haben Sie nicht doch vielleicht auch ein paar andere Fächer wiederholen müssen? Latein und Griechisch zum Beispiel?«
Ich verneinte.
»Ganz bestimmt nicht?« fragte er von neuem, mit katzenhafter Freundlichkeit.
Abermals verneinte ich.
»Nun hören Sie zu, mein lieber Freund, geben Sie gut acht … Ich möchte nicht, daß Sie im nächsten Sommer außer in Mathematik die Prüfung auch noch – quod deus avertat – in Latein und Griechisch wiederholen müssen – in drei Fächern … Sie verstehen mich doch, nicht wahr?«
Dann fragte er mich, wie ich mich bisher im Gymnasium durchgeschlagen hätte und ob ich nicht das eine oder andere Mal sitzengeblieben wäre. Aber er sah mich dabei nicht an, sondern blickte im Kreise umher, als ob er mir nicht traute und gern das spontane Zeugnis eines anderen gehört hätte.
»Er war immer einer der Besten«, wagte schließlich jemand zu sagen. Ich glaube, es war Pavani, in der ersten Bank der ersten Reihe.
»Ach, einer der Besten!« rief Professor Guzzo erstaunt aus. »Aber wie erklärt sich dann dieser Abstieg? Wieso ist es dazu gekommen?«
Ich wußte nicht, was ich sagen sollte. Ich starrte auf die Bank, als könnte mir ihr schwärzliches altes Holz die von Professor Guzzo gewünschte Antwort verraten.
Dann hob ich wieder den Kopf. »Wieso?« fragte er unerbittlich von neuem. »Und aus welchem Grunde haben Sie sich dann eine solche Bank ausgesucht? Vielleicht, um in der Nähe des ausgezeichneten Veronesi und des nicht minder ausgezeichneten Danieli zu sitzen und statt von mir von ihnen die wahre Wissenschaft zu erfahren?«
Die Klasse brach in ein einstimmiges Gelächter aus. Selbst Veronesi und Danieli lachten, wenn auch mit weniger Begeisterung.
»Nein, glauben Sie mir«, fuhr Guzzo fort, und mit der großen Gebärde eines Dirigenten vor seinem Orchester bändigte er den Lärm. »Vor allem müssen Sie Ihren Platz wechseln.«
Er suchte, prüfte und traf seine Entscheidung.
»Dorthin, auf die vierte Bank. Neben diesen Herrn.« Er zeigte auf Cattolica.
»Wie heißen Sie?«
Cattolica stand auf.
»Carlo Cattolica«, erwiderte er schlicht.
»Oh, gut! Der berühmte Cattolica. Gut. Vorzüglich. Sie kommen aus der ›Fünf a‹, nicht wahr?«
»Ja, Herr Professor.«
»Schön. A mit b. Ausgezeichnet.«
Ich packte meine Bücher zusammen, trat in den Gang, erreichte meinen neuen Platz, unterwegs von einem Gehüstel Veronesis gegrüßt und bei der Ankunft mit einem Lächeln vom Star der alten ›Fünf a‹ empfangen.
»Geben Sie gut acht auf ihn, Cattolica«, sagte Guzzo. »Ich vertraue ihn Ihnen an. Führen Sie dieses verirrte Schäfchen auf den rechten Weg zurück.«