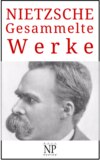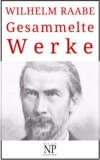Read the book: «Friedrich Wilhelm Nietzsche – Gesammelte Werke», page 66
208
Wodurch man alle wider sich hätte. – Wenn jetzt jemand zu sagen wagte: "wer nicht für mich ist, der ist wider mich", so hätte er sofort alle wider sich. – Diese Empfindung macht unserm Zeitalter Ehre.
209
Sich des Reichtums schämen. – Unsere Zeit verträgt nur eine einzige Gattung von Reichen, solche, welche sich ihres Reichtums schämen. Hört man von jemandem "er ist sehr reich", so hat man dabei sofort eine ähnliche Empfindung wie beim Anblick einer widerlich anschwellenden Krankheit, einer Fett- oder Wassersucht: man muß sich gewaltsam seiner Humanität erinnern, um mit einem solchen Reichen so verkehren zu können, daß er von unserm Ekelgefühle nichts merkt. Sobald er aber gar sich etwas auf seinen Reichtum zugute tut, so mischt sich zu unserm Gefühle die fast mitleidige Verwunderung über einen so hohen Grad der menschlichen Unvernunft: so daß man die Hände gen Himmel erheben und rufen möchte "armer Entstellter, Überbürdeter, hundertfach Gefesselter, dem jede Stunde etwas Unangenehmes bringt oder bringen kann, in dessen Gliedern jedes Ereignis von zwanzig Völkern nachzuckt, wie magst du uns glauben machen, daß du dich in deinem Zustande wohlfühlst! Wenn du irgendwo öffentlich erscheinst, so wissen wir, daß es eine Art Spießrutenlaufens ist, unter lauter Blicken, welche für dich nur kalten Haß oder Zudringlichkeit oder schweigsamen Spott haben. Dein Erwerben mag leichter sein als das der anderen: aber es ist ein überflüssiges Erwerben, welches wenig Freude macht, und dein Bewahren alles Erworbenen ist jedenfalls jetzt ein mühseligeres Ding als irgend ein mühseliges Erwerben. Du leidest fort – während, denn du verlierst fortwährend. Was nützt es dir, daß man dir immer neues künstliches Blut zuführt: deshalb tun doch die Schröpfköpfe nicht weniger weh, die auf deinem Nacken sitzen, beständig sitzen!- Aber, um nicht unbillig zu werden, es ist schwer, vielleicht unmöglich für dich, nicht reich zu sein: du mußt bewahren, mußt neu erwerben, der vererbte Hang deiner Natur ist das Joch über dir – aber deshalb täusche uns nicht und schäme dich ehrlich und sichtlich des Joches, das du trägst: da du ja im Grunde deiner Seele müde und unwillig bist, es zu tragen. Diese Scham schändet nicht."
210
Ausschweifung in der Anmaßung. – Es gibt so anmaßende Menschen, daß sie eine Größe, welche sie öffentlich bewundern, nicht anders zu loben wissen, als indem sie dieselbe als Vorstufe und Brücke, die zu ihnen führt, darstellen.
211
Auf dem Boden der Schmach. – Wer den Menschen eine Vorstellung nehmen will, tut sich gewöhnlich nicht genug damit, sie zu widerlegen und den unlogischen Wurm, der in ihr sitzt, herauszuziehen: vielmehr wirft er, nachdem der Wurm getötet ist, die ganze Frucht auch noch in den Kot, um sie den Menschen unansehnlich zu machen und Ekel vor ihr einzuflößen. So glaubt er das Mittel gefunden zu haben, die bei widerlegten Vorstellungen so gewöhnliche "Wiederauferstehung am dritten Tage" unmöglich zu machen. – Er irrt sich, denn gerade auf dem Boden der Schmach, inmitten des Unflates, treibt der Fruchtkern der Vorstellung schnell neue Keime. – Also: ja nicht verhöhnen, beschmutzen, was man endgültig beseitigen will, sondern es achtungsvoll auf Eis legen, immer und immer wieder, in Anbetracht, daß Vorstellungen ein sehr zähes Leben haben. Hier muß man nach der Maxime handeln: "Eine Widerlegung ist keine Widerlegung."
212
Los der Moralität. – Da die Gebundenheit der Geister abnimmt, ist sicherlich die Moralität (die vererbte, überlieferte, instinkthafte Handlungsweise nach moralischen Gefühlen) ebenfalls in Abnahme: nicht aber die einzelnen Tugenden, Mäßigkeit, Gerechtigkeit, Seelenruhe, – denn die größte Freiheit des bewußten Geistes führt einmal schon unwillkürlich zu ihnen hin und rät sie sodann auch als nützlich an.
213
Der Fanatiker des Mißtrauens und seine Bürgschaft. – Der Alte: Du willst das Ungeheure wagen und die Menschen im Großen belehren? Wo ist deine Bürgschaft? – Pyrrhon: Hier ist sie: ich will die Menschen vor mir selber warnen, ich will alle Fehler meiner Natur öffentlich bekennen und meine Übereilungen, Widersprüche und Dummheiten vor aller Augen bloßstellen. Hört nicht auf mich, will ich ihnen sagen, bis ich nicht eurem Geringsten gleich geworden bin, und noch geringer bin, als er; sträubt euch gegen die Wahrheit, so lange ihr nur könnt, aus Ekel vor dem, der ihr Fürsprecher ist. Ich werde euer Verführer und Betrüger sein, wenn ihr noch den mindesten Glanz von Achtbarkeit und Würde an mir wahrnehmt. – Der Alte: Du versprichst zuviel, du kannst diese Last nicht tragen – Pyrrhon – So will ich auch dies den Menschen sagen, daß ich zu schwach bin und nicht halten kann, was ich verspreche. Je größer meine Unwürdigkeit, um so mehr werden sie der Wahrheit mißtrauen, wenn sie durch meinen Mund geht. – Der Alte: Willst du denn der Lehrer des Mißtrauens gegen die Wahrheit sein? – Pyrrhon: Des Mißtrauens, wie es noch nie in der Welt war, des Mißtrauens gegen Alles und Jedes. Es ist der einzige Weg zur Wahrheit. Das rechte Auge darf dem linken nicht trauen, und Licht wird eine Zeitlang Finsternis heißen müssen: dies ist der Weg, den ihr gehen müßt. Glaubt nicht, daß er euch zu Fruchtbäumen und schönen Weiden führe. Kleine harte Körner werdet ihr auf ihm finden, – das sind die Wahrheiten: Jahrzehntelang werdet ihr die Lügen händevoll verschlingen müssen, um nicht Hungers zu sterben, ob ihr schon wisset, daß es Lügen sind. Jene Körner aber werden gesäet und eingegraben, und vielleicht, vielleicht gibt es einmal einen Tag der Ernte: niemand darf ihn versprechen, er sei denn ein Fanatiker. – Der Alte: Freund, Freund! Auch deine Worte sind die des Fanatikers! – Pyrrhon: Du hast recht! ich will gegen alle Worte mißtrauisch sein. – Der Alte: Dann wirst du schweigen müssen. – Pyrrhon: Ich werde den Menschen sagen, daß ich schweigen muß und daß sie meinem Schweigen mißtrauen sollen. – Der Alte: Du trittst also von deinem Unternehmen zurück? – Pyrrhon: Vielmehr- du hast mir eben das Tor gezeigt, durch welches ich gehen muß. – Der Alte: Ich weiß nicht – : verstehen wir uns jetzt noch völlig? – Pyrrhon: Wahrscheinlich nicht. – Der Alte: Wenn du dich nur selber völlig verstehst! – Pyrrhon dreht sich um und lacht. – Der Alte: Ach Freund! Schweigen und Lachen – ist das jetzt deine ganze Philosophie? – Pyrrhon: Es wäre nicht die schlechteste.-
214
Europäische Bücher. – Man ist beim Lesen von Montaigne, La Rochefoucauld, La Bruyere, Fontenelle (namentlich der dialogues des morts), Vauvenargues, Chamfort dem Altertum näher als bei irgend welcher Gruppe von sechs Autoren anderer Völker. Durch jene Sechs ist der Geist der letzten Jahrhunderte der alten Zeitrechnung wieder erstanden – sie zusammen bilden ein wichtiges Glied in der großen noch fortlaufenden Kette der Renaissance. Ihre Bücher erheben sich über den Wechsel des nationalen Geschmacks und der philosophischen Färbungen, in denen für gewöhnlich jetzt jedes Buch schillert und schillern muß, um berühmt zu werden: sie enthalten mehr wirkliche Gedanken als alle Bücher deutscher Philosophen zusammengenommen: Gedanken von der Art, welche Gedanken macht, und die – ich bin in Verlegenheit zu Ende zu definieren; genug, daß es mir Autoren zu sein scheinen, welche weder für Kinder noch für Schwärmer geschrieben haben, weder für Jungfrauen noch für Christen, weder für Deutsche noch für – ich bin wieder in Verlegenheit, meine Liste zu schließen. – Um aber ein deutliches Lob zu sagen: sie wären, griechisch geschrieben, auch von Griechen verstanden worden. Wieviel hätte dagegen selbst ein Plato von den Schriften unserer besten deutschen Denker, zum Beispiel Goethes und Schopenhauers, überhaupt verstehen können, von dem Widerwillen zu schweigen, welchen ihre Schreibart ihm erregt haben würde, nämlich das Dunkle, Übertriebene und gelegentlich wieder Klapperdürre, – Fehler, an denen die Genannten noch am wenigsten von den deutschen Denkern und doch noch allzuviel leiden (Goethe, als Denker, hat die Wolke lieber umarmt, als billig ist, und Schopenhauer wandelt nicht ungestraft fast fortwährend unter Gleichnissen der Dinge statt unter den Dingen selber). – Dagegen, welche Helligkeit und zierliche Bestimmtheit bei jenen Franzosen! Diese Kunst hätten auch die feinohrigsten Griechen gutheißen müssen, und eines würden sie sogar bewundert und angebetet haben, den französischen Witz des Ausdrucks: so etwas liebten sie sehr, ohne gerade darin besonders stark zu sein.
215
Mode und modern. – Überall, wo noch die Unwissenheit, die Unreinlichkeit, der Aberglaube im Schwange sind, wo der Verkehr lahm, die Landwirtschaft armselig, die Priesterschaft mächtig ist, da finden sich auch noch die NationaItrachten. Dagegen herrscht die Mode, wo die Anzeichen des Entgegengesetzten sich finden. Die Mode ist also neben den Tugenden des jetzigen Europa zu finden: sollte sie wirklich deren Schattenseite sein? – Zunächst sagt die männliche Bekleidung, welche modisch und nicht mehr national ist, von dem, der sie trägt, aus, daß der Europäer nicht als Einzelner noch als Standes- und Volksgenosse auffallen will, daß er sich eine absichtliche Dämpfung dieser Arten von Eitelkeit zum Gesetz gemacht hat: dann, daß er arbeitsam ist und nicht viel Zeit zum Ankleiden und Sich-putzen hat, auch alles Kostbare und Üppige in Stoff und Faltenwurf im Widerspruch mit seiner Arbeit findet; endlich, daß er durch seine Tracht auf die gelehrteren und geistigeren Berufe als die hinweist, welchen er als europäischer Mensch am nächsten steht oder stehen möchte: während durch die noch vorhandenen Nationaltrachten der Räuber, der Hirt oder der Soldat als die wünschbarsten und tonangebenden Lebensstellungen hindurchschimmern. Innerhalb dieses Gesamt-Charakters der männlichen Mode gibt es dann jene kleinen Schwankungen, welche die Eitelkeit der jungen Männer, der Stutzer und Nichtstuer der großen Städte hervorbringt, also derer, welche als europäische Menschen noch nicht reif geworden sind. – Die europäischen Frauen sind dies noch viel weniger, weshalb die Schwankungen bei ihnen viel größer sind: sie wollen auch das Nationale nicht und hassen es, als Deutsche, Franzosen, Russen an der Kleidung erkannt zu werden, aber als einzelne wollen sie sehr gern auffallen; ebenso soll niemand schon durch ihre Bekleidung im Zweifel gelassen werden, daß sie zu einer angeseheneren Klasse der Gesellschaft (zur "guten" oder "hohen" oder "großen" Welt) gehören, und zwar wünschen sie nach dieser Seite hin gerade um so mehr voreinzunehmen, als sie nicht oder kaum zu jener Klasse gehören. Vor allem aber will die junge Frau nichts tragen, was die etwas ältere trägt, weil sie durch den Verdacht eines höheren Lebensalters im Preise zu fallen glaubt: die ältere wiederum möchte durch jugendlichere Tracht so lange täuschen, als es irgend angeht, – aus welchem Wettbewerb sich zeitweilig immer Moden ergeben müssen, bei denen das eigentlich Jugendliche ganz unzweideutig und unnachahmlich sichtbar wird. Hat der Erfindungsgeist der jungen Künstlerinnen in solchen Bloßstellungen der Jugend eine Zeitlang geschwelgt, oder um die ganze Wahrheit zu sagen – hat man wieder einmal den Erfindungsgeist älterer höfischer Kulturen, sowie den der noch bestehenden Nationen, und überhaupt den ganzen kostümierten Erdkreis zu Rate gezogen und etwa die Spanier, die Türken und Altgriechen zur Inszenierung des schönen Fleisches zusammengekoppelt: so entdeckt man endlich immer wieder, daß man sich doch nicht zum Besten auf seinen Vorteil verstanden habe; daß, um auf die Männer Wirkung zu machen, das Versteckspielen mit dem schönen Leibe glücklicher sei, als die nackte und halbnackte Ehrlichkeit; und nun dreht sich das Rad des Geschmackes und der Eitelkeit einmal wieder in entgegengesetzter Richtung: die etwas älteren jungen Frauen finden, daß ihr Reich gekommen sei, und der Wettkampf der lieblichsten und absurdesten Geschöpfe tobt wieder von neuem. Je mehr aber die Frauen innerlich zunehmen und nicht mehr unter sich, wie bisher, den unreifen Altersklassen den Vorrang zugestehen, um so geringer werden diese Schwankungen ihrer Tracht, um so einfacher ihr Putz: über welchen man billigerweise nicht nach antiken Mustern das Urteil sprechen darf, also nicht nach dem Maßstabe der Gewandung südländischer See-Anwohnerinnen, sondern in Berücksichtigung der klimatischen Bedingungen der mittleren und nördlichen Gegenden Europas, derer nämlich, in welchen jetzt der geist- und formerfindende Genius Europas seine liebste Heimat hat. – Im ganzen wird also gerade nicht das Wechselnde das charakteristische Zeichen der Mode und des Modernen sein, denn gerade der Wechsel ist etwas Rückständiges und bezeichnet die noch ungereiften männlichen und weiblichen Europäer: sondern die Ablehnung der nationalen, ständischen und individuellen Eitelkeit. Dementsprechend ist es zu loben, weil es kraft- und zeitersparend ist, wenn einzelne Städte und Gegenden Europas für alle übrigen in Sachen der Kleidung denken und erfinden, in Anbetracht dessen, daß der Formensinn nicht jedermann geschenkt zu sein pflegt; auch ist es wirklich kein allzu hochfliegender Ehrgeiz, wenn zum Beispiel Paris, so lange jene Schwankungen noch bestehen, es in Anspruch nimmt, der alleinige Erfinder und Neuerer in diesem Reiche zu sein. Will ein Deutscher, aus Haß gegen diese Ansprüche einer französischen Stadt, sich anders kleiden, zum Beispiel so wie Albrecht Dürer sich trug, so möge er erwägen, daß er dann ein Kostüm hat, welches ehemalige Deutsche trugen, welches aber die Deutschen ebensowenig erfunden haben, – es hat nie eine Tracht gegeben, welche den Deutschen als Deutschen bezeichnete; übrigens mag er zusehen, wie er aus dieser Tracht herausschaut und ob etwa der ganz moderne Kopf nicht mit all seiner Linien- und Fältchenschrift, welche das neunzehnte Jahrhundert hineingrub, gegen eine Dürerische Bekleidung Einsprache tut. – Hier, wo die Begriffe "modern" und "europäisch" fast gleich gesetzt sind, wird unter Europa viel mehr an Länderstrecken verstanden, als das geographische Europa, die kleine Halbinsel Asiens, umfaßt: namentlich gehört Amerika hinzu, soweit es eben das Tochterland unserer Kultur ist. Andererseits fällt nicht einmal ganz Europa unter den Kultur-Begriff, "Europa"; sondern nur alle jene Völker und Völkerteile, welche im Griechen-, Römer-, Juden- und Christentum ihre gemeinsame Vergangenheit haben.
216
Die "deutsche Tugend". – Es ist nicht zu leugnen, daß vom Ausgange des vorigen Jahrhunderts an ein Strom moralischer Erweckung durch Europa floß. Damals erst wurde die Tugend wieder beredt; sie lernte es, die ungezwungenen Gebärden der Erhebung, der Rührung finden, sie schämte sich ihrer selber nicht mehr und ersann Philosophien und Gedichte zur eigenen Verherrlichung. Sucht man nach den Quellen dieses Stromes: so findet man einmal Rousseau, aber den mythischen Rousseau, den man sich nach dem Eindrucke seiner Schriften – fast könnte man wieder sagen: seiner mythisch ausgelegten Schriften – und nach den Fingerzeigen, die er selber gab, erdichtet hatte ( – er und sein Publikum arbeiteten beständig an dieser Idealfigur). Der andere Ursprung liegt in jener Wiederauferstehung des stoisch-großen Römertums, durch welche die Franzosen die Aufgabe der Renaissance auf das würdigste weitergeführt haben. Sie gingen von der Nachschöpfung antiker Formen mit herrlichstem Gelingen zur Nachschöpfung antiker Charaktere über: so daß sie ein Anrecht auf die allerhöchsten Ehren immerdar behalten werden, als das Volk, welches der neueren Menschheit bisher die besten Bücher und die besten Menschen gegeben hat. Wie diese doppelte Vorbildlichkeit, die des mythischen Rousseau und die jenes wiedererweckten Römergeistes, auf die schwächeren Nachbarn wirkte, sieht man namentlich an Deutschland: welches infolge seines neuen und ganz ungewohnten Aufschwunges zu Ernst und Größe des Wollens und Sich – Beherrschens zuletzt vor seiner eigenen neuen Tugend in Staunen geriet und den Begriff "deutsche Tugend" in die Welt warf, wie als ob es nichts Ursprünglicheres, Erbeigneres geben könnte als diese. Die ersten großen Männer, welche jene französische Anregung zur Größe und Bewußtheit des sittlichen Wollens auf sich überleiteten, waren ehrlicher und vergaßen die Dankbarkeit nicht. Der Moralismus Kants – woher kommt er? Er gibt es wieder und wieder zu verstehen: von Rousseau und dem wiedererweckten stoischen Rom. Der Moralismus Schillers: gleiche Quelle, gleiche Verherrlichung der Quelle. Der Moralismus Beethovens in Tönen: er ist das ewige Loblied Rousseaus, der antiken Franzosen und Schillers. Erst "der deutsche Jüngling" vergaß die Dankbarkeit, inzwischen hatte man ja das Ohr nach den Predigern des Franzosenhasses hingewendet: jener deutsche Jüngling, der eine Zeitlang mit mehr Bewußtheit als man bei andern Jünglingen für erlaubt hält, in den Vordergrund trat. Wenn er nach seiner Vaterschaft spürte, so mochte er mit Recht an die Nähe Schillers, Fichtes und Schleiermachers denken: aber seine Großväter hätte er in Paris, in Genf suchen müssen, und es war sehr kurzsichtig zu glauben, was er glaubte: daß die Tugend nicht älter als dreißig Jahre sei. Damals gewöhnte man sich daran, zu verlangen, daß beim Worte "deutsch" auch noch so nebenbei die Tugend mitverstanden werde: und bis auf den heutigen Tag hat man es noch nicht völlig verlernt. – Nebenbei bemerkt, jene genannte moralische Erweckung hat für die Erkenntnis der moralischen Erscheinungen, wie sich fast erraten läßt, nur Nachteile und rückschreitende Bewegungen zur Folge gehabt. Was ist die ganze deutsche Moralphilosophie, von Kant an gerechnet, mit allen ihren französischen, englischen und italienischen Ausläufern und Nebenzüglern? Ein halbtheologisches Attentat gegen Helvetius, ein Abweisen der lange und mühsam erkämpften Freiblicke oder Fingerzeige des rechten Weges, welche er zuletzt gut ausgesprochen und zusammengebracht hat. Bis auf den heutigen Tag ist Helvetius in Deutschland der bestbeschimpfte aller guten Moralisten und guten Menschen.