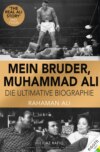Read the book: «Mein Bruder, Muhammad Ali», page 6
Am Anfang des Krieges war Muhammads Antwort auf die Einberufung größtenteils von der Reaktion der Nation of Islam bestimmt, denn viele schwarze Muslime verweigerten den Kriegsdienst, und mein Bruder folgte eigentlich nur ihrem Beispiel. Er handelte nach seinen Glaubensprinzipien, doch er betrachtete den Krieg nicht unbedingt als eine ungerechte Sache. Das änderte sich jedoch mit Fortdauer des Krieges, als Muhammad neu eingestuft wurde. Muhammad war kein besonders eifriger Leser, und damals, beim ersten Mal, waren seine Lese- und Schreibfähigkeiten gerade einmal ausreichend gewesen, und die Tests, die er bei der Stellungskommission ausfüllen musste und die als Kriterium zur Einberufung dienten, fielen ihm recht schwer. Erst als die Armee nach mehreren Jahren hartem, blutigem Dschungelkrieg mehr Soldaten benötigte, wurden die Qualifikationskriterien für die Einberufung gesenkt. Doch anstatt meinen Bruder erneut zu testen, klassifizierten sie die Ergebnisse des alten Tests aufgrund der neuen Kriterien neu und erklärten ihn im Nachhinein für tauglich. Sie können sich vorstellen, wie das bei meinem Bruder ankam. Erst wurde er als dumm abqualifiziert und ausgemustert, doch als die Armee dringend mehr Soldaten für Vietnam benötigte, war er plötzlich wieder klug genug.
Als er herausfand, dass er als tauglich eingestuft worden war – ich denke, wir befanden uns damals gerade in dem Bungalow, den er in Miami gemietet hatte, als er den Anruf bekam –, war die erste Reaktion meines Bruders: Warum ich? Ich bin doch Weltmeister im Schwergewicht. Mit meinen Steuern finanziere ich so viele Gewehre, Panzer und Soldaten. Warum holen die nicht andere, die keine Steuern zahlen? Seine erste Antwort hatte also rein gar nichts mit seinen Prinzipien zu tun, doch es steckte trotzdem etwas mehr dahinter. So wie ich es sah, war Muhammad anfangs nicht klar, dass man ihn nicht an die Front schicken würde, um dort Menschen zu töten. Schon zuvor war es meist gang und gäbe gewesen, dass bekannte Sportler, die zur Armee gingen, im Normalfall mit ungefährlichen Aufgaben betraut wurden, wie etwa mit Vorführungen, um die Truppen bei Laune zu halten, und ich denke, man konnte davon ausgehen, dass, wenn er sich verpflichtet hätte, er ebenso wenig an die Front gekommen wäre. Zu Beginn schien er dies allerdings nicht zu begreifen, und er begann, sich so in seine Wut hineinzusteigern, dass er sich in der Öffentlichkeit so vehement gegen den Krieg aussprach, bis ihn die meisten Amerikaner als einen Ausgestoßenen betrachteten. Als er realisierte, dass ihm persönlich keine Gefahr drohte, war er dann nicht mehr bereit, seine Prinzipien zu opfern.
„Warum soll ein schwarzer Mann von weißen Männern geschickt werden, um braune Menschen umzubringen?“, sagte er. „Ich bin ein Muslim, und wir ziehen nicht in den Krieg, solange er nicht von Allah selbst ausgerufen wurde. Ich persönlich habe keinen Streit mit dem Vietkong.“
Natürlich machten sich auch unsere Eltern Sorgen. Ich erinnere mich, wie mein Bruder zu ihnen sagte: „Ich folge dem ehrenwerten Elijah Muhammad. Ich bin ein Muslim. Elijah Muhammad sagt, ich kann nicht für dieses Land kämpfen. Ich kann nicht einfach unschuldige Menschen töten, die mir nichts antun. Diese Menschen nennen mich nicht ‚Nigger‘. Ich kann dort nicht hinfahren und kämpfen. Ich werde es nicht tun.“
Darauf sagten unsere Eltern: „Wenn das deine Überzeugung ist, dann tu das, was du für richtig hältst. Geh und stehe deinen Mann. Wir stehen zu 100 Prozent hinter dir.“
Selbst heute noch übersehen viele Leute die Tatsache, dass unverhältnismäßig viele Afroamerikaner eingezogen wurden, um in Vietnam zu kämpfen. Das sorgte wiederum für einen anderen Konflikt: Da waren nun Menschen, die mit ihrem Gewissen kämpften, unsicher darüber, aus welchem Grund in Vietnam Krieg geführt wurde, doch viele von ihnen hatten Söhne, Onkel, Brüder und Väter, die zum Militär gingen, um gegen den Kommunismus zu kämpfen. Also gab es einige, die die Entscheidung meines Bruders unterstützten und sich gleichzeitig fragten, warum ihre Verwandten dienen mussten, und andere, die der Meinung waren, dass mein Bruder über dem Gesetz stehen solle.
Vor allem Mainstream-Amerika betrachtete Muhammad als einen Dummkopf, aber auch als einen vorlauten schwarzen Mann, der nicht wusste, wo sein Platz war. Er war gelegentlich der „Kentucky Clown“ genannt worden, oder die „Louisville Lippe“, doch nachdem er der Nation of Islam beigetreten war und seinen Namen auf Muhammad Ali geändert hatte, bekam die Kritik an ihm einen immer aggressiver werdenden Unterton. Nun, als er sich weigerte, mit gutem Beispiel voranzugehen und sich zum Militärdienst zu melden, wurde er zu einem öffentlich gehassten Sportler, vor dessen Tür die Kommentatoren und Zeitungsschreiber Schlange standen, um ihr Gift auf ihn zu spritzen.
HARTE ZEITEN
In der Zwischenzeit protestierte Muhammad weiter öffentlich, nachdem ihm die amerikanische Regierung seine Boxlizenz zwei Monate
nach seiner Weigerung, in den Vietnamkrieg einzurücken, entzogen hatte. Als Konsequenz daraus verschlechterte sich seine finanzielle Lage rapid, und schon bald steckte er in Geldnöten.
Niemand in den Vereinigten Staaten stellte ihm eine Boxlizenz aus. Und da die Behörden auch seinen Pass beschlagnahmt hatten, war es ihm auch nicht möglich, im Ausland zu boxen. Obwohl ihn die Nation of Islam in dieser düsteren Zeit finanziell unterstützte, war mein Bruder fest entschlossen, von selbst wieder auf die Beine zu kommen.
Ein Grund, warum ihn das zu diesem Zeitpunkt so hart traf, war, dass Muhammad gerade zum zweiten Mal geheiratet hatte. 1964 hatte er Sonji Roi, eine Cocktailkellnerin, die Herbert ihm nach unserer Reise nach Afrika vorgestellt hatte, geheiratet. Wir tourten damals durch Ghana und Ägypten, wo wir sogar von Präsident Nasser empfangen wurden. In Ghana wurden wir von Hunderten stürmischen Fans umringt, die alle so nahe wie möglich an Muhammad ran wollten, und Herbert rannte sogar davon, da er um sein Leben fürchtete. Anfangs war Sonji gar nicht so angetan von meinem Bruder. Sie konnte seine Angeberei einfach nicht ausstehen, ja, es törnte sie sogar eher ab. Doch Muhammad blieb hartnäckig und war ganz auf dieses junge hübsche Mädchen fixiert. Nach einer stürmischen Romanze von fünf Wochen traten sie am 14. August 1964 vor den Altar, und ein paar Tage später besuchten sie uns in Louisville, um unsere Eltern zu kennenzulernen.
Doch die Schwierigkeiten waren bereits vorprogrammiert. Eines der größten Probleme, das Muhammad mit seiner ersten Frau hatte, war, dass sie die Lehren des Islam in Bezug auf Moral strikt ablehnte. Ich erinnere mich, wie mein Bruder ihr immer wieder lautstark sagte, sie solle sich sittsam kleiden. Er sagte: „Du kannst nicht in diesen kurzen Kleidern herumlaufen.“
Mein Bruder hatte große Schwierigkeiten damit, dass seine Frau Miniröcke trug und viel Haut zeigte – es entsprach nicht unserer Religion. Er glaubte, er müsse ein Vorbild sein, und wenn seine Frau nicht mit gutem Beispiel voranginge, welche Botschaft würde das denn aussenden? Immer wieder gerieten Muhammad und Sonji deswegen aneinander, und sie sagte zu ihm, dass sie nicht dazu bereit sei, sich seinen Regeln unterzuordnen. Sie warf meinem Bruder vor, dass er denke, dass der Mann der „Herr im Haus sei“ und immer recht habe, und Muhammad konnte dem kaum widersprechen. Sonji stritt immer wieder mit meinem Bruder über das, was sie tat und wie sie sich anziehen sollte, aber ebenso, weil sie Elijah Muhammads Lehren permanent infrage stellte. Zwei Jahre nach ihrer Heirat ließen sie sich wieder scheiden, und mein Bruder nahm sich vor, dass seine nächste Ehefrau einen positiveren Einfluss auf sein Leben haben sollte.
Schließlich heiratete er im August 1967 die damals erst 17-jährige Belinda Boyd. Es war mehr oder weniger eine arrangierte Ehe. Muhammad musste die Zustimmung ihrer Eltern einholen, und die spielten eine wichtige Rolle. Mein Bruder lebte zu dieser Zeit im Süden Chicagos, in einem bescheidenen Haus, das Herbert ihm und seiner neuen Frau zur Verfügung gestellt hatte, während ich mir ein eigenes Quartier einige Blocks entfernt vom Heim meines Bruders mietete. Muhammad und Belinda hatten sich zum ersten Mal gesehen, als er 18 war und sie zehn. Zu dieser Zeit stattete er gerade der Muhammad University of Islam Number Two einen Besuch ab, einer muslimischen Schule in Chicago, die Belinda während seiner Tour nach dem Gewinn der Goldmedaille abschließen sollte.
„Ich werde noch vor meinem 21. Geburtstag Weltmeister im Schwergewicht sein“, erzählte er einer Gruppe von Schülern, zu denen auch sie gehörte. „Holt euch also eure Autogramme jetzt schon! Ich werde bald berühmt sein.“
Muhammad ging zu Belinda und sagte: „Hier, Kleine. Hier ist mein Autogramm. Eines Tages werde ich berühmt sein. Mein Name wird etwas wert sein.“
„Wie kannst du wissen, dass du das schaffst, bevor du 21 bist?“, fragte eine verwunderte Belinda, als sie das Stück Papier, das er ihr gegeben hatte, betrachtete. „Warte, dein Name ist Cassius Marcellus Clay? Weißt du überhaupt, was die Römer anderen Menschen angetan haben? Und du hast das Wort Clay in deinem Namen, das bedeutet Lehm, Erde, die man formen kann, und darauf bist du stolz?“
Das war wohl ein wenig zu viel für meinen Bruder. Bedenkt man, dass Belinda noch ein kleines Mädchen war, war sie bereits außerordentlich selbstbewusst und reif. Als sie nachlegte, suchte Muhammad noch immer nach einer Antwort.
„Bruder, ich sage dir etwas“, fuhr sie fort, riss das Papier in Stücke – und faszinierte meinen Bruder mit ihrer Schlagfertigkeit. „Wenn du mit mir reden willst, dann brauchst du einen Namen, der Respekt und Ehre ausstrahlt. Du brauchst einen muslimischen Namen. Dann können wir reden.“ Und sie drückte ihm das zerrissene Autogramm wieder in die Hand. „Das kannst du wieder mitnehmen.“
Sie erklärte ihm, dass an der muslimischen Schule, die sie besuchte, die Schüler die Geschichten der Kalifen lasen – Abū Bakar, Usman, Umar und Ali –, große Männer, die Helden waren und für ihre Religion gekämpft hatten.
„Du bist einer dieser Kalifen“, sagte sie zu meinem Bruder. „Du musst für den Islam kämpfen.“ Dann ging sie.
Muhammad war schwer irritiert. Niemand hatte bis jetzt so mit ihm gesprochen, schon gar nicht ein zehn Jahre altes Mädchen.
„Sie hat meinen Namen zerrissen. Sie hat mein Autogramm zerrissen“, murmelte er. „Wer ist sie?“
Die Antwort der Anwesenden kam prompt und war recht entmutigend.
„Leg dich nicht mit ihr an“, sagte man meinem Bruder. „Sie ist die Prinzessin des Islam. So nennt Elijah Muhammad sie. Und ihr Vater – besser du fragst gar nicht.“
Belindas Vater war ein Mann weniger Worte, doch wenn er dich streng ansah, wusstest du, dass er es ernst meinte. Abgesehen davon, hinterließ dieses junge Ding einen bleibenden Eindruck bei meinem Bruder. Irgendwann erfuhr er, wie alt sie war, und das erstaunte ihn.
„Erst zehn?!“, fragte er ungläubig.
„Ja“, war die Antwort. „Aber Muslime sind sehr gebildet und anderen Gleichaltrigen voraus.“
Kurz vor Muhammads Titelkampf, als Belinda ein Teenager war, entschloss sie sich dazu, selbst ein paar Nachforschungen über meinen Bruder zu betreiben. Sie begann damit, sich mehr mit seiner Boxkarriere auseinanderzusetzen, und las über seine Kämpfe und seine Leistungen bei den Olympischen Spielen. Zu dieser Zeit bereitete er sich gerade auf den Kampf mit Sonny Liston vor, und sein Gesicht war überall zu sehen. Sie sah, was Liston über die Black Muslims sagte, und hörte, wie mein Bruder sagte: „Ich werden den Typen plattmachen.“
Das dürfte sie dann doch beeindruckt haben, denke ich. Irgendwann setzte sie sich hin und verfasste ein Gedicht, das sie meinem Bruder letzten Endes zukommen ließ. Es lautete folgendermaßen:
This is the legend of Cassius Clay.
The most beautiful fighter today.
His fist fights are great he’s got speed and endurance.
But if you try to fight him it’ll increase your insurance.
This kid’s got a left, this kid’s got a right.
Look at him carry the fight.
All the crowd is getting frantic, there’s not enough room,
Cassius’ law of boom.
Who would have felt when they came to the fight
They’d see spooks set alight.
No one would have dreamed when they put down their money
They’d see a total eclipse of Sonny.
Als Belinda die Gelegenheit bekam, Muhammad ihr Gedicht zu geben, war er davon überwältigt.
„Du hast das für mich geschrieben?“, fragte er sie. „Ich liebe es. Du bist klug.“
Er verwendete Teile davon bei Interviews und legte damit den Grundstein für einige seiner berühmtesten Zitate, und nur ganz wenige Leute hätten vermutet, dass diese Zeilen von einer 13-Jährigen stammten.
Auf jeden Fall behielt mein Bruder Belinda im Auge und versuchte, sie immer zu treffen, wenn er gerade in Chicago war. Schlussendlich fand sie eine Anstellung in einer Bäckerei, wo er sie immer wieder aufsuchte, um mit ihr zu flirten und zu reden. Belinda bot ihm bei ihren Gesprächen immer wieder Paroli.
Schnell war Belinda zum Rückgrat ihrer Beziehung geworden. Sie bemerkte bald, dass Muhammad bei Weitem nicht so extrovertiert war, wenn sie allein waren. Er war ein sehr ruhiger Kerl. Belinda schaffte es, dass er begann, mehr aus sich herauszugehen, was auch sein Selbstvertrauen bis zu einem gewissen Grad stärkte. Langsam öffnete er sich. Sie spielte ihre Rolle sehr gut und zeigte ihm neue Aspekte im Leben und sagte ihm, dass, wenn es darauf ankam, er unbesiegbar sei. Wenn der Alltag ihn zu erdrücken drohte, dann erkannte sie das sofort und sagte zu ihm: „Du kannst das alles bewältigen. Du wirst eines Tages ganz groß rauskommen.“
Ihre Worte halfen ihm, sein Selbstwertgefühl hochzuhalten, als die äußeren Umstände ihn nach unten ziehen wollten. Belinda stellte sicher, dass er nicht den Mut verlor, und das war unheimlich wichtig für meinen Bruder, damit er diese harten Jahre durchstehen konnte.
Wie das Sprichwort sagt, so steht hinter jedem großen Mann eine große Frau, und mein Bruder hatte Glück, sie getroffen zu haben, auch wenn sie damals noch ein Mädchen war. Traurigerweise profitierte Belinda nie vom Schwergewichtsweltmeister, denn als sie heirateten, war Muhammad der Titel bereits aberkannt worden, und als er ihn wiederbekam, war ihre Beziehung gerade dabei, in die Brüche zu gehen.
Trotz allem, Muhammad hatte nun eine Frau zu ernähren, und er musste aus dem finanziellen Loch, in das er immer tiefer zu versinken drohte, herauskommen. Louis Farrakhan – ein hochrangiges Mitglied der Nation of Islam – hatte meinen Bruder für einige Zeit in seinem Haus wohnen lassen und sich um Sonji, seine erste Frau, gekümmert, als dieser für den Kampf mit Liston trainierte. Nun sponserte Farrakhan Muhammads und Belindas Flitterwochen, was zwar sehr großzügig war, jedoch nicht die finanziellen Probleme meines Bruders löste.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Muhammad 29 Profikämpfe bestritten, einschließlich neun Titelkämpfe. Aus diesen neun Titelkämpfen lag sein Anteil bei zwei Millionen US-Dollar brutto, nach Abzug aller anderen Ausgaben vom Manager bis zum Hausmeister. Doch Muhammad war damals noch unter Vertrag bei der Louisville Group, zehn weißen Herren, die ohne sein Wissen ein als „Joe Louis Gesetz“ bekanntes Arrangement mit der Regierung getroffen hatten, nach dem sie der Regierung 90 Prozent aller seiner Einnahmen zahlen würden, noch bevor Muhammad sein Geld bekam, damit er nicht bankrottging. Damit blieben meinem Bruder unterm Strich gerade einmal magere zehn Prozent seiner zwei Millionen Dollar, um zu leben. Davon bekam Sonji nach der Scheidung zwischen 150.000 und 200.000 Dollar zugesprochen, zusätzlich zu den 1200 an monatlichen Unterhaltszahlungen. Dann waren da noch die Anwaltskosten, die beglichen werden mussten. Diese beliefen sich auf damals gigantische 96.000 Dollar für die Anwälte, die ihn im Kampf gegen seinen erbittertsten Widersacher – die US-Regierung – vertreten hatten. Vom Rest musste er leben und seine Rechnungen bezahlen. Kein Wunder, dass so gut wie kein Geld mehr auf dem Konto war.
Es wäre nicht mein Bruder gewesen, wenn er nicht Witze über seine Lage gemacht hätte.
„Ich weiß nicht, warum die Leute sich darüber wundern, dass ein schwarzer Boxer einen finanziellen Engpass hat“, lachte er. „Sogar Amerika ist pleite. Amerika streicht sogar Reisen ins Ausland, um Geld zu sparen. Wenn also das große mächtige Amerika pleitegehen kann, dann ist es wohl keine Überraschung, wenn ein kleiner schwarzer Boxer pleitegeht.“
Man muss schon einen ganz besonderen Charakter haben, um sich den Humor in einer solchen Situation, in der sich mein Bruder befand, zu erhalten. Jemand, dessen Karriere am Höhepunkt abrupt unterbrochen wurde, gerade als er bereit war, das große Geld zu machen – in einem Sport, in dem er bereits als 12-Jähriger seine Berufung gefunden hatte.
Aber egal, wie schlecht die finanzielle Lage meines Bruders war, es schien ihn nicht davon abzuhalten, weiterhin Geld auszugeben. In einem Interview mit TV-Moderator Bud Collins erzählte er von seinen Plänen, sich ein Flugzeug zulegen zu wollen. Der einzige Grund für so einen Rieseneinkauf war, dass er durchs ganze Land reiste und immer unterwegs war. Man muss wissen, dass Muhammad, seit er Liston entthront hatte, Anfragen aus allen Teilen des Landes bekam, um Reden zu halten und aufzutreten, und die Zeit, die er im Auto verbrachte, zermürbte ihn langsam. Und nun überlegte der Mann, der bekannterweise beinahe die Olympiaqualifikation wegen seiner Flugangst verpasst hätte, ein eigenes Flugzeug zu erwerben. Der Interviewer war ganz erstaunt und meinte: „Ich möchte Ihnen nicht zu nahetreten, aber es kursieren gerade viele Geschichten, dass es Ihnen wie Joe Louis ergeht und Sie bankrott sind. Sie haben einerseits 280.000 Dollar Schulden und reden andererseits davon, sich einen Düsenjet zu kaufen.“
Wie immer hatte Muhammad eine Antwort parat. Man konnte ihn niemals aus der Fassung bringen, egal, ob man mit ihm begann zu philosophieren oder ob Journalisten versuchten, ihn zu grillen.
So antwortete er: „Ich sage leasen. Ich bin nur fast bankrott. Mir ist es untersagt, hier in Amerika meiner Arbeit nachzugehen, und ich darf das Land auch nicht verlassen. Ich bin nicht wie Joe Louis. Ich habe nicht 13 Jahre lang nicht geboxt.“
Zudem musste sich Muhammad mit jenen Leuten aus seinem engsten Umfeld auseinandersetzen, die sich an ihm bereichern wollten. So erhielten Herbert und die Nation of Islam je ein Drittel von Muhammads Gesamteinnahmen. Damit blieb meinem Bruder nur ein mageres Drittel. Interessanterweise wurden auch alle Ausgaben vom Drittel meines Bruders abgezogen.
Und es gab viele Ausgaben, glauben Sie mir. Ich kann mich zwar nicht mehr an das damalige Spesenbudget erinnern, aber später, in den 1970er-Jahren, war ein Budget von 100.000 Dollar für ein Trainingscamp die Norm, und meist lag es sogar noch darüber. Der Anteil für das Management war einfach unerhört hoch und ungerecht, doch Muhammad hatte bereitwillig etwas unterschrieben, was jeder Mensch mit einem gesunden Hausverstand sofort als richtig schlechtes Geschäft identifiziert hätte. Das Problem war, dass mein Bruder alles tat, was Herbert von ihm wollte, wenn es ums Geschäft ging. Vom ersten Tag an hatte es Herbert geschafft, dass mein Bruder ihm aus der Hand fraß, und er sah ihn einerseits als Ware, andererseits aber auch als Freund. Das war nicht nur absolut inakzeptabel für all jene, denen Muhammad wirklich am Herzen lag – es war einfach verrückt. Als einige Personen Herbert fragten, warum Muhammad von einem Preisgeld von sechs Millionen Dollar nur vier bekam, obwohl er kämpfte, und er als Manager zwei Millionen in einer Nacht, obwohl er nie einen Kampf bestreiten musste, meinte Herbert: „Ich sagte, es wäre ein Teil des Vertrags, und wir haben uns darauf geeinigt. Vielleicht meinen die Leute: ‚Ja, aber der Anteil ist zu hoch für dich.‘ Alle um ihn herum haben das gesagt, aber das war eben, was wir abgemacht haben.“
Unsere Familie beschwerte sich oft darüber, dass Herbert den Vertrag nie neu überarbeitete, damit die Finanzen fairer aufgeteilt wurden.
Um ehrlich zu sein, ich denke, man kann sagen, dass das Management meines Bruders ihn übervorteilte, und dieses Problem sollte sich durch seine gesamte Karriere ziehen. Muhammad war zwar der bekannteste Sportler seiner Zeit, doch es waren die anderen um ihn herum, die größtenteils von seinen Einnahmen profitierten. Er boxte, damit sich die anderen bereichern konnten. Mein Bruder verstand damals nicht wirklich was von Geld. Ich erinnere mich an Zeiten, in denen er es nicht einmal zur Bank trug, da er fürchtete, dass sein Geld im Falle eines Bankraubs weg wäre. Stattdessen nahm er das Geld und versteckte es hier und dort und dachte, es wäre so sicherer als auf der Bank. Er meinte, ein Koffer voll mit Bargeld, sagen wir 50.000 Dollar, wäre mehr wert als ein Scheck über 100.000 Dollar. Für ihn war ein Scheck nur ein Stück Papier. So dachte er eben damals über Geld.

Als die finanzielle Situation meines Bruders vollkommen außer Kontrolle zu geraten drohte, hatten seine Partner schließlich die Idee, ihn auf eine Vortragstour durch die amerikanischen Colleges zu schicken. Das bedeutete, dass er von College zu College fuhr und dort Reden und Vorträge hielt, für die er Geld bekam. In jenen Tagen waren solche Tischreden eine lukrative Einkommensquelle für Sportler, die ihre Karriere beendet hatten, doch für meinen Bruder, der sich ja eigentlich am Höhepunkt seiner Boxkarriere befinden hätte sollen, war es der einzige Weg, um ein finanzielles Desaster abzuwenden und seine Familie zu ernähren.
Am Anfang tat sich Muhammad sehr schwer, bei solchen Veranstaltungen zu reden. Zu dieser Zeit hatte er sich schon öffentlich gegen den Vietnamkrieg ausgesprochen, der natürlich ein großes Thema auf jedem Collegecampus war, und so war er anfangs ein willkommener Gast, da die meisten Studenten seine Meinung über den Krieg teilten, der immer mehr als ungerechtfertigt betrachtet wurde. Doch er wiederholte auch das muslimische Dogma, mit dem nur sehr wenige Leute im Publikum etwas anfangen konnten, selbst auf den liberaleren Colleges. So begann er zum Beispiel, abwertende Bemerkungen über das Rauchen von Marihuana zu machen, und man kann sich vorstellen, dass dies in den frühen 60er-Jahren nicht gerade gut bei den liberalen Studenten ankam. Er sprach über Religion, was sein Publikum, das sicherlich atheistischer war als der Rest Amerikas, noch weiter abschreckte. Womit er jedoch sein Publikum komplett vor den Kopf stieß, waren seine Angriffe auf die Ehe zwischen Farbigen und Weißen. Entgegen allen Vorurteilen, die damals existierten, gab es viele solcher Paare, und die Leute, vor denen Muhammad seine Vorträge hielt, waren diesen gemischten Paaren gegenüber weitaus toleranter als die Durchschnittsbevölkerung. Und jetzt sahen sie sich mit dem Weltmeister im Schwergewicht konfrontiert, der ihnen sagte, dass dies gegen seine Religion sei.
Der Vortrag, der mir am deutlichsten im Gedächtnis blieb, fand ziemlich am Anfang seiner Vortragstournee in Berkeley statt. Muhammad hielt seine Rede auf einem großen Platz. Tausende Leute waren gekommen, um ihn zu hören. Er schockte das Publikum gleich von Beginn an, indem er sich sofort in eine Reihe von Moralplattitüden hineinsteigerte. Er sei stolz darauf, schwarz zu sein und gut auszusehen, sagte er und war von der Anzahl der vielen gemischten Paare im Publikum schockiert. An dieser Stelle stand ein Großteil der Leute auf und verließ den Platz. Ein etwas verdutzter Muhammad machte eine Show daraus, aus seiner Flasche zu trinken, damit er sich eine kleine Nachdenkpause verschaffen konnte, während der weitere Menschen das Gelände verließen.
Darauf hielt Muhammad einen Vortrag über den Koran und sprach darüber, wie wichtig es sei, dass man „die roten Vögel mit den roten Vögeln“ halten müsse und „die blauen Vögel mit den blauen Vögeln“, was nur noch weitere Zuhörer vertrieb.
Ich glaube, es dauerte nicht lange, bis mein Bruder erkannte, dass dies so nicht funktionierte. Diese Studenten hatten sich wirklich gefreut, ihren Helden persönlich zu sehen, doch als er sie dann offen attackierte, fühlten sich die meisten vor den Kopf gestoßen. Es war nicht so, dass alle gegangen wären – oder die meisten –, doch der Effekt war deutlich merkbar und peinlich für meinen Bruder, auch wenn er zu denen, die dageblieben waren, weitersprach. Nach seiner Rede sprach der Sportjournalist Robert Lipsyte mit Muhammad über seine abschätzigen Bemerkungen, doch mein Bruder leugnete, dass das Publikum Vorbehalte hatte. Er sei zu stark, erzählte er Lipsyte, und seine Botschaft sei zu mächtig, weswegen sie jenseits der Aufnahmefähigkeit des Publikums liege. Lipsyte widersprach meinem Bruder. Es sei deutlich zu sehen gewesen, dass sich niemand dafür interessierte, was Muhammad über Rassentrennung zu sagen hatte oder darüber, dass man kein Gras rauchen sollte, meinte er. Man muss bedenken, dass dies alles zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung stattfand und viele dieser jungen Leute sich sehr für die Integration der farbigen Bevölkerung engagierten. Für sie stand Muhammad mit solchen Ansichten auf der falschen Seite. Er machte sich damit nicht gerade beliebt beim Publikum.
Im Nachhinein verstand Muhammad, dass sein Stil als Redner am Anfang ein Desaster gewesen war, auch wenn er sich nicht selbst dafür die Schuld geben wollte. Er blieb bei seiner Ausrede – die Anwesenden könnten damit nicht umgehen. Er hätte niemals zugegeben, dass er einfach schlecht war, sondern behauptete lieber, dass die Kraft der Worte das Publikum überforderte. Man konnte meinen Bruder nicht mit Worten besiegen – er war so energisch in seinem Kampf, seine Prinzipien, und alles, woran er glaubte, hochzuhalten –, doch nach einigen weiteren Auftritten fing er an, zu akzeptieren, dass er sich zumindest andere Meinungen anhören sollte. Er begann damit, nach seinen Reden Fragen anzunehmen. Somit hatten die Studenten Gelegenheit, seine Standpunkte infrage zu stellen. Dies führte natürlich öfters zu Konflikten, aber es spiegelte im Endeffekt nur das wider, was in der Welt vor sich ging, und schlussendlich eröffnete es meinem Bruder Ansichten, die er vielleicht niemals bedacht hätte. Nun begann er auch für seine Reden zu üben. Zuerst schrieb Belinda viele seiner Reden auf weiße Kärtchen, so dass er sie davon ablesen konnte, bis er sicher genug war, seine Botschaft ohne Hilfsmittel zu verbreiten.
Anfangs war es ein langwieriger und schmerzvoller Prozess. Doch mit der Zeit und wachsendem Selbstvertrauen ließ er die Karten weg und sprach frei, was auch leichter und natürlicher für ihn war. Je wohler er sich in seiner Rolle fühlte, umso mehr Humor brachte er mit ein. Er sprach darüber, wie schön Schwarz sei, fragte, warum Engel immer weiß und Dämonen immer schwarz dargestellt würden. So vermittelte er seine Meinung über Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, aber in einer Weise, mit der die Zuhörer etwas anfangen konnten.
Als dann die schlechten Zeiten beinahe vorüber waren, war er zu einem fesselnden Campusredner geworden, der seinen Ali Shuffle vorführte und Witze erzählte, während er seine eher extremeren Ansichten stark zurücknahm oder sogar ganz darauf verzichtete. Er war immer ein Entertainer, doch glaube ich, dass seine Vorträge am College eine gute Schule für seine Rhetorik waren, was ihm schlussendlich bei Pressekonferenzen und Publicitytouren in den folgenden Jahren helfen sollte.

Ein weiterer Aspekt der Vorträge meines Bruders, der sich schon bald bezahlt machte, war, dass er die Gelegenheit bekam, seine Reime zu perfektionieren. Er verwendete oft Reime, wenn er zu Studenten sprach, die er niederschrieb, während er von College zu College fuhr. Einmal wurde er sogar von der Oxford University eingeladen, um dort Lyrik zu lehren – doch irgendwie kam das Ganze dann doch nicht zustande. Er hielt jedoch einen Vortrag an der Harvard University, wo er mit stehenden Ovationen bedacht wurde. Und obwohl Belinda ihm mit seinen Reimen am Anfang immer geholfen hatte, lernte er über die Jahre eine andere Dichterin besser kennen – die Fernsehpersönlichkeit und Aktivistin Nikki Giovanni.
Als mein Bruder Giovanni zum ersten Mal begegnete, stand sie am Anfang ihrer Karriere und reiste viel herum. Sie nahm immer das Flugzeug, was einfach praktischer war für die langen Distanzen, die sie zurücklegen musste. Belinda, die sich sehr wohl über Muhammads Neigung für außereheliche Aktivitäten im Klaren war, wusste, dass sie dieser speziellen Freundin Muhammads trauen konnte, und sie war dankbar dafür. Es war schon etwas eigenartig, wenn Belinda Giovanni fragte: „Wie war die Reise?“ Und Giovanni antwortete: „Wunderbar.“
Nicht dass Muhammad und Giovanni oft in Versuchung kommen hätten können, weil sie beide ja unterschiedliche Transportmittel benutzten. Muhammad fuhr allein mit seinem Bus, den er besaß, und er hatte seinen eigenen Fahrer, während seine Freundin das Flugzeug nahm. Muhammad hasste es, zu fliegen, auch noch zu dieser Zeit. Es stimmt übrigens, dass mein Bruder in einem Armeeladen einen Fallschirm kaufte und ihn trug, als er das erste Mal über den großen Teich zu den Olympischen Spielen in Rom flog. Schon nach den Auswahlkämpfen für die Olympischen Spiele hätte mein Bruder von San Francisco zurück nach Louisville fliegen sollen, doch er weigerte sich, ins Flugzeug zu steigen. Stattdessen bat er seinen Trainer Joe Martin, ihm etwas Geld zu leihen, damit er mit dem Zug heimfahren könnte. Muhammad wurde gesagt, er solle entweder fliegen oder er müsse den Weg zurücklaufen. Dickköpfig wie mein Bruder nun einmal war, ging er seinen eigenen Weg. Das Flugzeug flog ohne ihn ab. Glücklicherweise besaß er eine Armbanduhr, die er versetzen konnte, um das Geld für ein Zugticket zusammenzubekommen. Ich bin froh, dass er es nach Hause geschafft hat.