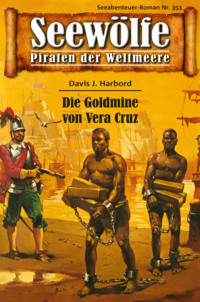Read the book: «Seewölfe - Piraten der Weltmeere 353»
David J. Harbord
Die Goldmine von Vera Cruz
Impressum
© 1976/2017 Pabel-Moewig Verlag KG,
Pabel ebook, Rastatt.
eISBN: 978-3-95439-750-1
Internet: www.vpm.de und E-Mail: info@vpm.de
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
1.
23. September 1593, Punta Roca Partida bei Vera Cruz.
Am Mittag dieses Tages begann für Don Julio Costa Cordes der Ärger. Welche Konsequenzen sich daraus ergeben würden, konnte Don Julio zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen.
Bei Punta Roca Partida am Golf von Campeche an der Ostküste Mexikos hatten die Spanier vor zwei Jahren eine Goldmine in Betrieb genommen, aus der sie recht beträchtliche Mengen des begehrten Metalls abbauten.
Wie überall in der Neuen Welt wurden in dieser Mine nicht etwa eigene Arbeitskräfte aus dem Heimatland eingesetzt, sondern man bediente sich der billigen Sklaven, die man zwangsrekrutiert hatte. In der Goldmine von Punta Roca Partida schufteten an die achtzig schwarze und an die hundert Indianersklaven.
Diese unfreiwilligen Minenarbeiter wurden von drei Dutzend spanischen Soldaten bewacht und beaufsichtigt, die wiederum dem Befehl des Lagerkommandanten – Don Julio Costa Cordes – unterstanden.
Dieser Don Julio war ein harter, nüchtern denkender Mann, der seine Pflicht tat und sich in jeder Weise korrekt verhielt. Man konnte ihn als die berühmte Ausnahme von der Regel bezeichnen. Er war nicht korrupt, zweigte von dem Gold nichts für sich ab, sah in dieser Beziehung auch seinen Soldaten scharf auf die Finger, duldete keine Mißhandlungen der farbigen Minenarbeiter und sorgte dafür, daß sie gut und reichlich verpflegt wurden.
Das abgebaute Edelmetall wurde in einer eigens für diesen Zweck eingerichteten Gießerei bei der Mine in Barren gegossen, mit dem Prägestempel der Casa de Contratación versehen und bis zum Abtransport sicher verwahrt. In der Regel wurden die Goldbarren nach Havanna verschifft und von dort mit dem nächsten Konvoi nach Spanien gebracht.
Zur Zeit ging es ein bißchen hektisch in und bei der Mine zu, weil von Havanna Nachricht eingetroffen war, daß man noch vor Ende September eine Frachtgaleone schicken werde, um eine Ladung Goldbarren zu übernehmen. Und der Vertreter der „Casa“ in Havanna hatte bei dieser Nachricht durchblicken lassen, daß man in Spanien auf weitere Lieferungen dränge, was, durch die Blume gesprochen, für Don Julio bedeutete, er möge gefälligst mit dem Goldabbau ’ranklotzen und zusehen, soviel wie möglich aus der Mine herauszuholen.
Tatsächlich wurde dem Lagerkommandanten gegen Mittag des 23. September eine von Westen heransegelnde Galeone gemeldet, und Don Julio Costa Cordes meinte, es könnte sich bei dem gemeldeten Schiff um die angekündigte Frachtgaleone aus Havanna handeln, obwohl es üblich war, daß solche Galeonen unter Geleitschutz fuhren.
Eine halbe Stunde später wurde die Meldung dahin berichtigt, daß es sich bei dem Schiff um eine spanische Kriegsgaleone handele, die von dem Ausguck als „mächtig gerupft“ beschrieben wurde.
Don Julio stieg daraufhin selbst auf das Plateau, von dem aus man eine hervorragende Sicht über den Golf von Campeche hatte. Durch ein Spektiv betrachtete er die Galeone und mußte dem Ausguck recht geben. Wie es schien, war sie offenbar in den Hurrikan geraten, der vor ein paar Tagen quer über den Golf von Mexiko westwärts getobt war.
Bildlich gesprochen hinkte die Kriegsgaleone in die Bucht von Punta Roca Partida und schlich sich an die steinerne Pier des nicht sehr großen Hafens. Dort wurde sie vertäut.
Don Julio eilte zum Hafen hinunter. Aus der Nähe sah die Galeone – sie hieß „Santa Rosa“ – noch übler aus: zerschmetterte Schanzkleider, zersplitterte Rahen, demolierte Niedergänge, gebrochenes Tauwerk! Da hatte der Hurrikan ganz schön zugeschlagen.
Eine Behelfsstelling wurde an Land gewuchtet. Vom Achterdeck kletterte ein Mann hinunter, überquerte die Kuhl, wo man respektvoll zur Seite trat, und ging über die Stelling an Land.
Auf Don Julio wirkte dieser Mann ziemlich herrisch. Wohl der Kommandant, dachte Don Julio. Und so war es auch.
Harte Augen in einem Schnauzbartgesicht starrten ihn durchbohrend an. Eine befehlsgewohnte Stimme schnarrte: „Sind Sie der Kommandant hier?“
Don Julio nickte und stellte sich vor. Seinerseits erfuhr er, daß er es mit Don Francisco de Albrandes, Kapitän der „Santa Rosa“, zu tun habe. „Bin auf der Fahrt von Havanna nach Santa Cruz unterwegs“, erklärte der Kapitän von oben herab, zwirbelte seinen Schnauzbart und fuhr fort: „Segele mit Sondervollmachten der Admiralität und der ‚Casa‘, die besagen, daß man mir seitens der spanischen Stützpunkte jede von mir geforderte Hilfe zu leisten hat. Verstanden?“
„Um was handelt es sich?“ fragte Don Julio kühl. „Das hier ist eine Mine, die im Auftrag der spanischen Krone arbeitet, aber für Schiffsreparaturen sind wir nicht eingerichtet, Señor Capitán Sie haben Sturmschäden, nicht wahr?“
„Unwichtig“, sagte Don Francisco schroff. „Die gröbsten Schäden haben wir bereits mit Bordmitteln behoben, und wir werden es auch bis Vera Cruz schaffen. Aber ich habe eine Menge Leute verloren, die ersetzt werden müssen.“ Er blickte sich um. „Wie ich sehe, sind hier Soldaten von uns stationiert. Von denen werden Sie mir zwanzig Mann zur Verfügung stellen. Wenn wir Vera Cruz erreicht haben, können die zwanzig Mann wieder zu Ihnen zurückgeschickt werden.“
„Zwanzig Mann?“ fragte Don Julio entsetzt. „Ich habe hier für die Bewachung von einhundertachtzig farbigen Minenarbeitern insgesamt sechsunddreißig Soldaten, Señor Capitán. Wenn Sie mir zwanzig Mann wegnehmen, bleiben ganze sechzehn für die Bewachung übrig! Das ist zu wenig – die bisherigen sechsunddreißig sind schon zu wenig. Hinzu kommt, daß wir nach einer kürzlich hier eingetroffenen Order der ‚Casa‘ aus Havanna mit Hochdruck arbeiten müssen, um das geforderte Soll zu erfüllen. Denn in diesen Tagen soll die Ausbeute abgeholt werden …“
„Was meinen Sie wohl, wie wenig mich das interessiert“, unterbrach ihn der Capitán gelangweilt.
„Sie vielleicht“, sagte Don Julio erbittert, „aber nicht die ‚Casa‘ und nicht die spanische Krone, die mich hier als Kommandanten eingesetzt haben und erwarten, daß ich meine Pflicht tue und das geforderte Soll erfülle. Ich kann keine zwanzig Soldaten entbehren – ich kann nicht einen entbehren! Sollte ein Aufstand in der Mine ausbrechen, wären wir rettungslos geliefert. Hier wird Gold abgebaut, Capitán! Kein Sand oder Kies!“
„Ah! Wie schön für Sie, mein Lieber“, sagte der Capitán höhnisch.
„Wie darf ich das verstehen?“
Der Capitán klopfte Don Julio auf die Schulter. „Warum so erregt, Señor Commandante? Ich wünschte mir auch so ein feines Pöstchen an Land, könnte die Goldbarren zählen und vielleicht mal einen übersehen, der dann nicht die weite Reise nach Spanien antritt, nicht wahr?“
Don Julio wurde fast weiß vor Wut. Immerhin war er ein Mann von Ehre, der die spanische Krone und die „Casa“ noch nie auch nur um ein Krümelchen Goldstaub betrogen hatte. Und jetzt wagte dieser schnauzbärtige, arrogante Capitán, darauf anzuspielen, daß er Goldbarren unterschlage!
Aber er zahlte die versteckte Beleidigung zurück. Er sagte: „Ihre Auffassung über die Tätigkeit des Kommandanten einer Goldmine scheint Ihrem eigenen Wunsch zu entsprechen, sich privat bereichern und die Krone betrügen zu wollen. Meiner Auffassung entspricht sie jedenfalls nicht. Daß ein spanischer Seeoffizier und Kommandant einer Galeone Seiner Majestät sie äußert, wirft kein sehr gutes Licht auf Ihr Offizierscorps, Señor Capitán!“
Don Francisco verlor nun doch etwas von seiner arroganten Haltung.
„Werden Sie nicht unverschämt, Mann!“ zischte er. „Verbitte mir derartige Äußerungen, verstanden?“
„Gern“, erwiderte Don Julio ruhig, „nur sollten Sie mit Ihren Äußerungen vorsichtiger sein. Ich lasse mir nicht etwas unterstellen, was Sie vielleicht tun würden, wenn Sie hier der Kommandant wären. Sie haben meine Antwort herausgefordert …“
„Zur Sache!“ schnarrte der Capitán. „Ich fordere zwanzig Mann, und die werden Sie mir sofort zur Verfügung stellen.“
„Dazu müßte ich erst einmal Ihre Sondervollmacht sehen, von der Sie sprechen“, sagte Don Julio eisig. „Im übrigen sind es von hier bis Vera Cruz nur noch an die sechzig Meilen. Wenn Sie den Hurrikan bis hierher geschafft haben, wird Ihre Mannschaft wohl auch noch den kleinen Rest bis Vera Cruz bewältigen, zumal sich das Wetter längst beruhigt hat.“
„Das zu beurteilen, überlassen Sie gefälligst mir!“ fauchte der Capitán. „Ich brauche auch keine Seeleute, sondern Soldaten, und zwar zur Bewachung von Gefangenen, verstanden?“
„Bin ja nicht taub“, erwiderte Don Julio frostig. „Wie viele Gefangene sind denn zu bewachen?“
„Das geht Sie nichts an!“
„Schätze doch“, sagte Don Julio. „Wenn mir über die Hälfte meines Wachpersonals weggenommen wird, ist die Sicherheit der Mine nicht mehr garantiert. Sechzehn Soldaten können nicht rund um die Uhr einhundertachtzig Minenarbeiter überwachen. Das ist ein Unding. Darum muß die Frage gestattet sein, wie viele Gefangene von den zwanzig Soldaten bewacht werden sollen, die Sie von mir fordern – und das auch noch auf der kurzen Strecke bis Vera Cruz!“
„Das ist ein geheimer Auftrag!“ schnarrte der Capitán. „Ich bin Ihnen darauf keine Antwort schuldig. Ich verlange die zwanzig Soldaten. Das ist ein Befehl!“
„Dann will ich Ihre Sondervollmacht sehen“, sagte Don Julio verbissen.
Wutentbrannt riß der Capitán eine Pergamentrolle aus dem Wams.
„Hier!“ schnauzte er. Es fehlte nicht viel, und er hätte das Schriftstück Don Julio vor die Füße geworfen.
Er nahm es entgegen, entrollte es, las es durch und mußte erkennen, daß er keine Möglichkeit hatte, die Forderung des Capitáns abzulehnen. Die Order war eindeutig. Er hatte zu gehorchen. Leider stand die Anzahl der Gefangenen nicht in dem Schriftstück. Da war nur von „Gefangenen“ die Rede, die als „staatsgefährlich“ bezeichnet wurden und nach Vera Cruz überstellt werden sollten, um dort unter dem direkten Vorsitz des Vizekönigs von Neuspanien abgeurteilt zu werden.
Vielleicht hätte Don Julio die Kühnheit aufgebracht, sich dem Befehl des Capitáns dennoch zu widersetzen, wenn er gewußt hätte, daß es sich um ganze drei Gefangene handelte, für die zwanzig Soldaten zur Bewachung weiß Gott zu viele waren. Zwanzig Soldaten für drei Gefangene – und sechzehn Soldaten für einhundertachtzig farbige Minenarbeiter! Fürwahr – ein eklatantes Mißverhältnis!
Aber diese Zahl von drei Gefangenen verschwieg der Capitán wohlweislich und redete sich auf einen „geheimen, Auftrag“ hinaus, wobei ihm allerdings klar sein mußte, daß er mit seiner überhöhten Forderung den Kommandanten der Mine in eine gefährliche Lage brachte, ja, in eine unter Umständen tödliche Gefahr. Aber das interessierte den Capitán nicht. Mochte dieser lächerliche Kommandant doch zusehen, wie er seine Mine bewachte!
Don Julio gab noch nicht auf. Er reichte das Schriftstück zurück und sagte: „Wäre Ihnen nicht auch mit zehn Soldaten gedient, Señor Capitán?“
„Nein!“
„Oder fünfzehn?“
Der Capitán kostete seine Macht aus. „Ich denke gar nicht daran, zwanzig Soldaten und keinen weniger. Ich bin es auch nicht gewohnt, daß über meine Befehle debattiert wird.“ Er winkte lässig mit der rechten Hand. „Also, lassen Sie Ihre Truppe hier antreten, ich suche mir die zwanzig Mann selbst heraus!“
Das war eine weitere Unverschämtheit. Dem Kommandanten Don Julio Costa Cordes lief die Galle über.
„Das wird wohl nicht möglich sein“, sagte er zornig. „Zur Zeit sind achtzehn Soldaten damit beschäftigt, die Minenarbeiter zu bewachen. Wenn ich diese Bewachung jetzt abziehe, sind die Minenarbeiter ohne Aufsicht. Ich weise Sie darauf hin, daß alle diese Leute nicht freiwillig in der Mine arbeiten. Ich würde die Kerle also geradezu auffordern, auszubrechen. Was dann von Ihnen und Ihrer Galeone übrigbleibt, können Sie sich wohl selbst ausrechnen. Offenbar haben Sie die Absicht, mich zu schikanieren. Aber das lasse ich mir nicht bieten. Hier dürfte Ihren Sondervollmachten eine Grenze gesetzt sein. Meine Truppe wird nicht antreten. Wenn Ihnen das nicht paßt, dann segeln Sie weiter. Unsinnige Befehle führe ich nicht aus, dafür bin ich auch bereit, mich vor dem Vizekönig zu verantworten.“
„Spielen Sie sich nicht auf, Mann“, sagte der Capitán herablassend. „Sie brauchen Ihre paar Gefangenen oder Minenarbeiter nur für eine halbe Stunde einzusperren, und damit ist die Sache erledigt.“
Ihre „paar Gefangenen oder Minenarbeiter“! Die Überheblichkeit dieses Capitáns war kaum noch zu überbieten.
„Tun Sie das doch mit Ihren geheimnisvollen Gefangenen, Capitán“, sagte Don Julio grimmig. „Und wenn Sie die Kerle zusätzlich in Ketten legen lassen und in der Vorpiek einsperren, brauchen Sie vorm Schott lediglich einen Posten. Oder hat Ihre Galeone keine Vorpiek? Das wäre das erste spanische Kriegsschiff, in dem die Schiffsbauer einen solchen Raum vergessen hätten!“
„Ich sagte, daß ich es nicht gewohnt sei, über meine Befehle zu debattieren“, erwiderte der Capitán scharf.
„Und ich sagte, daß ich meine Truppe hier nicht antreten lasse“, erklärte Don Julio genauso scharf. „Da beißen Sie bei mir auf Granit, auch wenn Sie sich einbilden, einem kleinen Stützpunktkommandanten auf der Nase herumtanzen zu können!“
„Ich werde eine Beschwerde über Ihr disziplinwidriges Verhalten dem Vizekönig in Vera Cruz überreichen!“ schnarrte der Capitán.
„Einen besseren Gefallen können Sie mir gar nicht tun“, erklärte Don Julio ungerührt. „Denn damit demaskieren Sie sich selbst – vorausgesetzt, Sie bleiben bei der Wahrheit. Ich jedenfalls werde sofort ein Protokoll über Ihr anmaßendes Auftreten in meinem Stützpunkt anfertigen, das der Wahrheit entspricht.“ Er wandte sich zu dem Sargento um, der ihn zur Pier begleitet hatte. „Sie waren Zeuge, Sargento!“
„Und ob, Señor Commandante“, erwiderte der Sargento. „Mit vergnügen werde ich bestätigen, daß der Capitán der ‚Santa Rosa‘ Ihre sachlichen Vorbehalte ignoriert und durch den Abzug von zwanzig Soldaten die militärische Sicherheit des Stützpunktes in gefährlicher Weise geschmälert hat. Wenn hier etwas passiert, wird sich der Capitán dafür verantworten müssen. Sie haben ihn gewarnt.“
„Bringen Sie die zwanzig Soldaten her!“ brüllte der Capitán. „Ich habe es nicht nötig, mir das Geschwätz eines Sargento abzuhören.“
„Auch das wird in dem Protokoll stehen“, sagte Don Julio trocken. Immerhin hatte er erreicht, daß der Capitán nicht mehr darauf bestand, die Truppe antreten zu lassen und sich die zwanzig Soldaten selbst herauszusuchen. Er nickte dem Sargento zu. „Mustern Sie die zwanzig Mann aus.“
„In zehn Minuten haben die Kerle hier zu stehen!“ schnappte der Capitán.
Der Sargento zuckte nur mit den Schultern, grüßte exakt und stieg zum Stützpunkt hoch.
„Das werden Sie noch bereuen!“ zischte der Capitán.
„Oder Sie“, erwiderte Don Julio eisig. „Ich verlange, daß die zwanzig Soldaten nach Ankunft in Vera Cruz auf dem schnellsten Wege hierher zurückgeschickt werden.“
„Sie haben gar nichts zu verlangen, Sie kleiner Hampelmann!“ Grußlos drehte sich der Capitán um, ging zurück an Bord und ließ Don Julio einfach stehen. Der biß die Zähne zusammen und schwor sich, dem Vizekönig eine geharnischte Beschwerde zu schicken. Dieser Capitán Don Francisco de Albrandes hatte seine Kompetenzen weit überschritten, das stand fest. Dazu war er auch noch beleidigend geworden. Don Julio Costa Cordes war nicht der Mann, sich so etwas bieten zu lassen.
Erst zwanzig Minuten später rückten die zwanzig Soldaten an, nicht sonderlich eilig und auch nicht besonders entzückt, den Stützpunkt verlassen zu müssen, um auf einer vom Hurrikan zerzausten Kriegsgaleone als Gefangenenwärter Dienst zu tun. Sie gehörten zur Landtruppe und waren keine Seesoldaten. Daher schmeckte ihnen dieses Kommando überhaupt nicht, und das war ihnen anzusehen.
Don Julio vergatterte sie, daß sie nach Erledigung ihrer Aufgabe sofort zum Stützpunkt zurückzukehren hätten, und ernannte einen älteren Soldaten zum diensttuenden Sargento.
Die zwanzig Soldaten marschierten mit ihrem Gepäck an Bord. Kurz darauf wurden die Stelling eingeholt und die Leinen gelöst, und die „Santa Rosa“ verließ den Hafen von Punta Roca Partida mit Kurs auf Vera Cruz.
„Und wie sollen wir jetzt unsere Minenarbeiter bewachen?“ fragte der Sargento. „Ich habe – mich abgerechnet – alle restlichen fünfzehn Mann zur Zeit eingesetzt.“
„Wenn ich das wüßte, wäre mir wohler“, erwiderte Don Julio düster.
„Dieser Capitán – mit Verlaub – ist total übergeschnappt“, sagte der Sargento erbittert.
„Wem sagen Sie das“, murmelte Don Julio.
Wie gesagt, mit diesem Abzug von zwanzig Soldaten der Wachmannschaft am Mittag des 23. September begann der Ärger für Don Julio Costa Cordes. Es war erst der Anfang. Allerdings erfolgte der nächste Schlag von einer ganz anderen Seite, und es waren auch nicht die einhundertachtzig farbigen Arbeitssklaven, von denen die Gunst der Stunde zu einem Aufstand genutzt wurde.
2.
Von den einhundertachtzig Minenarbeitern, die zur Zeit in der spanischen Goldmine von Punta Roca Partida im Schweiße ihres Angesichts schufteten, ahnte nicht ein einziger, was sich an diesem Mittag unten im Hafen abgespielt hatte. Und Don Julio gab an den Rest seiner Soldaten auch den Befehl aus, den Abzug der zwanzig Kameraden vor den Minenarbeitern streng geheimzuhalten.
Dennoch waren die Vorgänge gegen Mittag am Hafen aufmerksam beobachtet worden.
Die beiden Männer lagen bereits seit dem Vormittag in guter Deckung zwischen den Felsen, von denen das Lager und die Mine auf der Landseite umgeben waren. Hier war ein Bergland vulkanischen Ursprungs, das sich bis an den Golf von Campecke heranschob. An der Küste ragten also Steilfelsen auf, durchbrochen von Buchten und fjordartigen Kesseln.
Die beiden Männer lagen auf der nordwestlichen Seite der Mine, und zwar in überhöhter Deckung, so daß sie von oben einen guten Überblick hatten. Außerdem waren sie mit Spektiven ausgerüstet. So war ihnen nichts entgangen. Sie hatten die heransegelnde Galeone bemerkt, waren Augenzeugen des Disputs unten im Hafen geworden, hatten gesehen, wie die zwanzig Soldaten an Bord der Galeone marschierten und wie die Galeone dann an der Küste entlang nach Nordwesten segelte.
Daß der spanische Kommandant und sein Sargento sauer waren, hatten sie ebenfalls registriert – ebenso wie den erregten Wortwechsel zwischen dem Kommandanten der Galeone und dem Lagerkommandanten.
Als die Galeone nach Nordwesten abzog, grinsten sie sich beide an. In diesem Moment ähnelten sie zwei Wölfen, die sich ihrer Beute sicher sind.
Sie waren Wölfe – Küstenwölfe.
Sie waren sogar die Rudelführer einer vierzigköpfigen Meute, die im Golf von Campeche bis hinüber nach Cuba dem Handwerk der Piraterie nachging, in diesem Falle aber den ganz großen Coup hier bei der Goldmine von Punta Roca Partida landen wollte.
Vor ein paar Wochen waren sie mit ihrem 300-Tonnen-Dreimaster „Vergulde Sonne“ an dieser Küste entlanggesegelt und hatten aus reinem Zufall die Minenanlage entdeckt. Da waren sie stutzig geworden. Daß hier eine Mine der Spanier liegen sollte, war ihnen bisher unbekannt gewesen.
Jan Ledebur, ein Holländer und der Häuptling dieser Meute, war ein ausgekochter Schnapphahn, ausgekocht insofern, daß er nie wild drauflosschlug, sondern seine Beutezüge exakt plante, ohne dabei ein allzu großes Risiko einzugehen. Das hatte sich bisher bewährt, und er hatte keinen Grund, von dieser Methode abzugehen.
Im Fall der Goldmine hatte er gründlich recherchiert, das heißt, erst durch eine mehrtägige Beobachtung hatte er erfahren, daß hier Gold abgebaut und gleich an Ort und Stelle in Barren umgegossen wurde.
Gleichzeitig war von den heimlichen Beobachtern festgestellt worden, wie viele Sklaven in der Mine arbeiteten und von wie vielen Soldaten die Mine bewacht wurde. Der Gedanke an die Goldbarren, die in der Mine zum Zugreifen lagerten, hätte bei den meisten Schnapphähnen die Reaktion zum sofortigen Beutereißen ausgelöst. Nicht so bei Jan Ledebur, der völlig kalt blieb, solange er plante.
Er hatte sich also Zeit gelassen, um über sein Vorgehen in Ruhe nachzudenken. Gleichzeitig war die Mine ständig weiter beobachtet worden. In der ganzen Zeit lag die „Vergulde Sonne“ in einer versteckten Nebenbucht eine halbe Meile nordwestlich von Punta Roca Partida.
Jan Ledebur hatte eine Skizze von Punta Roca Partida und der Umgebung angefertigt, er hatte die Zeiten der Wachablösungen notieren lassen, er hatte die Punkte markiert, wo sich die Posten tagsüber und bei Nacht aufhielten, er hatte feststellen lassen, wann der Lagerkommandant die Posten und die Mine kontrollierte – kurz, er hatte sich mit geradezu penetranter Gründlichkeit ein Bild über die spanische Goldmine verschafft.
Und jetzt war sein Warten sogar noch belohnt worden.
Der andere Mann, der neben ihm lag und den Vormittag über die Mine mit beobachtet hatte, war sein Unterführer Mordekai, ein Kerl, der gleich ihm ausgefuchst, aber auch geduldig war. Als Schnapphähne waren sie ein gutes Gespann.
Jan Ledebur schob sich das Kopftuch, das er zu tragen pflegte, etwas aus der Stirn und sagte grinsend: „Na, ist das nicht ein schöner Tag? Und wie gut, daß wir noch nicht zugepackt haben!“
Mordekai, ein Kerl mit zynischen Augen und einem harten Kinn, grinste zurück.
„Zwanzig Soldaten weniger!“ sagte er. „Bleiben noch sechzehn und der Kommandant. Ein feines Spielchen, wenn du mich fragst!“
„Nicht übermütig werden, mein Guter!“ Jan Ledebur drohte schelmisch mit dem Finger.
„Dennoch verdient der Galeonenkommandant einen Kuß!“
„Von dir, eh? Der wird sich bedanken.“ Sie grinsten sich wieder an. Dann wurde Jan Ledebur sachlich. „Was meinst du, warum er dem Kommandanten zwanzig von seinen behelmten Kürbishosen abgezwackt hat?“
Mordekai wiegte den Kopf. „Die Galeone war ziemlich abgetakelt, was vermuten läßt, daß sie von dem Hurrikan erwischt wurde. Das waren keine Gefechtsschäden. Könnte also sein, daß die Olivenfresser Ersatz für Leute brauchten, die ihnen im Sturm außenbords gegangen waren. Der Lagerkommandant war jedenfalls nicht sehr entzückt darüber, daß er zwanzig Kürbishosen abgeben mußte.“
„Wäre ich an seiner Stelle auch nicht“, sagte Jan Ledebur nachdenklich. „Sechzehn Soldaten, ein Sargento und ein Kommandant gegen einhundertachtzig Sklaven – mein lieber Mann! Wenn die wild werden, können wir unseren Coup hier vergessen.“
„Der Kommandant wird nicht so dämlich sein und ihnen auf die Nase binden, daß sie nur noch von sechzehn Kürbishosen bewacht werden“, sagte Mordekai.
„Das nicht“, erwiderte Jan Ledebur, „andererseits sind aber auch Gefangene nicht dämlich, die tagtäglich dieselben Visagen ihrer Bewacher sehen. Plötzlich fehlen genau zwanzig. Das merken die doch. Versetz dich mal in deren Lage. Wenn ich dort unten in dieser verdammten Mine arbeiten müßte, wäre mein ständiger Gedanke, wie ich ausbrechen könnte. Und ich würde lauern, wann sich mir die Chance bietet. Mein ganzes Denken wäre nur noch darauf ausgerichtet. Und da würde ich ziemlich schnell spitzkriegen, daß sich die Bewachung vermindert hat.“
„Hm.“ Mordekai nickte. „So gesehen, hast du recht. Dann sollten wir noch in dieser Nacht zuschlagen.“
„Nein, in der nächsten Nacht.“
„Warum das?“
Jan Ledebur zeigte wieder sein Grinsen. „In dieser Nacht ist die Situation noch neu für die restlichen Soldaten. Um so schärfer werden sie auch aufpassen. In der nächsten Nacht sollten sie sich an die veränderte Situation bereits gewöhnt haben. Wird schon nichts passieren, werden sie denken. Außerdem werden sie müde sein – weniger Posten bedeutet, daß sie häufiger aufziehen müssen. Bisher haben sie ihre Wachen recht gut aufteilen können, so daß immer eine Gruppe wachfrei hatte und sich auspennen konnte. Das hat sich jetzt radikal geändert. Ich bin also nicht für diese, sondern für die nächste Nacht.“
„Und warum nicht die übernächste oder überübernächste? Da sind die dann doch noch müder und lahmer.“
„Vergiß nicht die Galeone“, erwiderte Jan Ledebur. „Sie hatte ziemliche Sturmschäden. Wo werden die repariert? Ich schätze, in Vera Cruz, dem nächstgelegenen Stützpunkt der Olivenfresser, wo es auch eine Werft gibt. Die Galeone ist nach Nordwesten gesegelt – mit den zwanzig Soldaten, die hier abgezogen wurden. Ich glaube auch, daß sie bis Vera Cruz als Ersatz einspringen mußten. Das bedeutet aber, daß sie wieder hierher zurückkehren müssen, und zwar schleunigst, denn hier sind ja immerhin an die einhundertachtzig Sklaven zu bewachen. Es ist also damit zu rechnen, daß diese zwanzig Kürbishosen innerhalb der nächsten drei, vier Tage wieder in Marsch gesetzt werden. Und da müssen wir bereits verschwunden sein – obwohl ich den Plan hatte, länger zu bleiben!“
„Länger zu bleiben?“ fragte Mordekai verblüfft. „Wieso denn das?“
„Ich hatte die Absicht“, sagte Jan Ledebur mit der Sachlichkeit eines kühl rechnenden Pfeffersacks, „die Nigger und diese anderen Wilden eine Weile für uns das Gold abbauen und in Barren gießen zu lassen. Man muß eine Kuh melken, solange sie Milch gibt, verstehst du? Das bisher abgebaute Gold fällt uns sowieso zu. Aber in der Mine ist noch mehr.“ Der Ausdruck in seinem Gesicht wurde noch zynischer. „Was meinst du wohl, wie schnell und ertragreich wir melken können, wenn wir mal ein bißchen die Peitsche einsetzen oder drei, vier von diesen miesen Arbeitsläusen über die Klinge springen lassen, damit die anderen sehen, wo’s langgeht, wenn gefaulenzt wird? Dieser Stützpunktkommandant ist ein Vollidiot. Der hätte längst mehr herausholen können, wenn er härter wäre. Wir haben das doch lange genug beobachtet! Diese Burschen kriegen genug zu fressen und von einer Peitsche war nichts zu sehen. Die Kerle arbeiten im Trott, zwar bewacht, aber keiner reißt sich ein Bein aus. Bei mir wäre das anders!“
Mordekai hatte glitzernde Augen. Ihm war erst jetzt bewußt geworden, welche Reichtümer ihnen entgingen, wenn die Goldmine nicht restlos ausgebeutet wurde. Bildlich gesehen hatten sie die Türklinke zu einer Schatzkammer in der Hand, schlugen die Tür aber wieder zu, um sich mit der kleinen Vorkammer zu begnügen.
„Sind wir Idioten?“ sagte er aufgebracht.
Jan Ledebur warf ihm einen kühlen Blick zu. „Der Sperling in der Hand ist mir lieber als die Taube auf dem Dach, Mordekai. Außerdem gibt es immer noch die zweite Möglichkeit, nämlich die, daß wir hier abräumen, was es abzuräumen gibt, dann verschwinden, ein Weilchen abwarten, bis sich die Gemüter beruhigt haben, und nach diesem Weilchen noch einmal zuschlagen. Du mußt immer nach dem Prinzip vorgehen, andere für dich arbeiten zu lassen. Wir legen uns nach dem Coup wieder auf die Lauer, schauen zu, wie der Stapel der Goldbarren wächst, und wenn wir ihn für hoch genug halten, wird er von uns ein zweites Mal abgeholt, vielleicht sogar ein drittes Mal. Das wird sich aus der Situation ergeben. Aber vergiß dabei nie, daß nur Narren ein Risiko eingehen. Mein Plan, die Mine zu besetzen und die Kerle eine Weile für uns arbeiten zu lassen, birgt ein gewisses Risiko, aber natürlich auch die Gewißheit, mehr einsacken zu können. Jetzt jedoch hat sich unser Gesamtrisiko durch den Abzug der zwanzig Kürbishosen erheblich vermindert, und wir werden uns das holen, was bisher abgebaut wurde. Das muß uns genügen – in der Gewißheit, fast gar nichts aufs Spiel zu setzen. Es ist der Spatz in der Hand, aber wir alle haben dabei kaum etwas riskiert. Bei der Taube auf dem Dach jedoch könnte es uns passieren, daß wir ganz gehörig Federn lassen müssen. Ist das klar?“
„Verstehe.“ Mordekai nickte. „Dennoch schmerzt es, auf das noch nicht abgebaute Gold in der Mine verzichten zu müssen.“
„Vergiß es“, sagte Jan Ledebur, und es klang wiederum so, als spräche er nicht von Gold, sondern von roten Rüben oder einem fettarmen Käse, die auf dem Markt von Vlissingen oder Zwolle zwar angeboten wurden, aber für die Geldkatze der Ledeburs viel zu teuer waren.
Tatsächlich steckte eine solche Denkart sehr tief in Jan Ledebur drin, dessen Vorfahren im heimatlichen Holland – genauer gesagt in Vlissingen – den Gulden zehnmal umdrehten, bevor sie ihn ausgaben. Die Ledeburs zählten zu den Geizhälsen der Stadt. Zum Geiz hatte sich bei Jan Ledebur noch eine Portion Skrupellosigkeit samt berechnender Kühle hinzugesellt – Eigenschaften, die in dem brodelnden Kessel von Totschlägern, Galgenvögeln, Abenteurern und Glücksrittern des gesamten karibischen Raumes recht selten waren.
Jan Ledebur sagte fast etwas unwirsch: „Man muß sich mit dem begnügen, was sich einem anbietet.“ Und er wiederholte: „Anbietet! Das ist die Garantie dafür, daß man nicht riskiert, am Halse in die Länge gezogen zu werden, damit man sich totzappelt. Und ich habe auch keine Lust, milder ausgedrückt, mein weiteres Leben einäugig, einarmig oder einbeinig zu verbringen. Ich möchte in einem Stück und ein munteres Kerlchen bleiben, um die Früchte meiner Arbeit genießen zu können – und das sehr lange.“
Mordekai seufzte, starrte sehnsüchtig dorthin, wo die Goldbarren in einer vergitterten Felsgrotte aufgestapelt waren, und sagte: „Du hast recht, Jan. Mit dem Kopf am Hals und auf den Schultern lebt sich’s länger, vor allem, wenn man’s versteht, sich die Goldbarren einzuteilen.“
„So ist es“, sagte Jan Ledebur. „Und wenn wir genug eingesackt haben, verschwinden wir hier und setzen uns in Holland zur Ruhe.“
The free sample has ended.