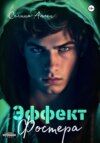Read the book: «Systemische Professionalität und Transaktionsanalyse»
BERND SCHMID
SYSTEMISCHE PROFESSIONALITÄT
UND
TRANSAKTIONSANALYSE
EHP – HANDBUCH SYSTEMISCHE PROFESSIONALITÄT UND BERATUNG
Hg. Bernd Schmid
Der Autor:
Dr. phil. Bernd Schmid (Jg. 1946) leitet das INSTITUT FÜR SYSTEMISCHE BERATUNG, Wiesloch/Deutschland (seit 1984). Er studierte Wirtschaftswissenschaften und promovierte in Erziehungswissenschaften und Psychologie; seit 1979 Lehrtrainer der europäischen und der internationalen Gesellschaften für Transaktionsanalyse; langjähriger Vorsitzender des Weiterbildungs- und Prüfungsausschusses der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse; Berufenes Mitglied der Systemischen Gesellschaft und Gründer der Gesellschaft für Weiterbildung und Supervision (GWS) und des NETZWERKES SYSTEMISCHE PROFESSIONALITÄT; Mitbegründer des Deutschen Bundesverbandes Coaching e.V. (DBVC); Lehr- und Vortragstätigkeit im Bereich Psychotherapie, Coaching, Supervision, systemische Beratung sowie Organisations- und Personalentwicklung. Zahlreiche Veröffentlichungen; Mitbegründer der Zeitschrift Profile. Für sein Rollenkonzept erhielt er 2007 den Internationalen Eric-Berne-Preis. Arbeitsschwerpunkt: seelische Entwicklung und berufliche Wirklichkeiten. www.systemische-professionalitaet.
Bernd Schmid
SYSTEMISCHE PROFESSIONALITÄT
UND
TRANSAKTIONSANALYSE
mit einem
Gespräch mit Fanita English

© 2003 EHP – Edition Humanistische Psychologie
Johannesstraße 22, 51465 Bergisch Gladbach
Redaktion: Ingeborg Weidner
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar
3. Auflage 2008
Umschlagentwurf: Gerd Struwe
- unter Verwendung eines Bildes von Peter Schmid (1984-2001): ›o.T. I.‹ -Satz: MarktTransparenz Uwe Giese, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.
EPUB-ISBN 978-3-89797-520-0
eBook-Herstellung und Auslieferung:
Brockhaus Commission, Kornwestheim
Inhalt
| EINLEITUNG | |
| I. | DER SYSTEMISCHE ANSATZ UND DIE TRANSAKTIONSANALYSE |
| 1. | DER SYSTEMISCHE ANSATZ IN TRAINING UND BERATUNG |
| 1.1 | Die »Mobile-Perspektive« |
| 1.2 | Die Perspektive der Wirklichkeitskonstruktion |
| 1.3 | Ressourcen- und Lösungsorientierung |
| 1.4 | Komplexität und Selbstorganisation |
| 1.5 | Kybernetik zweiter Ordnung |
| 1.6 | Evolution und Kulturbegegnung |
| 1.7 | Systemlösungen |
| 1.8 | Komplexität und Professionskultur |
| 1.9 | Systemische Lernkultur |
| 1.10 | Klassische systemische Vorgehensweisen |
| 1.11 | Klein-Bonum – ein Beispiel für klassische Systeminterventionen |
| 2. | DIE TRANSAKTIONSANALYSE |
| 2.1 | Die Perspektive der Persönlichkeit |
| 2.1.1 | Ich-Zustände |
| 2.1.2 | Das Strukturmodell der Persönlichkeit |
| 2.1.3 | Funktionen |
| 2.1.4 | Die Person in realen Lebenssituationen |
| 2.1.5 | Störungen der Organisation einer Persönlichkeit |
| 2.1.5.1 | Trübung |
| 2.1.5.2 | Beschreibung von Störungen der Integration |
| 2.1.6 | Persönlichkeitsgewohnheiten |
| 2.1.7 | Transaktionen aus der Perspektive der Person |
| 2.2 | Die Perspektive der Beziehungen |
| 2.2.1 | Transaktionen und professionelle Beziehungen |
| 2.2.2 | Transaktionen und Intuitionen über Beziehungen |
| 2.2.3 | Psychologische Spiele in Beziehungen |
| 2.2.4 | Ausbeutungs- und Symbioseaspekte von Beziehungen |
| 2.2.5 | Beziehungen und das Strukturmodell der Persönlichkeit |
| 2.2.6 | Beziehungen und Funktionen |
| 2.2.7 | Nicht-private Aspekte von Beziehungen |
| 2.3 | Die Perspektive der Wirklichkeitskonstruktion |
| 2.3.1 | Der Schlüsselbegriff »Information« |
| 2.3.2 | Wirklichkeitskonstruktionen und transaktionsanalytische Praxis |
| 2.4 | Perspektiven der Entwicklung |
| 2.4.1 | Entwicklungspsychologische Fragestellungen |
| 2.4.2 | Die Lebensskriptanalyse |
| 2.5 | Nützliche methodische Figuren |
| II. | PERSPEKTIVEN PROFESSIONELLER STIMMIGKEIT |
| 3. | PROFESSIONALITÄT, PERSÖNLICHKEIT UND BEGEGNUNG |
| 3.1 | Professionalität |
| 3.1.1 | Professionen |
| 3.1.2 | Professionalität |
| 3.1.3 | Professionelle Begegnungen |
| 3.1.4 | Professionelle Kompetenz |
| 3.1.5 | Professionelle Identität |
| 3.1.6 | Persönlichkeitsentwicklung |
| 3.1.7 | Personalentwicklung |
| 3.1.8 | Kulturentwicklung |
| 3.2 | Persönlichkeit |
| 3.2.1 | Persönlichkeit begreifen |
| 3.2.2 | Die Theatermetapher |
| 3.2.3 | Das Drei-Welten-Modell der Persönlichkeit |
| 3.2.4 | Balancen zwischen den Lebenswelten |
| 3.2.5 | Machbarkeit und Stimmigkeit |
| 3.2.6 | Die Coaching-Perspektive |
| 3.3 | Begegnung |
| 3.3.1 | Kommunikation als Kulturbegegnung |
| 3.3.2 | Intuition in der Begegnung |
| 3.3.3 | Intuitives Zusammenspiel |
| 3.3.4 | Hintergründiges in der Begegnung |
| 3.3.5 | Das Dialogmodell der Begegnung |
| 3.3.6 | Das Eigene finden |
| 3.3.7 | Professionelle Individuation |
| 3.3.8 | Spiegelung |
| 3.3.9 | Genius, Daimon und seelische Bilder |
| 3.4 | Übungen |
| 3.4.1 | Intuitive Bilder und berufliche Szenen |
| 3.4.2 | Bilder zur eigenen Entwicklung und zur Entwicklung in Organisationen |
| 4. | SOZIALE ROLLEN |
| 4.1 | Persönlichkeit als Rollenmodell der Person |
| 4.1.1 | Die Rolle |
| 4.1.2 | Rollenintegration |
| 4.1.3 | Die Würdigung von Rollen und ihren Trägern |
| 4.1.4 | Autonomie und »Ressourcenpolitik« |
| 4.1.5 | Stimmigkeit von Rollen |
| 4.1.6 | Rollenaktivierung |
| 4.1.7 | Rollenkompetenz |
| 4.1.8 | Rollenökonomie |
| 4.1.9 | Beeinträchtigungen |
| 4.1.9.1 | Rollenfixierung und Rollenausschluss |
| 4.1.9.2 | Rollentrübung |
| 4.1.9.3 | Rollenverwirrung |
| 4.1.9.4 | Rollengewohnheiten |
| 4.1.9.5 | Funktionelle Einschränkungen |
| 4.1.9.6 | Rollenmodell und Strukturmodell der Persönlichkeit |
| 4.2 | Rollenmodell und Wirklichkeit in Beziehungen |
| 4.2.1 | Transaktionen |
| 4.2.2 | Vordergründige und hintergründige Transaktionen |
| 4.2.3 | Spiele |
| 4.2.4 | Ausbeutungs- und Symbioseaspekte von Beziehungen |
| 5. | DIE KONSTRUKTION VON WIRKLICHKEITEN |
| 5.1 | Der Bezugsrahmen |
| 5.2 | Definieren, Kodefinieren und Redefinieren |
| 5.3 | Wertung und Abwertung |
| 5.4 | Fokusbildung |
| 5.4.1 | Fokusbildung durch den Therapeuten |
| 5.4.2 | Störungen in der Fokusbildung |
| 5.4.2.1 | Inadäquate Spezifizierung |
| 5.4.2.2 | Inadäquate Konkretisierung |
| 5.4.2.3 | Inadäquate Text-Kontext-Relationen |
| 5.4.2.4 | Inadäquate Polarisierungen |
| 5.4.2.5 | Inadäquate Integration von Unterschieden |
| 5.5. | Pragmatische Unterscheidungen von Wirklichkeiten |
| 5.5.1 | Konsistenz |
| 5.5.2 | Stabilität |
| 5.5.3 | Konstanz |
| 5.5.4 | Inhalt |
| 5.5.5 | Gehalt |
| 5.5.6 | Belegbarkeit |
| 5.5.7 | Bewegkraft |
| 5.5.8 | Entstehung |
| 5.5.9 | Konsequenz |
| 5.5.10 | Sprache |
| 5.5.11 | Vernetzung von Texten und Kontexten |
| 5.5.12 | Vernetzung von Subjekten und Systemen |
| III. | ENTWICKLUNGSDIMENSIONEN PROFESSIONELLEN HANDELNS |
| 6. | SUPERVISION UND PROFESSIONELLE KOMPETENZ |
| 6.1 | Supervisionsperspektiven |
| 6.1.1 | Kontext |
| 6.1.2 | Konzeptualisierung |
| 6.1.3 | Praxis |
| 6.1.4 | Integration der Supervisionsperspektiven |
| 6.2 | Supervision für Entwürfe und Selbstpräsentation |
| 6.2.1 | Designkompetenz |
| 6.2.2 | Marktkompetenz |
| 6.2.3 | Experimentelles Vorgehen |
| 7. | DIE STEUERUNG DER PROFESSIONELLEN BEGEGNUNG IN THERAPIE UND BERATUNG |
| 7.1 | Definition der Klientensysteme und der Klientenrollen |
| 7.2 | Problemdefinition und Fokuswahl |
| 7.3 | Das professionelle Handeln |
| 7.4 | Stimmige professionelle Figuren |
| 7.5 | Aneinanderkoppeln und Begegnung |
| 7.6 | General- und Spezialschlüssel |
| 8. | GEDANKEN ZUR SITUATION IM BEREICH PERSONALENTWICKLUNG, ORGANISATIONSENTWICKLUNG, TRAINING UND BERATUNG |
| 8.1 | Professionalisieren |
| 8.2 | Entromantisieren |
| 8.3 | Ansprüche und professionelle Bescheidenheit |
| 8.4 | Systemlösungen |
| 8.5 | Kulturinvestition und längerfristige Amortisierung |
| 8.6 | Schlanke Eigenorganisation |
| 8.7 | Topographie der Zuständigkeiten |
| 8.8 | Dezentralisierung |
| 8.9 | Der systemische Ansatz und der Aufbau von Kulturen |
| 8.10 | Erschließungsstrategien |
| 8.11 | Kodramaturgie und die Qualifizierung der Kunden |
| 8.12 | Breiten- und Spezialprogramme |
| 8.13 | Ökologie |
| 8.14 | Neue Schwerpunkte in der Eigenqualifikation |
| 8.15 | Bewusste Kulturbegegnung |
| 8.16 | Professionsverbände |
| 8.17 | Veränderung geistiger Haltungen |
| 8.18 | Überforderung? |
| IV. | ÜBERGEORDNETE BETRACHTUNGEN UND EIN BEISPIEL |
| 9. | ANFORDERUNGEN AN PERSÖNLICHKEIT UND DIENSTLEISTUNGEN IN EINER KOMPLEXEN WELT |
| 9.1 | Kulturorientierung |
| 9.2 | Kultur und Inhalt |
| 9.3 | Dilemmakompetenz |
| 9.4 | Persönlichkeit und Bildung |
| 10. | ANWESENHEIT UND KRAFTFELD |
| 10.1 | Das Wesentliche erkennen |
| 10.2 | Anwesenheit und Kraftfelder |
| 10.3 | Der Aufbau von Kraftfeldern |
| 11. | PERSPEKTIVEN FRAKTALER BERATUNG |
| 11.1 | Perspektive der Parallelprozesse |
| 11.2 | Die Analogie des Hologramms |
| 11.3 | Verborgen oder ungesehen? |
| 11.4 | Ist mehr Information bessere Information? |
| 11.5 | Die Perspektive der Fraktale |
| 11.6 | Vertikale und horizontale Fokussierung von Wirklichkeiten |
| 11.7 | Sinn und der fragmentarische Ansatz |
| 11.8 | Randscharfe und kernprägnante Betrachtungen |
| 11.9 | Vitale und sterbende Systeme |
| 12. | DIE BEDEUTUNG DES KONTEXTES. Ein Praxisbeispiel: Das Beratungsseminar »Auslandsmontage« |
| 12.1 | Die Teilnehmer und das erklärte Seminarziel |
| 12.2 | Auftragskontexte (und verdeckte Seminarziele) |
| 12.3 | Das Seminar im Kontext der beruflichen Rahmenbedingungen |
| 12.4 | Hierarchiebeziehungen und Abteilungsrituale |
| 12.5 | Dysfunktionale Symbiose |
| 12.6 | Persönlichkeitsentwicklung |
| 12.7 | Lebensentwurf und berufliche Position |
| V. | DIE PROFESSIONELLE GEMEINSCHAFT |
| 13. | VERBANDSKULTUR DER TA |
| 13.1 | Neudefinition der TA-Identität |
| 13.2 | Weiterbildungen des TA-Verbandes |
| 13.3 | Fachverband verschiedener Professionen |
| 13.4 | Institutionen des Fachverbandes |
| 13.5 | Weiterbildungsbeziehungen |
| 13.6 | Die Prüfungen |
| 13.7 | Notwendige Neuerungen |
| 14. | SELBSTERFAHRUNG UND PROFESSIONELLE QUALIFIKATION |
| 14.1 | Warum Eigentherapie für Ausbildungskandidaten? |
| 14.2 | Verschiedene Rhythmen und Organisationsformen von Eigentherapie |
| 14.3 | Analyse des Kontextes von TA-Ausbildung und Eigentherapie |
| 14.4 | Eigentherapie vor oder während der Ausbildung? |
| 14.5 | Die Ausbildung in einer eigentherapeutischen Bedeutung |
| 14.6 | Therapie beim eigenen Ausbilder? |
| 14.7 | Therapie in verschiedenen Ausbildungsverfahren |
| VI. | FANITA ENGLISH UND BERND SCHMID IM DIALOG |
| 15. | FANITA ENGLISH IM DIALOG MIT BERND SCHMID: GRÜNDUNG UND ENTWICKLUNG EINER SCHULE |
| 15.1 | Die Anfänge |
| 15.2 | Die Gründerpersönlichkeit |
| 15.3 | Ein vergessener Mitgründer |
| 15.4 | Angelegte Entwicklungen |
| 15.5 | Kraftfelder der Nachfolger |
| 15.6 | Die Organisation |
| 15.7 | Nach dem plötzlichen Tod des Gründers |
| 15.8 | Fragen an die Verbandskultur |
| 15.9 | Gewohnheiten und Erneuerungen |
| 16. | ICH LERNE, ALSO BIN ICH: EIN INTERVIEW MIT BERND SCHMID |
| 16.1 | Wie haben Sie zu Ihrem heutigen Beruf gefunden? |
| 16.2 | Was an Ihrer Arbeit schätzen Sie besonders, was motiviert Sie? |
| 16.3 | Woraus haben Sie in Ihrem Leben am meisten gelernt? |
| 16.4 | Welche »Meilensteine« gibt es in Ihrem Leben? |
| 16.5 | Welche Menschen betrachten Sie als richtungsweisend in Ihrem Leben, und warum? |
| 16.6 | Erinnern Sie sich an ganz besondere Momente in Ihrem Leben? |
| 16.7 | Welcher Leitsatz begleitet Ihr Leben? |
| 16.8 | Welche Ziele und Visionen haben Sie für die Zukunft? |
| LITERATUR | |
| Benutzte Literatur | |
| Verzeichnis der Veröffentlichungen von Bernd Schmid | |
| INHALT HANDBUCH-BAND: »Systemisches Coaching und Persönlichkeitsberatung« | |
| »Systemische Personal-, Organisations- und Kulturentwicklung« | |
| »Systemische Organisationsanalyse« | |